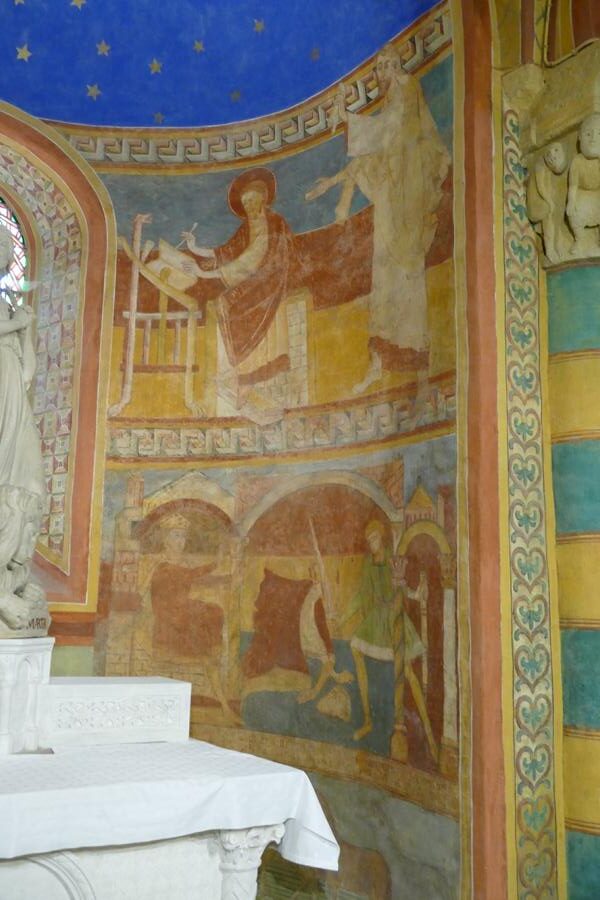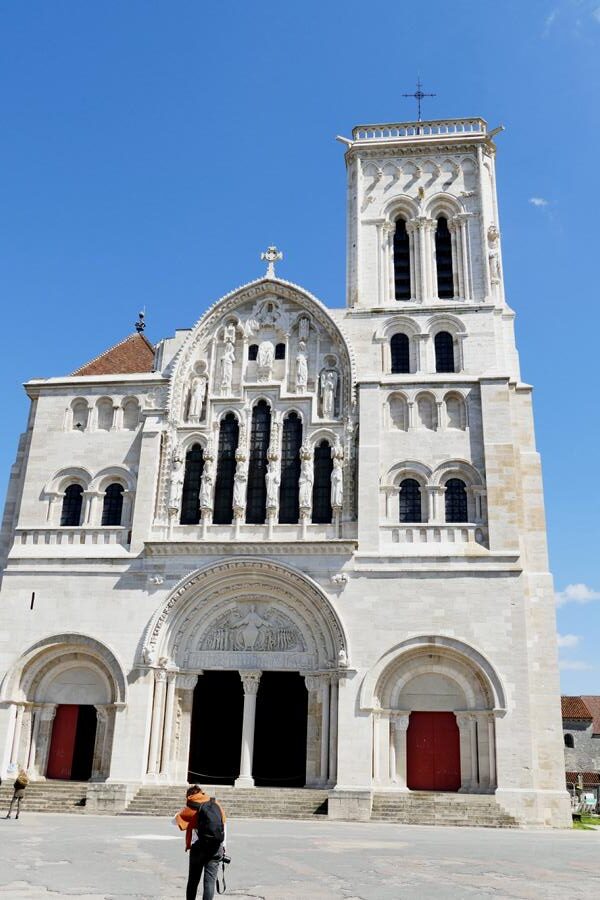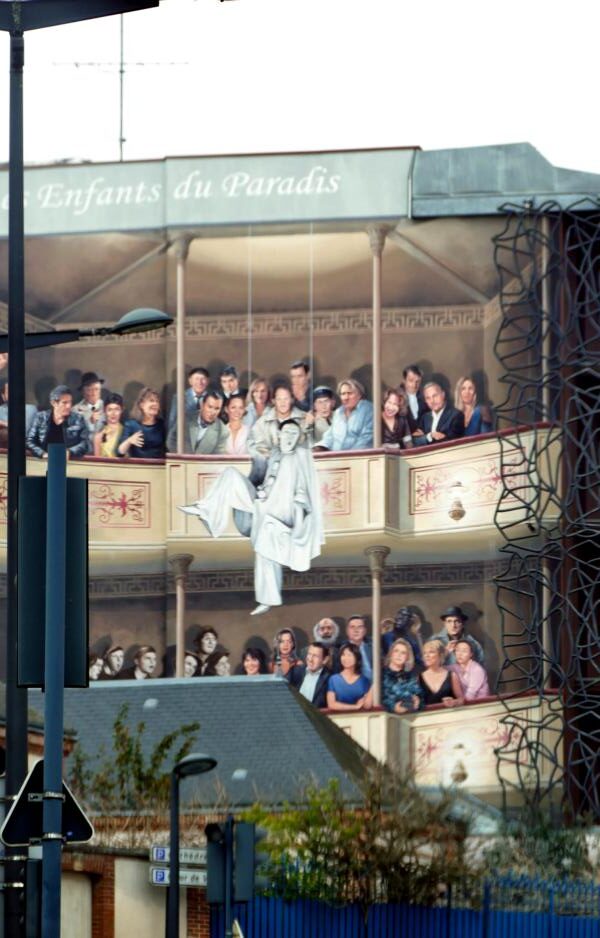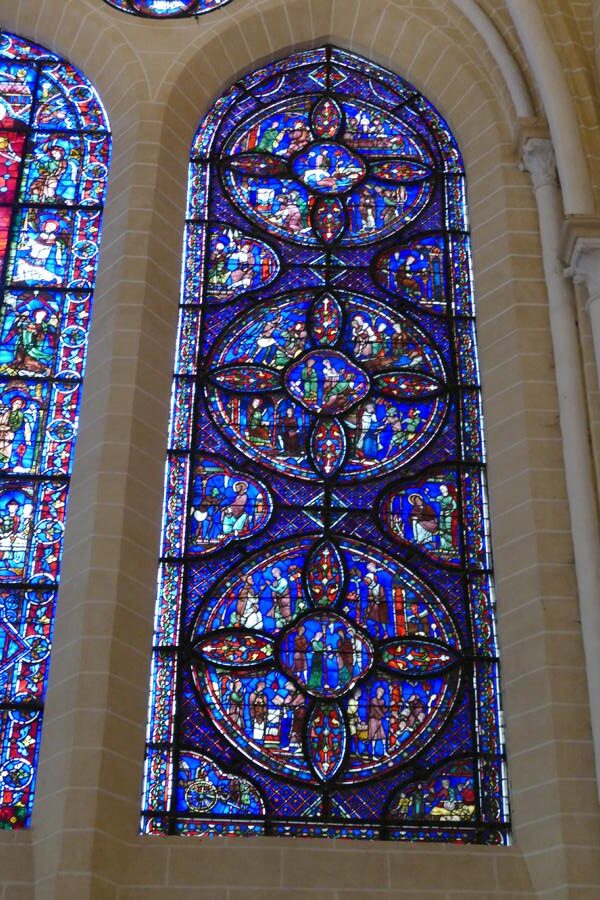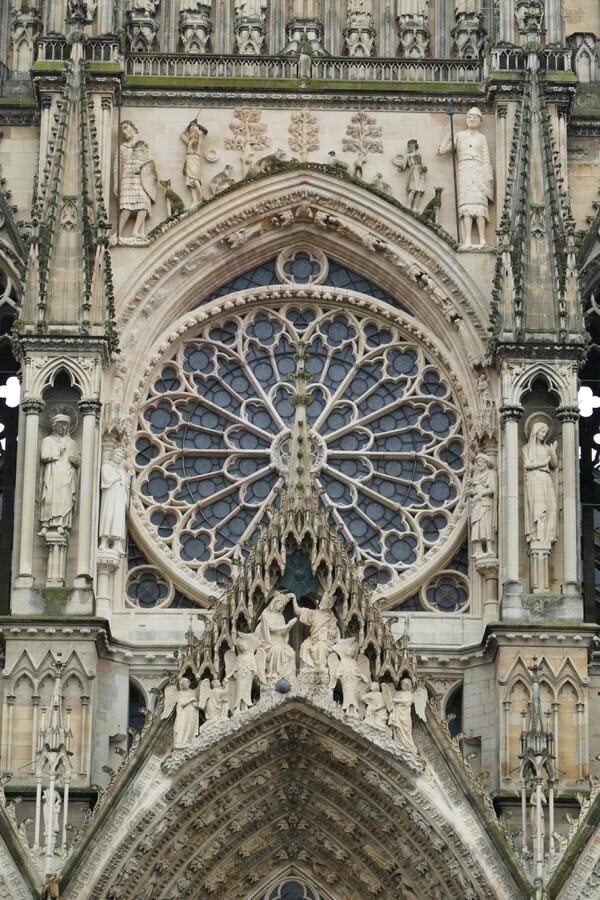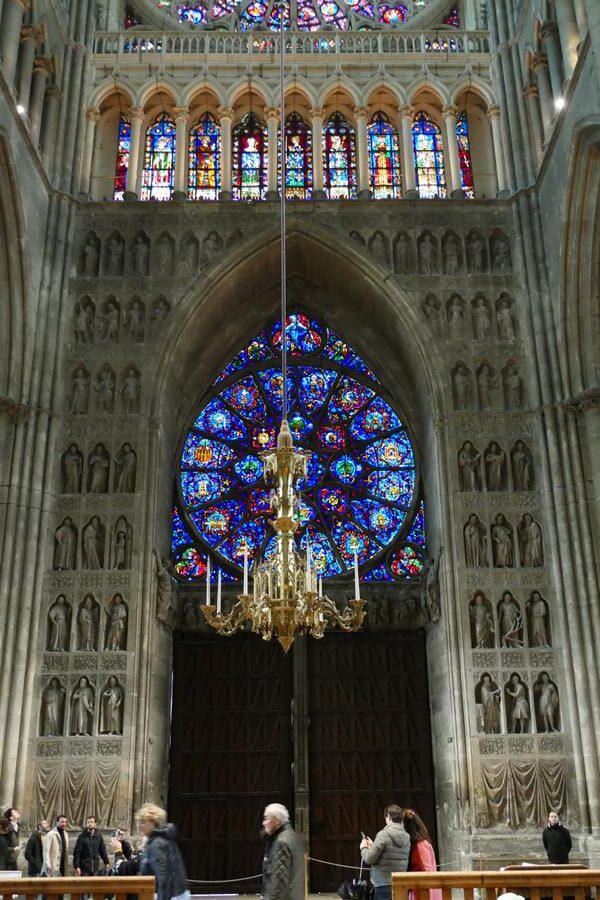Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.
Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular
Urlaub Frankreich 2023
-
Fahrt von Karlsruhe Richtung La Garde-Freinet.
Kleines Chateau am Wegesrand.
Frachtschiffe in einem Containerhafen an einem Kanal.
Ruine einer Burg.
Ein Transporter mit Heu hat sich entzündet und muss gelöscht werden.
Ruine einer Burg.
Das erste Lavendelfeld. Es ist März, also blüht es natürlich noch nicht. -
La Garde-Adhémar: Blick auf das kleine Dorf, welches auf einem Felsen oberhalb der Rhone-Ebene liegt. Im Mittelalter war der Ort eine bedeutende Festung der Adelsfamilie Adhémar. Die katholische Kirche Saint-Michel überragt den Ort. Sie wurde etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut und kann als ein Paradebeispiel der provençalischen Romanik gelten.
Ruine eines Schlosses.
Ruinen von Burgen hoch oben auf den steil abfallenden Felsen an der Rhone-Ebene.
Unbekannte Kirche auf einem Hügel, mit einer davor auf einem Felsen liegenden Ruine eines Turms.
Große Péage an der Autobahn. Die meisten Autobahnen entrichten Mautgebühren für die Benutzung
Brücke für den französischen Schnellzug TGV.
Tunnel durch Felsen. -
Unterkunft in La Garde-Freinet
La Garde-Freinet vom Garten der Unterkunft aus gesehen. -
Golf von St. Tropez: am Strand zwischen Port Grimaud und Sainte-Maxime.
Mittagsblumen.
Am gegenüber liegenden Ufer liegt St. Tropez, ca. 4 km entfernt. Der ganze Golf ist ca. 7 km lang. Seit den 1960er Jahren ist St. Tropez ein beliebter Ort des internationalen Jet-Set. Im dortigen Hafen liegen heute mehr Luxusjachten als Fischerboote.
Dekorative Reste einer Palme.
Selbst die Steine der Uferbefestigung sehen dekorativ aus.
Totes Holz zwischen den Steinen.
Schichten im Stein.
Eingeschlossene Muscheln im Stein.
Am Rand der Bucht Villen, zum Teil mit alten Pinien, Palmen und dekorativen Gartentoren.
Ein Laden mit Dekorationen für drinnen und draußen.
Matthias beim Überbrücken der Wartezeit mit Sudoku. -
Grimaud: Überragt wird der kleine Ort von den Ruinen einer Burg aus dem 11. Jahrhundert.
-
La Garde-Freinet: kleiner Ort mit nur ca. 2000 Einwohnern (Stand: 2021). Er liegt inmitten des „Massiv des Maures“. Seit Jahrzehnten hat er sein altes, gemütliches Flair erhalten. In den 890er Jahren ließen sich hier die Sarazenen nieder und errichteten hier mit einem Netz von Befestigungsanlagen ihren Hauptstützpunkt. Von den Einheimischen wurden diese Befestigungen „fraxinets“ genannt. Aus „Grand Fraxinet“ wurde das heutige Garde-Freinet. Nach der Schlacht von Tourtour wurden die Sarazenen 973 von Graf Wilhelm I. (gest. 993), genannt „Der Befreier“, aus der Provence vertrieben. Ab Ende des 13. Jahrhunderts siedelten sie die Bewohner in der Ebene am Fuße des Forts an. Im 19. Jahrhundert war die Produktion von Korken aus echtem Kork ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Einwohnerzahl war damals wesentlich höher.
Rundgang durch das Dorf. Ganz oben über dem Dort ein Kreuz, auf dem Felsen, auf dem sich die Reste des alten Forts befinden.
Place du Marche mit einem Pavillon von 1872. Hier befand sich früher der Fischmarkt.
Alte Häuser, Details der Fassaden, Impressionen.
Gelbe Blüten des Scharbockskraut.
Verzierte Eingänge zu Häusern, Türklopfer
Église Saint Clément: die Kirche wurde Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut. Der Turm wurde 1785 von Antoine Gras erbaut. Auf der Glocke eingravierte französische Lilien.
Inneres: Porträtbüste mit einer Reliquie des Heiligen Clément.
Weitere Dekorationen in der Form eines Schweins, einer Eule oder einer Spinne aus Metall, an den Fassaden der Häuser.
Rosa Blüte einer Kamelie.
Alter Durchgang unter einem Haus aus Natursteinen.
Alter Brunnen an der „Place de la Fontaine Vieille“. Er stammt von 1812.
Fahrt durch die Landschaft des Massif des Maures, Richtung Mittelmeer. Riesige Pinien, alte kleine Brücken und Herden von Eseln auf der Weide.
Blühende Baumheide.
Blick auf Rayol-Canadel-sur-Mer und das Cap Nègre.
Informationstafel für den Ausblick.
Neapolitanischer Lauch -
Le Lavandou: Der Ort liegt am Fuß des Massiv des Maures an der Mittelmeerküste, zwischen St. Tropez und Toulon. Seinen Namen verdankt das ehemalige Fischerdorf dem massenhaft auftretenden Lavendel.
Kleiner Bach.
Rinde der Korkeiche. -
La Garde-Freinet: oberhalb des Dorfes befinden sich auch die Reste einer alten Mühle. Von hier hat man einen weiten Blick in die Hügel des Massif des Maures. Die Mühle soll restauriert werden und zu einer professionellen Mühle umgebaut werden, die mehrere Arten von Bio-Mehl herstellen soll. Aus diesem Grund sind in der direkten Umgebung der Ruine alle Bäume gefällt worden. Dies war notwendig, um dem Wind freien Zugang zur Mühle zu ermöglichen.
Flechten und Efeuranken an der Natursteinmauer.
Inneres der ehemaligen Mühle.
Schmetterling, Distelfalter
Schmetterling, Schwalbenschwanz
Baumstumpf mit Spuren von Insekten. -
Le Plan-de-la-Tour: kleiner Ort, östlich von La Garde-Freinet, der seit prähistorischer Zeit besiedelt ist.
Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs.
Schmale Gasse mit Platanen.
Alter Hauseingang.
Durchgang unter einem Haus aus Natursteinen.
Schmale Gasse mit Platanen, alte Häuser.Église Saint-Martin: Der Turm der Kirche entstand während des Baus der Pfarrkirche Ende des 18. Jahrhunderts. Überragt von einem schmiedeeisernen Aufbau für eine der 4 Glocken und ein Kreuz. Um 1880 wurde eine Turmuhr angebracht.
Inneres: Blick Richtung Altar
Kanzel
Blick Richtung Eingang
Reliquienschrein mit Porträtbüste
Geschichte des Heiligen Martin als Fliesenbild.
Herz-Jesu-Altar aus Marmor.
Nebenaltar aus Holz und zwei Holzstatuen. -
Fahrt entlang der Strände Richtung Fréjus. Feiner Kiesstrand
Strände und Restaurant bei Saint Aygulf, kurz vor Fréjus. Blick vom Restaurant auf einen kleinen Hafen, im Hintergrund Fréjus.
Strandstraße mit Sandstränden.
Die in kleine Buchten unterteilten Sandstrände sind bei Kitesurfern sehr beliebt.
Auf der anderen Seite der Straße das Sumpfgebiet Étangs de Villepey mit zahlreichen Vogelarten, hier ein Fischreiher.
Reste eines alten Aquädukts.
Von Fréjus aus Fahrt durch die Hügel des Massif de l’Estérel, vorbei an Felsformationen und am am 311 m hoch liegenden Col du Testanier. -
Lac de Saint-Cassien: Stausee des Flusses Biançon, eines Nebenflusses der Siagne, nördlich von Fréjus und dem Massif de l’Estérel gelegen. Die zurückweichende Wasserlinie zeigt die dramatischen Folgen des Klimawandels und des wenigen Regens der letzten Jahre.
-
Bagnols-en-Forêt: der kleine Ort liegt hoch oben auf einem Ausläufer des Massif de l’Estérel. Seit 909 ist die Existenz dieses Ortes urkundlich belegt. Die Kirchen des Ortes sind auf den Grundmauern gallo-römischer Villen errichtet worden.
Krebsgeschwür an einer Korkeiche.
Orangefarbene Felsen, Schluchten und steile Felswände.
Aussichtspunkt bei Bagnols-en-Forêt: Blick Richtung Süden, auf das Massif des Maures.
Blick Richtung Südwesten auf das Massif des Maures, ganz hinten links. Davor die zerklüfteten Gipfel des Montagne de Roquebrun, 373 m hoch. Ganz rechts der kegelförmige Coulet Redon.
Landschaft mit Felsen, Felsplateaus mit Pinien und wilden Schwertlilien.
Weinfelder vor den Felsen der Gebirge.Riesieges Wandbild an der Seitenwand eines Hauses.
-
Port Grimaud: moderner Ferienort an der südwestlichen Ecke der Bucht von Saint-Tropez. Der Ort besteht aus einem Gewirr von Kanälen und ist autofreie Zone. 1966 auf dem Reißbrett begründet. Trotzdem versuchte man ein landestypisches Ortsbild zu schaffen.
Plan des Ortes.
Impressionen des Ortes. Elektroboote zum mieten.
Schaufensterauslage mit maritimen Gelgenständen, dicker Fisch aus einer Kokosnuss.
Ökumenische Kirche St.-Francois d’Assisi: erbaut nach romanischen Vorbildern.
Sehr schlichtes Inneres der Kirche.
Vor der Kirche werden Bootsstege verladen.
Impressionen des Ortes.
Mein Spiegelbild im glasklaren Wasser.
Blüten
Rinde einer Platane.
Seitenwand eines Hauses mit Wandmalerei. Davor Briefkasten und Mülleimer. -
Friedhof von Gassin an der D89 Richtung La Croix-Valmer. Am Eingang 2 Zypressen und ein Denkmal in der Form einer Säule mit eingelassenen Medaillons, oben ein kleiner runder Tempel, bekrönt von einer Statue des Heiligen Josef. 19. Jahrhundert.
Denkmal für die Gefallenen des ersten und zweiten Weltkriegs.
Kränze mit Blumen aus Keramik, typisch für Südfrankreich.
Hinter einem Kreuz aus Stein, eingerahmt von Kakteen, ein weiter Blick in die hügelige Landschaft -
Gassin: es liegt auf einer felsigen Anhöhe in der Mitte der Halbinsel von Saint-Tropez, etwas 4 km vom Meer entfernt.
Beim Parkplatz des überwiegend autofrei gehaltenen kleinen Ortes, eine aus Natursteinen erbaute Touristeninformation.
Vom Aussichtspunkt oberhalb der Touristeninformation hat man einen weiten Blick über die Halbinsel von Saint-Tropez. Hier der Blick Richtung Norden zum Golf von Saint-Tropez. Am gegenüber liegenden Ufer Sainte-Maxime.
Auf der Aussichtsterrasse ein moderne Statue aus Metall des Don Quichotte. Im Hintergrund die Kirche unserer lieben Frau von der Himmelfahrt bzw. Notre-Dame-de-l’Assomption. Mehrere Vorgängerkirchen im Süden des Ortes wurden zerstört. Ende des 14. Jahrhunderts und im 15. Jahrhundert, einer sehr unruhigen Periode in der Geschichte, wurde von den Weinwohnern eine bescheidene kleine Kirche, im Zentrum des Ortes platziert, die durch die Befestigung des Ortes geschützt war. Die jetzige Kirche aus dem Jahr 1558 steht direkt auf dem Felsen und ist durch eine Reihe von Strebepfeilern verstärkt. Der kleine Garten auf der Nordseite der Kirche, wurde bis ins 19. Jahrhundert als Friedhof genutzt. Während der französischen Revolution 1793, beschloss man die Zinnen auf der Spitze des Glockenturms abzureißen. Die Kirche wurde dann zum Versammlungssaal der Sansculotte-Gesellschaft von Gassin, deren Mitglieder den Wahlspruch hatten „Frei leben oder sterben“.Inneres:
Gemälde beim Hochaltar mit Maria und dem Jesuskind, dem Heiligen Laurentius und Johannes.
Porträtbüste als Reliquienschrein vom Heiligen Laurentius, 17. Jahrhundert.
Blüten den Blauglockenbaums.
Turm der Kirche, gesehen von einem kleinen Platz und einer schmalen Gasse.
Das Sarazenentor, eines der mittelalterlichen Stadttore, welches nicht nur in Zeiten von Kriegen schützte, sondern auch in der Zeit der Pest. Eine Tür aus Holz und ein Fallgitter gehörten zum Tor.
Enge Gassen, Durchgänge unter Häusern.
Die Aussichtsterrasse mit moderner Kunst.
Ausblick Richtung Süden, auf die Küste und den Ort la Croix-Valmer.
Der sogenannte „Neue Brunnen“, 16.-17. Jahrhundert.
Hauseingang von 1556.
Durchgänge und Gassen, Häuser aus Natursteinen.Hauseingang von 1422.
Durchblick durch eine Gasse auf den Golf von Saint-Tropez.
Blick vom Parkplatz auf den Golf von Saint-Tropez. -
Sandstrand bei La Croix-Valmer mit langem Steg und großen rostigen Haken zum Befestigen von Booten.
Blick vom Steg auf das Ufer.
Türkentaube auf Stuhllehne des Restaurants „L’Oasis“ direkt am Strand.
Weiterfahrt entlang der Küste Richtung Rayol-Canadel-sur-Mer.
Weinfelder und provencalische Villen.
Zistrose, Schopflavendel und Wolfsmilch, mediterrane Pflanzenwelt.
Eventuell eine Mariendiestel. -
Sainte-Maxime: 14 km nördlich von Saint-Tropez am Golf von Saint-Tropez gelegen. Die bewaldeten Hügel des Massif des Maures schützen den Ort vor dem kalten Mistral. Bereits von den Griechen und Römern besiedelt. Im 7. Jahrhundert wurde der Golf von Saint-Tropez von den Sarazenen besetzt, die 972 das Land verließen, da sie von Guillaume de Provence besiegt worden waren. Der heutige Ort wurde um 1000 gegründet. Der der kleine Hafen hatte allerdings erst im 18. Jahrhundert mit dem Handel von Holz, Kork, Öl und Wein nach Marseille und Italien
eine gewisse Bedeutung. Heute ist es vor allem der Tourismus, von dem der Ort lebt.
Enge Gassen und direkt am Hafen als alter Wehrturm, der „Tour Carrée“, der heute das Museum für lokale Traditionen enthält.
Kirche von Sainte Maxime: 1756-1762 erbaut, aber immer wieder erweitert, weil sie für die Zahl der Gläubigen nicht genug Platz bot. Erst 1938 wurde sie mit dem Umbau eines angebauten Ladens zur Marienkapelle fertiggestellt.
Fassade der Kirche mit einem keramischen Tymponon von 1973
Blick zum Hochaltar.
Rundes Glasfenster von Jacques Robinet.Hochaltar aus polychromen Marmor. Er stammt ursprünglich aus der Chapelle de l’Annonciade in Saint-Tropez (Kapelle der weißen Büßer) und wurde erst 1803 in diese Kirche gestellt.
Orgel von der tschechischen Firma Rieger-Kloss 1993 erbaut.
Blick in eine der Seitenkapellen mit violett verhüllten Statuen der Heiligen, da es sich um die Karwoche handelt.
Historisches Waschhaus (Lavoir), auf dem Weg nach oben.
Oben auf dem Berg das Schlosshotel „Les Tourelles“, umgeben von einem Garten mit Palmen und Zedern.
Blick von oben auf den Strand und die Pont du Préconil.
Häuser, Gassen und Durchgänge auf dem Weg nach unten.
Marktplatz mit Brunnen.
Schaufensterauslage mit kunstvoll dekoriertem Brot, kleinen Puppen in provencalischer Tracht, Regal mit eingelegten Sardinen, einer Spezialität der Gegend.
Hafen mit Fischerbooten und Segelbooten. Blick vom Steg auf den Ort.
Fahrt Richtung Draguignan, welches nördlich des Massiv des Maures, nordwestlich von Fréjus liegt. Felsplateau aus rotem Stein, kleiner Wasserlauf, Brücke und Pinien. -
Draguignan: im 5. Jahrhundert wurde die Gegend von Hormentarius (oder Armentarius oder Saint Hermentaire), dem ersten Bischof von Antibes, christianisiert. Der Legende nach, gewann er das Vertrauen der Bewohner, durch den Sieg über einen Drachen, der das Land bedrohte und zerstörte. Man nahm dann an, dass sich der Name Graguignan daher ableitete. Der Gelehrte Abbé Boyer (1925-2011) widerlegte diese Legende durch seine Forschungen. Demnach leitet sich der Name vom Besitzer eines gallorömischen Landgutes ab, der Draconius hieß. Bereits die mittelalterlichen Texte nennen immer wieder den Namen Dragoniamun oder Varianten davon. Im 17. Jahrhundert, während der Regentschaft von Anna von Österreich für ihren minderjährigen Sohn Ludwig XIV., wurde die Stadt von einer starken Festungsmauer umgeben.
Wappen des Ortes.
Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915.
Denkmal für die Gefallenen des ersten und zweiten Weltkriegs.
Demonstration gegen die Erhöhung des Rentenalters durch Präsident Macron. Die breiten Alleen südlich der Altstadt sind ein Werk von Baron Haussmann, der auch in Teilen für das Pariser Stadtbild verantwortlich war. Er war dort Präfekt zwischen 1853-1870.
Place René Cassin mit einem Bistrot und einem Kino aus der Zeit des Jugendstils.
Leckerer Salat mit Gambas
Straße mit Geschäften, im Hintergrund auf einem Hügel der Uhrenturm, Tour de l’Horloge.
Alter Hauseingang mit darüber liegendem Balkon mit Gitter aus Metall.
Rathaus
Namen der Gefallenen des 1. Weltkriegs an einer großen steinernen Tafel an einer Hauswand. Davor an der Seite eine kleine Kanone.
Blick ein ein Treppenhaus.
Straßenecke mit Cafés. Im Hintergrund die Fassade der Kirche Saint Michel.
Kirche Saint Michel: bereits im 10. Jahrhundert gab es hier eine Pfarrkirche. Nach mehreren Vorgängerbauten, wurde von 1649-1665 ein 39 m hoher Turm gebaut. Das damals noch existierende romanische Kirchenschiff, wurde 1864-70 abgerissen. Es entstand eine sechsachsige neugotische Kirche. Da diese Kirche in den 1950er Jahren drohte einzustürzen, wurde 1962 ein niedrigeres Holzdach eingebaut, welches bis heute den Bau stützt. Dieses beeindruckende Holzgewölbe, ist charakteristisch für das Innere der Kirche.
Fassade der Kirche
Inneres:
Blick zum Hochaltar. Links die vergoldete Statue des Erzengels Michael (18. Jahrhundert), dem die Kirche geweiht ist. Außerdem ist sie der Muttergottes – Notre Dame geweiht. Rechts die vergoldete Statue des Schutzheiligen von Draguignan, Saint Hermentaire (auch Armentarius, erster Bischof von Antibes). Der Legende nach, war er derjenige, der den Drachen überwältigte, der das Wahrzeichen der Stadt ist.
Chor mit Hochaltar und dem Holzgewölbe.
Taufkapelle mit neugotischem Gewölbe.
Seitenaltar mit Statue von Christus.
Seitenaltar mit Statue der Muttergottes
Blick auf die Orgel von 1979.
2010 wurde die Pfarrei dem schmerzhaften und unbefleckten Herzen Mariens geweiht.
Unweit des alten Stadtkerns, erhebt sich auf einem Felsen, an der Stelle des 1660 zerstörten Wehrturms, der Uhrenturm Tour de l’Horloge. 1661 erbaut, 24 m hoch. 1723 wurde eine Glocke mit dem schmiedeeisernen Aufbau angebracht.
An seiner Basis sind noch wenige Reste des römischen Castrum zu erkennen.
Von hier hat man einen schönen Blick über die Stadt, unter anderem auf den Turm der Kirche Saint Michel.Chapelle Saint Sauveur: 12. Jahrhundert. Sie war Teil der Burg, die den Johannitern von St. Johannes von Jerusalem gehörte. Nachdem sich die Johanniter zurückgezogen hatten, diente die Kapelle als Sprengstoffdepot.
Enge Gasse.
Blick in einen Hausflur mit den Sicherungskästen aller Wohnungen.
Dekoration an einer Häuserwand mit venezianischen Gondeln, Schmetterlingen und Masken.
Oberhalb einer schmalen Gasse sind Schmetterlinge angebracht.
Schaufenster mit großen Halbedelsteinen, Opal.
Laden mit ungewöhnlichen Dekorationen, ein großer, weißer Hund, französische Bulldogge aus Plastik steht vor dem Laden.
Wandmalerei an der Seitenwand eines Hauses. Aus hunderten gemalter Tiere wurde das Porträt von Claude Gay (1800-1873) gebildet. Er war Botaniker und Reisender und wurde in Draguignan geboren.
Eingang des Hôtel Bertin mit üppigen Leuchtern an der Wand neben der Tür.
Schaufenster mit verschiedenen Totenköpfen, gebildet aus Perlen oder kleinen Schuhen aus Plastik.
Théâtre de l’Esplanade am Boulevard Georges Clemenceau. Ein Teil der Fassade stammt noch von 1836.
Alter Hauseingang mit darüber liegendem Balkon mit Gitter aus Metall.
Hausfassade, Jugendstil.
Üppig dekorierte Hausfassade eines Eckhauses, am Giebel Medaillons mit Relief eines Äskulabstabs. -
Sillans-la-Cascade: kleiner Ort mit unter 1000 Einwohnern. Bekannt ist der Ort für seine Wasserfälle.
Plan der Umgebung mit den Wegen zum Wasserfall.
Ein mit Steinen oder Zäunen aus Holz begrenzter Weg, führt durch unberührte Natur mit hohen Bäumen.
Aussichtsterrasse. Gespeist vom Fluss Bresque, stürzt das Wasser 44 m in ein Becken mit türkisblauem Wasser. Baden ist hier nicht erlaubt.
Der lose Tuffstein des Wasserfalls ist sehr brüchig. Algen, Pflanzen und kleine Stalaktiten haben sich hier gebildet. -
Cotignac: Der Ort mit etwas über 2000 Einwohnern, liegt unterhalb einer 80 m hohen und 400 m langen Felswand aus Tuffstein.
Blick auf den Place de la Marie mit Uhrturm und Brunnen.
Blick auf die Felswand mit riesigen Stalaktiten.
Im Felsen befinden sich Höhlen und einige Häuser sind direkt an den Fels angebaut. -
Saint-Tropez: der berühmte Küstenort an der französischen Riviera, liegt am Golf von Saint-Tropez. In den 1960ger Jahren zog er den internationalen „Jet Set“ an und ist bis heute bekannt für seine Strände und sein Nachtleben.
Benannt ist die kleine Hafenstadt nach dem Heiligen Torpes, einem frühchristlichen Märtyrer. Bis in das 20. Jahrhundert war es nur ein kleines Fischerdorf, auch wenn sich bereits im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler hier ansiedelten, wie zum Beispiel Henri Matisse.
Blick auf Saint-Tropez von der Küstenstraße aus.
Stadtplan: Links oben der neue und der alte Hafen. Rechts oben auf einem Hügel liegt die Zitadelle. Zwischen ihr und dem alten Hafen, die Altstadt.
Chapelle du Couvent: Kirche eines ehemaligen Kapuzinerklosters, welches 1617 hier bestand.
Auslage eines Ladens mit Blumentöpfen.
Place des Lices: zwei mal pro Woche ist hier Markt. Im Hintergrund ein Brunnen, Platanen und Bänke.
Schaufenster von edlen Modelabeln säumen die Straßen, hier Dolce & Gabbana.
Garten mit Palme und blühendem Blauregen bzw. Glyzine.
Gebäude des Modelabels Dior.
Bulgari und Armani in historisch anmutenden Häusern.
Farbiger Gorilla aus Plastik als Dekoration auf einem Dach.
Tür und Wansvertäfelung aus Holz mit Türklopfer aus Metall.
Häuser am alten Hafen. Neben der Touristeninformation noch Reste der alten Stadtmauer mit einem Durchgang. Dahinter sieht man den Turm der Kirche Notre Dame de l’Assomption aus dem Jahr 1694. Die restliche Kirche wurde 1784 im Stil des italienischen Barock fertiggestellt.
Im Hafen Segelboote, aber auch luxuriöse Yachten. Parkplatz für Motorräder direkt an der Mole.
Taucher auf einem Boot im Hafen.
Luxuriöse Yacht mit maltesischer Flagge am Heck.
Blick zum neuen Hafen mit Kran und Leuchtturm.
Alte Inschrift an einem Haus.
Rest des ehemaligen Palais des Vogtes des Malteserordens (Ballivus) Pierre-André de Suffren (1729-1788).
Historische Fassaden der Häuser beim Rathaus.
Prächtig geschnitzte Tür mit Gitter aus Metall am Balkon.
Hôtel de Ville, Rathaus von 1872.
Giebel des Hôtel de Ville mit Wappen.
Enge Gassen in der Altstadt.
Église Notre Dame de l’Assomption: die Kirche wurde im Stil des italienischen Barock erbaut, fertiggestellt 1784. Fassade mit Portal, begrenzt von ionischen Säulen und einer Statue über dem Eingang.
Blick auf den 1694 errichteten Glockenturm der Kirche.
Fenster mit Fensterladen, Ranken an der Fassade und Taube.
Türklopfer in der Form eines Fischs.
Gefalteten Boote aus Papier als Dekoration vor einem Laden.
Haus mit Brunnen davor.
Blick auf einen kleinen Strand.
Häuser mit Balkonen und Straßenlaterne an einer Hauswand.
Eine der Straßen hoch zur Zitadelle.
Pause am Straßenrand, oberhalb der Häuser, unterhalb der Zitadelle mit phantastischem Blick auf den Golf von Saint-Tropez.
Silbermöwe ganz nah.
Blick auf Saint-Tropez und den Glockenturm der Kirche Notre Dame de l’Assomption.
Vor dem Friedhof direkt am Meer, eine Weltkugel aus Metall und ein Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915.
Marine-Friedhof, Cimetière Marin: 1791 unterhalb der Zitadelle eröffnet und mehrfach erweitert. Im Zentrum ein Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs. Unter anderem ist hier der Schauspieler und Regisseur Roger Vadim begraben.
Zitadelle: bereits im 8. Jahrhundert befand sich an diesem strategisch wichtigen Ort eine Festung. 1590-1607 erbaut, diente sie vor allem als Verteidigung gegen das Osmanische Reich. Allerdings erwies sich die Zitadelle im Jahr 1637 als nützlich, als während des Dreißigjährigen Krieges, 21 spanische Galeonen in die Bucht segelten. In dem sechs-eckigen Festungsbau mit Eckturm und einer weitläufigen umgebenden Befestigungsmauer, befindet sich seit 1958 das Marinemuseum, Musée de la Marine, seit 2013 wieder eröffnet mit einer thematisch etwas anderen Ausrichtung, zusammen mit dem Musée l’Histoire locale.
Eingang
Gebäude der alten Kapelle.
Brunnen, im Hintergrund der Donjon der Zitadelle.Blick in den Festungsgraben.
Ausstellungsraum zum Thema Rettungsboote und Rettungsschwimmer im Mittelmeer.
Leuchtfeuer auf einer der Bastionen der Festung. Im Hintergrund Golf von Saint-Tropez.
Eine der Bastionen mit alten Kanonen.
Der Donjon, der sechs-eckige zentrale Festungsbau der Zitadelle.
Die Brücke über den Festungsgraben.
Über dem Festungsbau die Flaggen der Europäischen Union, von Frankreich und von Saint-Tropez.
Innenhof des zentralen Festungsbaus (Donjon).
Türen zu den Museumsräumen im Erdgeschoss und der 1. Etage, mit umlaufenden Balkon.
Plan der 3 Etagen des Festungsbaus mit seinen Ausstellungsräumen.
Modell von Saint-Tropez und der Zitadelle im Jahr 1560.
Modell eines historischen Segelschiffs, Dreimaster.
Ausstellungsraum zur Geschichte des Fischfangs.
Sternenglobus und Sextant, Hilfsmittel zur Navigation.
Büsten von zwei berühmten Seefahrern. Links Hippolyte Bouchard (1780-1837), rechts Jean-François Allard (1785-1839).
Weltkarte mit den Routen von Hippolyte Bouchard in blauer Farbe, Jean-François Allard in gelber Farbe und Pierre André de Suffren (1729-1788) in roter Farbe.
Modell eines historischen Segelschiffs, Dreimaster.
Modell des Kriegsschiffs „Charlemagne“ (1897-1920). Realisierung von Roland Macquard.
Expeditionsreisen in fremde Länder, hier Madagaskar, Modell eines Segelschiffs, ausgestopfte Tiere, Katta.
Mitbringsel von einer Reise nach China, Vasen, Perlmuttintarsien, bestickte Seide.
Ausstellungsraum zum Motorbootsport.
Blick von der 3. Etage, der Dachterrasse auf die Kapelle und den Brunnen im Eingangsbereich.
Blick Richtung Saint-Tropez
Baustelle einer Villa mit Kran und vielen Pinien im Umland von Saint-Tropez.
Blick auf das Freilichttheater in den Mauern der Zitadelle.
Blick in den Innenhof des zentralen Festungsbaus – Donjon.
Ein Pfau im Eingangsbereich.
Enge Gassen mit Torbögen darüber.
Chapelle de la Miséricorde: Turm mit bunten Dachziegeln, Fassade und Detail des Eingangsportals. -
La Garde-Freinet:
Stahlarmierung beim Straßenbau mit Schutzkappen.
Knoblauch-Baguette mit Olivenöl
Umzug mit Kindern in Verkleidung, genau eine Woche vor Karfreitag.
Fahrt durch Wälder mit Korkeichen, Felsplateaus.
Wiese mit blühenden Sternanemonen. -
Ollioules: nordwestlich von Toulon gelegen.
Durchfahrt unter einem Haus in der Altstadt.
Marktplatz mit einem Handwerkermarkt.
Marktplatz mit dem Rathaus, Hôtel de Ville.
Brasserie am Marktplatz.
Auf dem Marktplatz ein Markt mit verschiedenen Handwerkern. Ein Kunstschmied hat ein lebensgroßes Pferd aus Metall aufgestellt.
Stand des Kunstschmieds mit verschiedenen Exponaten, ein Blumengesteck, Masken und der Eifelturm aus Metall.
Daneben ein Pferd und ein Holzkarren, auf dem Dinge aus Metall ausgestellt sind. Hufeisen, Haken, Schlösser.
Kapelle mit Trompete, Saxophon, Basstuba und Banjo zieht am Marktplatz vorbei.Église Saint-Laurent: der Kirchturm aus dem 17. Jahrhundert, mit Glocke in einem Gestell aus Metall. Er steht direkt neben dem Rathaus und wurde auf der alten romanischen Apsis errichtet. Im 19. Jahrhundert wurde er um eine Etage erhöht, um die Uhr und das Gestell aus Metall für die Glocke unterzubringen.
Am Fuß des Glockenturms haben Ausgrabungen die Reste eines mittelalterlichen Friedhofs ans Licht gebracht.
Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1096 und bezieht sich auf ein kleines, einschiffiges Gebäude, das im 12. Jahrhundert abgerissen wurde. Dieses Gebäude wurde dann durch einen einschiffigen Bau mit drei ungleichen Jochen ersetzt. Dabei handelt es sich um das heutige Mittelschiff, das mit einem Tonnengewölbe bedeckt ist. Von 1475-1517 wurden Reparaturen und eine Vergrößerung der Kirche erforderlich. Das Kirchenschiff ist von sechs großen Arkaden mit vierfachen Vorsprüngen durchbrochen. Je ein Seitenschiff mit geringeren Abmessungen, aber identischem Stil. 1517 wurde die vergrößerte Kirche erneut geweiht. Im Jahr 1652 kamen 6 Seitenkapellen zur Stützung der Seitenschiffe hinzu und ruhten auf dem Wall im Süden aus dem 14. Jahrhundert. Der Grundriss der Kirche ist nunmehr fast quadratisch: 26,5 x 25 m, 10 m hoch. 3 Schiffe mit 6 Kapellen mit Tonnengewölbe. Ein ungewöhnlicher Bau im romanischen Stil, der erst Anfang des 16. Jahrhunderts fertiggestellt wurde.
Informationstafel mit Grundrissen und Geschichte der Kirche.
Sehr schlichte Fassade der Kirche.
Inneres:
Blick Richtung Hochaltar. Alle Statuen sind mit violettem Stoff verhüllt, da es die Woche vor Ostern ist.
Blick in das südliche Seitenschiff mit den Seitenkapellen.
Blick vom nördlichen Seitenschiff Richtung Mittelschiff.
Weihwasserbecken aus Marmor mit Palmwedeln dekoriert, einen Tag später ist Palmsonntag.
Hochaltar mit dem dahinter stehenden Tabernakel zur Aufbewahrung der Hostien. Angefertigt 2017 im romanischen Stil vom spanischen Künstler Miguel A. Caballero Perez.
Orgel in einer der Seitenkapellen.
Fontaine Saint-Laurent: Auf dem Platz vor der Kirche steht ein Brunnen aus dem 16. Jahrhundert bezeugt. Das ursprünglich sechseckige Becken wurde im 18. Jahrhundert in ein achteckiges Becken umgewandelt. Der skulptierte Mittelteil wurde 1699 von der Stadt in Auftrag gegeben und greift die Struktur der Brunnen der Renaissance auf. Das barocke, provenzalische Dekor zeigt groteske Masken mit Girlanden aus Blumen, Muscheln und Arcanthusblättern. Ursprünglich stand darauf eine Statue des Heiligen Laurent, die während der Revolution zerbrochen und durch eine Weltkugel ersetzt wurde.
Kleiner Platz bei der Kirche.
Blick zum Platz vor der Kirche von einer der engen Gassen aus.
Restaurant mit origineller Dekoration, schönen Gittern aus Metall und Glasmalereien.
Fassade eines alten Hauses mit Balkongitter aus Metall.Glaskunst, Phiolen und Ohrringe aus Glas.
In den engen Gassen sind Stände mit Kunsthandwerk aufgebaut. Im Hintergrund oben, der Turm von den Resten des Schlosses.
Haus mit Durchfahrt und kunstvoll gestalteter Rahmung eines Fensters aus der Zeit der Renaissance. Die Renaissance und der Beginn des 17. Jahrhunderts, war für Ollioules ein goldenes Zeitalter mit einer starken Entwicklung, sowohl in wirtschaftlicher, als auch in architektonischer Hinsicht. Der blühende Seehandel und die steigende landwirtschaftliche Produktion, führten zur Entwicklung einer wohlhabenden Bürgerschicht. 1471 gab es mit Ort 199 Häuser, in den 1570ger Jahren bereist etwa 600 und zu Beginn des 18. Jahrhunderts bereits über 700 Häuser.
Informationstafel.
Enge Gasse.
Blick in die Werkstatt eines Instrumentenbauers.
Haus vom Ende des 15. Jahrhunderts, zu Beginn der Renaissance. Elemente aus verschiedenen Epochen wurde hier wieder verwendet. Im Erdgeschoss zwei schöne Portale aus dieser Zeit. Darüber ein großes, zum Teil zugemauertes Fenster im Stil der ersten provenzalischen Renaissance vom Ende des 15. Jahrhunderts.
Wasserspeier aus dem Mittelalter, der hier auch wieder verwendet wurde. Eigentlich sollte er sich am Dach befinden. Hier ist er nur dekoratives Element.
Aufstieg durch enge Gassen, Durchfahrten unter Häusern, hinaus auf den Hügel, auf dem sich die Reste des Schlosses befinden.
Blick von oben über Ollioules.
Die Ruinen des Schlosses.
Abstieg durch enge Wege, entlang der Befestigungsmauern mit vielen Pflanzen.
Enge Gassen, Durchfahrt durch ein Haus.
Blick zurück auf den Turm der Ruine des Schlosses.
Weibliche Figur aus Plastik, aus einem Comic als Werbefigur in einem Laden mit Kosmetikartikeln.
Geschäft mit Lebensmitteln mit Osterdekoration auf den Fenstern. In Frankreich bringen die Glocken die Ostereier.
Weiterfahrt vorbei am Ortsrand von Ollioules mit bunten Häusern und dem Blick auf den Hügel mit der Ruine des Schlosses. -
Gorges d’Ollioules: nördlich von Ollioules, vom Fluss Reppe gebildete Schlucht.
-
Saint-Cyr-sur-Mer: der Ort liegt an der Côte d’Azur, neben der A 50, östlich von Cassis und Marseille. Neben einem kleinen Hafen mit privaten Booten, liegt ein Sandstrand mit zahlreichen Restaurants, Eisdielen und Cafés.
-
Eguilles: private Unterkunft, Dekoration in der Toilette, Wolken.
Wilde Orchidee, prächtige Ragwurz, Ophrys splendida
Kontakt mit einem Schwalbenschwanz.Dreieckiger Glücksklee
-
Les Baux-de-Provence: Ruinenstadt auf einem Felsplateau, welches bereits in der Jungsteinzeit besiedelt war. Das im 10. Jahrhundert erbaute Schloss, war bis zum 15. Jahrhundert bewohnt. Im 12. und 13. Jahrhundert Hauptstadt einer Grafschaft. Im 13. Jahrhundert Zentrum der höfischen Dichtkunst und Sammelpunkt der Troubadoure. Als Hochburg der Hugenotten und Zufluchtsort der Aufständischen von Aix-en-Provence, wurde die Stadt 1631 vom Herzog de Guise belagert und eingenommen. 1642 gelangte der Ort als Schenkung an die Grimaldi. Der 1880 verstorbene Charles Maxime de Grimaldi führte als letzter den Titel eines Marquis des Baux. 1821 entdeckte man reiche Lagerstätten von Bauxit, einem Grundstoff für die Aluminiumgewinnung. Der Rohstoff wurde nach dem Ort benannt.
Straße führt auf den Felsen mit der Ruinenstadt zu. Rechts die Felsen, in denen sich die ehemaligen Bauxit-Steinbrüche befinden.
Die Ruinenstadt Les Baux-de-Provence mit der Aussichtsterrasse am Ende des Felsens.
Auf der anderen Seite der Straße einer der Felsen mit den ehemaligen Bauxit-Steinbrüchen. -
Direkt hier befinden sich die Carrières de Lumières: in den ehemaligen Bauxit-Steinbrüchen gibt es eine spektakuläre, digitale Ausstellung mit wechselnden Themen. Dem Eingang gegenüber bizarre Landschaft aus Felsen und Vegetation.
Dazwischen ein in die Felsen gebautes Museum und der Garten eines Künstlers mit seinen Plastiken.
Der Weg führt vorbei an großen, geraden Einschnitten, die vom Abbau des Bauxits zeugen.
Kurz vor dem Eingang der Blick in eine der Hallen, die durch den Abbau des Bauxits entstanden sind. Hier befindet sich ein Café, Toiletten und im Hintergrund eines Plastik, inspiriert vom Löwen-Tor in Mykene in Griechenland.
Der Eingang zu den Carrières de Lumières.
Thema der Ausstellung ist seit Februar 2023 Vermeer und Van Gogh, sowie Mondrian.
Informationstafeln am Eingang geben kurze Einführungen zu den gezeigten Malern:
Jan Vermeer von Delft (1632-1675): holländischer Maler des späten 17. Jahrhunderts. Er verbrachte sein ganzes Leben in Delft. Er wuchs in einer protestantischen Familie auf, konvertierte aber zum Katholizismus nach seiner Heirat mit Catharina Bolnes. Seine ersten Bilder waren Historienbilder, bekannt geworden ist er aber für seine privaten Szenen des Mittelstandes, die Genremalerei. Heute sind nur 37 Bilder von ihm bekannt, die berühmtesten sind die Ansicht von Delft und Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge.
Gabriel Metsu (1629-1667): ein ebenfalls auf Genremalerei spezialisierter holländischer Maler.
Pieter de Hooch (1629-1684): Genremaler des Barock aus Holland. Im Gegensatz zur Genremalerei Vermeers, zeigt er mit Präzision den kulturellen und sozialen Kontext, was die Gemälde zu einem wertvollen Zeugnis der niederländischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts macht.
Frans Hals (1581-1666): ein Porträtmaler von Hollands goldenem Zeitalter. Auf seinen Gemälden sind die Pinselstriche sichtbar und die Farbpalette beschränkt sich meist auf eine einzige dominierende Farbe.
Hendrick Cornelisz van Vliet (1611-1675): ebenfalls ein Künstler aus Delft und Mitglied der Lukasgilde, einer zunftartigen Bruderschaft von Malern, Schnitzern und Buchdruckern. Bekannt wurde er durch seine Gemälde von Innenräumen von Kirchen. Architekturbilder waren zu seiner Zeit sehr populär.
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): er gilt als einer der bedeutendsten und bekanntesten niederländischen Maler des Barock. Zu seinem Gesamtwerk gehören Porträts, biblische und mythologische Szenen, sowie Landschaften. Viele seiner Werke zeichnen sich durch starke Hell-Dunkel-Kontraste aus.
Gerrit van Honthorst (1590-1656): in Italien bekannt unter dem Namen Gherardo della Notte, wegen seiner stark kontrastierenden Gemälde mit Kerzenlicht. Er war ein Anhänger Caravaggios. Er hatte zahlreiche adlige und königliche Kundschaft, deren Kindern er auch Malunterricht erteilte. Er war einer der wenigen niederländischen Maler mit einer internationalen Karriere.
Jan van Goyen (1596-1656): er revolutionierte die Landschaftsmalerei.
Jan Steen (1626-1679): Er malte Szenen voller Leben, zum Teil sogar chaotisch. Sie waren inspiriert vom alltäglichen leben und wirkten auf den ersten Blick oft lustig. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man allerdings Details, die die Menschen vor bestimmten Verhaltensweisen warnen soll.
Gerard Dou (1613-1675): ebenfalls ein niederländischer Maler des Barock. Die minutiöse Darstellung von Details in seinen Bildern führte zur Begründung der sogenannten Leidener Feinmalerei, die bis ins 18. Jahrhundert gepflegt wurde.
Jacob van Ruisdael (1628-1682): er gilt als der berühmteste Landschaftsmaler im niederländischen Goldenen Zeitalter. In seinen Gemälden variiert er seine Landschaften durch unterschiedliches Wetter und Licht.
Willem van de Velde (1633-1707): bekannt als „der Jüngere“ wurde bekannt durch seine maritimen Landschaften mit niederländischen Schiffen.
Hendrick Cornelisz Vroom (1566-1640): auch er wurde bekannt durch Gemälde von Seeschlachten und maritimen Landschaften. Er gilt als der Begründer der maritimen Malerei in den Niederlanden des Goldenen Zeitalters.
Rachel Ruysch (1664-1750): während ihrer Jugend half sie ihrem Vater, einem Professor für Botanik, Blumen zu präparieren. So wurden Blumen ihr bevorzugtes Sujet bei der Malerei.
Vincent van Gogh (1853-1890): er gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. Nach heutigem Wissensstand, hinterließ er über 900 Gemälde und über 1000 Zeichnungen. Sein Stil zeichnet sich durch kräftige Farben und dicke Pinselstriche aus. Er verkörpert das zu Lebzeiten verkannte Genie, dessen Werke damals ignoriert wurden. Heute allerdings zählen sie zu den begehrtesten der Welt. Piet Mondrian (1872-1944): Diese Diese Ausstellung präsentiert die bekannten Werke Mondrians aus Gittern in Primärfarben, die seit langem Künstler aus allen Gesellschaftsschichten inspirieren und die Popkultur beeinflussten.
Informationstafeln zu Themen der Malerei in den Niederlanden zu dieser Zeit, wie z.B. die niederländische Gesellschaft, Porträtmalerei, die Musik dieser Zeit, Winterszenen, Seeschlachten, Stilleben und vieles mehr.
Ausblick bzw. Werbung für andere künstlerische Projektionen mit anderen Künstlern, wie Paul Gauguin, Gustav Klimt oder Leonardo da Vinci.
Beginn der Projektionen über Vermeer und Van Gogh und andere niederländische Künstler, jeweils mit passender Musik unterlegt. So wandert man durch den Steinbruch, vorbei an den überlebensgroßen Projektionen.
Jan Vermeer von Delft: unter anderem Der Astronom, Dienstmagd mit Milchkrug, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge und Ansichten von Delft.
Weitere Genrebilder mit Musikern und Festen von niederländischen Malern des Barock.
Pieter de Hooch: Magd mit Eimer in einem Hinterhof.
Franz Hals: z. B. Der Hofnarr mit Gitarre.
Architekturbilder mit Innenräumen von Kirchen von Hendrick Cornelisz van Vliet .
Rembrandt Harmensz van Rijn: Selbstbildnisse, die berühmte Nachtwache und seine Frau Saskia.
Gerrit van Honthorst mit seinem Flötenspieler oder der im Kerzenlicht stark kontrastierende Gruppe von Musikern.
Götterwelt auf dem Olymp von Cornelis van Poelenburgh.Landschaften, Genrebilder und Winterszenen verschiedener niederländischer Maler.
Gerard Dou: z. B. Küchenmädchen am Brunnen.
Seeschlachten und maritime Motive von Willem van de Velde und Hendrick Cornelisz Vroom.
Blumen von Rachel Ruysch.
Van Gogh mit Selbstbildnisse, Landschaften, den berühmten Sonnenblumen und der Sternennacht.
Piet Mondrian mit seinen in Primärfarben gehaltenen graphischen Gitterbildern, die Yves Saint Laurent für seine Herbstkollektion 1965 inspirierten.
Zwischen den sich wiederholenden künstlerischen Darstellungen, wird in schwarz-weiß Projektionen gezeigt, wie hier früher Bauxit abgebaut wurde.
In einem der Räume des stillgelegten Steinbruchs, drehte Jean Cocteau (1889-1963) 1959 einen seiner Filme, „Le Testament d’Orphée“. In einem 22 Minuten dauernden schwarz-weiß Film, kommentiert Cocteau selber seinen Film, an seiner Seite Jean Marais, Charles Aznavour, Brigitte Bardot und viele andere.
Hier sieht man den Steinbruch ohne Projektionen, mit seinen glatten Kanten, die die herausgeschnittenen Quader noch deutlich zeigen.
Eine der Hallen, die durch den Abbau des Bauxits entstanden ist. Von außen haben wir sie bereits am Anfang gesehen. Hier befindet sich ein Café und Toiletten.
Im weichen Stein haben sich Touristen verewigt. -
Landkarte der Gegend um Les Baux-de-Provence.
Eingang zu einem Steinbruch „Carriere Sarragan Jean Deschamps“.
Blick in den Steinbruch.
Rundfahrt durch die Umgebung von Les Baux-de-Provence mit seinen bizarren Felsformationen.
Immer wieder Ausblicke auf die Ruinen des im 10. Jahrhundert entstandenen Schlosses von Les Baux, welches auf einem 20 m hohen Felsen liegt. Bis ins 15. Jahrhundert war es bewohnt und im 13. Jahrhundert Zentrum der höfischen Dichtkunst und Sammelpunkt der Troubadoure.
Direkt an den Schlossbereich anschließend der kleine historische Ort Les Baux-de-Provence mit nicht einmal 1000 Einwohnern.
Weiterfahrt durch die Landschaft mit seinen bizarren Felsformationen.
Aussichtspunkt mit Blick auf die umgebende Landschaft und noch einmal auf Schloss und Ort Les Baux-de-Provence.
Nest eines Prozessionsspinners.
Felsen, Felder und eine Herde mit frisch geschorenen Schafen.
Fast senkrecht stehende Schichten aus Felsen in der Nähe von Eygalières, Blick auf eine abgebrannte Bergkuppe.
Kräftige Farben im Fels. -
Mouriès: kleiner Ort ganz in der Nähe von Les Baux-de-Provence, an den südlichen Hängen der Alpilles gelegen. Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt, ist es heute berühmt für sein Olivenöl.
Im Ort gibt es auch eine Arena mit Platz für 3000 Zuschauer. Werbeplakat für das Stierrennen „Trophée des As“.
Église Saint-Jacques-le-Majeur: 1782 im Zentrum des Ortes eingeweiht und finanziert von den Bewohnern von Mouriès. Sie ersetzte eine zuvor eingestürzte frühere Pfarrkirche. Während des Erdbebens 1909 war die Kirche das am stärksten beschädigte Gebäude des Ortes. Der 23 m hohe Glockenturm verlor seinen oberen Teil. Die von einem Kreuz gekrönte Kugel, die den Turm schmückte, löste sich und landete, nachdem sie das Dach des Presbyteriums eingeschlagen hatte, auf dem Bett des Pfarrers, der sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in seinem Zimmer befand.
Direkt vor der Kirche ein Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege.
Inneres:
Langhaus mit Blick auf den Hochaltar.
Blick zurück auf den Eingang.
Seitenaltäre
Marienkapelle
Eingang zur Öffentlichen Bibliothek mit dekorativem Regal mit Büchern.
Raum in der Öffentlichen Bibliothek.
Gitter auf Metall an einer Haustür. Das Gitter zeigt einen Fisch, Schneckenhäuser, Knoblauch und einen Suppentopf.
Laden mit Körben, Taschen und Dekoration aus Naturmaterialien.
Weiterfahrt durch Landschaften mit Felsen und Feldern mit knorrigen Weinstöcken.
In der Nähe von Aureille die Ruine einer Burg.
- Aureille: Der Name des Ortes leitet sich von seiner Lage an der römischen Via Aurelia ab. Oberhalb des Ortes stehen die Ruinen eines Schlosses.
Altes Waschhaus (Lavoir).
Blick in die engen Gassen, umgeben von Häusern aus Natursteinen.
Blick auf die Ruine des Schlosses, oberhalb des Ortes.
Église Notre-Dame: Fassade der Kirche, mit einem Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges davor.
Detail des Turms
Eingang, Portal mit Rundbogen und floralen Motiven im Tympanon.
Inneres: Blick durch das Langhaus auf den Hochaltar.
Gewölbe der Apsis mit Glasfenstern.
Hochaltar aus weißem Marmor mit dem Motiv Lamm Gottes.
Blick durch das Langhaus zum Eingang.
Kanzel mit den Evangelisten als Flachrelief (Markus und Johannes).
Blick in ein Seitenschiff mit Nebenaltären.
Altar des heiligen Rochus.
Weitere Nebenaltäre.
Glasfenster mit der heiligen Therese. Thérèse von Lisieux war eine französische Karmeliterin, die 2015 heiliggesprochen wurde und auch als Kirchenlehrerin verehrt wird.
Statue der heiligen Therese.
Nebenaltar für Notre Dame de la Salette. 1846 erschien zwei Hirtenkindern auf einem dem Dorf naheliegenden Berg die Jungfrau Maria. Die von den Kindern als „schöne Dame“ bezeichnete Erscheinung soll geweint haben und gab den Kindern als Botschaft mit, am Sonntag nicht zu arbeiten und wenigstens morgens und abends zu beten. 1852 wurde der Bau einer Kirche in den französischen Altpen vom Bischof von Grenoble beauftragt. Heute ist sie ein Marienwallfahrtsort.
Marienaltar.
Blick vom Seitenschiff zur Apsis und dem Hochaltar.
Blick auf den Tour de l’Horloge, den Uhrenturm.
Direkt daneben ein Laden mit Lebensmitteln, dekoriert mit zahlreichen Körben.
Auto: Russischer Kleintransporter UAZ 1958
Mauer aus Natursteinen mit schmiedeeiserner Tür in einen Garten.
Blick in einen Gang zwischen Häusern mit einem Kanal für Wasser.
Rückfahrt durch Landschaft mit Felsen und Ruinen auf Bergen.
Blüte einer Schwertlilie.
Biene auf den Blüten des Edellorbeer.
Blüten der Mimose.
Schmetterling, Mauerfuchs auf Löwenzahn. - Cassis: Kleinstadt am Mittelmeer, östlich von Marseille, in einer Bucht der Calanque-Küste. Obwohl die Gegend durch die Winde des Mistral sehr trocken ist, wurde sie bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. besiedelt. Auch die Griechen und Römer haben hier bereits gesiedelt. Im Mittelalter lag der Ort weiter oben, wo sich heute die Ruinen einer Burg bzw. eines Schlosses befinden. Die Einwohner hatten sich wegen der Einfälle der Barbaren hierher geflüchtet. Der Ort gehörte zur Herrschaft Baux-de-Provence und nach dem Aussterben der Familie ging es an die Grafschaft Provence. Seit 1481 gehört es zu Frankreich. Die heutige Altstadt stammt aus dem 18. Jahrhundert und liegt um den hier erbauten Hafen. Cassis lebt heute überwiegend vom Tourismus.
Blick in die Straßen von Cassis. Bunte Dachschindeln, Gegenstände vor einem Laden.
Place de la République mit Brunnen.
Eine der Straßen Richtung Hafen mit Auslagen von Läden. Hier ein Ständer mit Schwämmen und Seife.
Blick in den Laden mit Naturprodukten, Schwämme, Seife, Geschenkartikel.
Enge Gasse mit Bars und Wäscheleine mit Kinderkleidung als Dekoration über der Gasse.
Laden mit Calisson, einem typischen Konfekt der Provence in der Form von Weberschiffchen.
An einem Gitter aus Metall blaue Fische als Dekoration.
Hafen: wendet man sich nach links, sieht man oben die Burg bzw. das Schloss liegen. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert und verfiel im 19. Jahrhundert. Heute ist es renoviert und zu Ferienwohnungen umgebaut worden. Das Gelände ist privat und kann nicht besichtigt werden.
Umrundet man das Hafenbecken in die andere Richtung sieht man viele Fischerboote oder auch ein Boot für Ausflüge zum Tauchen.
Laden mit Mode am Hafen.
Restaurant am Hafen mit Balkon aus Holz und Wandmalereien mit Fischen unter dem Dachüberstand.
Blick zurück zur anderen Seite den Hafens mit den malerischen Häusern und zahlreichen Restaurants.
Hinter dem Ort hohe Felsen.
Hinter dem Hügel mit dem Schloss bzw. der Burg sieht man die Felsen des Cap Canaille, welches die Bucht mit dem Strand jenseits des Ortes begrenzt.
Hafeneinfahrt mit Leuchtturm. Eine Segelschule fährt gerade heraus.
Auch hier noch interessante Bauten mit historischen Details, wie diesen Turm mit Zinnen.
Hinter der ersten Häuserreihe am Hafen verläuft eine kleine Gasse mit zahlreichen dekorativen Details, wie z. B. Dieses Gesicht an einer Wand, ein bemalter Briefkasten, ein Flachrelief mit den Arbeiten in einer Bäckerei oder Fische und Krebse.
Laden mit Geschenkartikeln, Kleidung, Taschen und im Inneren Muscheln und Schneckenhäusern.
Église Saint-Michel: Nachdem die Vorgängerkirche durch eine Überschwemmung stark beschädigt wurde, beschloss man die heutige Kirche an einem höher gelegenen Ort zu errichten. Grundsteinlegung 1859, 1875 dem Erzengel Michael geweiht. Der Glockenturm entstand ein Jahr später. Der Baustil ist neuromanisch. Die Kirche hat 3 Schiffe, die durch große Rundbögen abgeteilt sind. Länge 32 m, Breite 18 m, Höhe 14 m.
Inneres:
Blick durch das Langhaus Richtung Hochaltar.
Vor dem Hochaltar rechts eine Statue des Erzengels Michael, dem die Kirche geweiht ist.
Fresko in der Apsis aus dem Jahr 1943 von Jean Lair. Im Zentrum die Jungfrau Maria, umgeben von Bewohnern aus Cassis, sowie 2 Soldaten aus der Widerstandsbewegung gegen die Besetzung Frankreichs zu dieser Zeit. Auf der linken und rechten Seite je eine Szene aus dem Leben der Jeanne d’Arc. Links oben außerdem Jesus betend im Garten Gethsemane und rechts oben Jesus, der sein Kreuz trägt, begleitet von Menschen in der Kleidung des 20. Jahrhunderts.
Blick zum Eingang und der Orgel.
Nebenaltar.
Altes Haus aus Natursteinen.
Kleine Gasse und Brunnen mit Stockenten.
Fahrt zu den Klippen von Cassis, vorbei blühenden Judasbäumen, an Felswänden, hoch auf die Klippen mit Blick auf den Ort Cassis.
Schild mit Warnung, das man von den Felsen abstürzen könnte.
Ganz in der Ferne Richtung Osten ein Blick auf die Bucht an der La Ciotat und Saint-Cyr-sur-Mer liegt.
Blick auf den Hafen und die Werft von La Ciotat. Rechts die Île Verte.
Blühende Binsenlilie.
Landkarte der Umgebung von La Ciotat.
Fahrt auf der Corniche des Crêtes zu den Klippen von Cassis mit Blick auf die Bucht und den Ort Cassis bzw. dem Cap Canaille mit seiner 362 Meter hohen Steilküste, der höchsten von ganz Frankreich.
Ohne Geländer an den senkrecht abfallenden Klippen.
Blick auf die benachbarte Bucht mit Saint-Cyr-sur-Mer und La Ciotat.
Bizarre Felsformationen. - La Ciotat: Hafen- und Industriestadt mit fast 40.000 Einwohnern, 30 km östlich von Marseille. Enge Gasse auf dem Weg zum Hafen.
Hafen und Werft
Gebäude mit Turm, das Musée Ciotaden.
Direkt am Hafen die Église Notre-Dame bzw. Notre-Dame-de-l’Assomption.
Inneres: 3-schiffig. Blick auf den Hochaltar. Im Vordergrund das Taufbecken und eine Statue des gekreuzigten Jesus.
Hochaltar und Glasfenster im Chor.
Im nördlichen Seitenschiff der Kirche eine Abfolge großer moderner Gemälde mit einer „Biblischen Reise“. Links oben: Jesus vertreibt Räuber mit der Peitsche. In der Mitte oben: „Hier saß ich am Brunnen, und eine Frau die beim Ehebruch ertappt worden war, wurde zu mir gebracht. Laut Gesetz musste sie gesteinigt werden … Derjenige unter euch, der ohne Sünde ist, sei der Erste, der einen Stein auf sie wirft. Als ich ein paar Augenblicke später aufsah, waren sie alle leise davongeschlichen.“
Erklärungen zum 1. Bild.
Detail der Geburt Jesu zwischen Ochse und Esel
Das 2. Bild: links oben das letzte Abendmahl. In der Mitte Jesus vor Pontius Pilatus.
Erklärung zum 2. und 3. Bild.
Das 3. Bild.
Nebenaltar mit einer Heiligen oder Maria.
Blick zum Eingang und der Orgel.
Blick vom Hauptschiff auf die Gemälde im Seitenschiff und die Glasfenster darüber.
Blick auf den Turm und das dem Hafen abgewandte Seitenschiff der Kirche von außen.
Platz Sadi Carnot hinter der Kirche mit Brunnen. Im Hintergrund der Turm der Kirche.
Schaufenster mit alten Werbeplakaten für La Ciotat.
Fassade eines Hauses mit den typischen Balkongittern aus Metall.
Mit einem Boot bemalter Rollladen eines Fischgeschäftes.
Mit einem Alpaka bemalter Rollladen eines Cafés.
Rückfahrt nach Eguilles durch Landschaft mit Bergen. - Marseille: älteste und nach Paris zweitgrößte Stadt Frankreichs. Bedeutendster Hafen, östlich des Mündungsdeltas der Rhone gelegen. Universitätsstadt und Bischofssitz. Um 600 v. Chr. unter dem Namen „Massallia“ von Griechen gegründet. Bis weit in die römische Zeit war sie ein Zentrum der hellenistischen Kultur. Im 1. Jahrhundert n. Chr. war die Stadt römisch und dehnte sich in die trocken gelegten Sümpfe östlich der Stadt aus. Nach dem Untergang des römischen Reichs herrschten hier die Westgoten, dann die Franken und dann das Königreich Arelate (Burgund). Nach der Zerstörung durch die Sarazenen, wurde sie im 10. Jahrhundert wieder aufgebaut. Seit 1481 gehört es zum Königreich Frankreich. Die Bedeutung des Hafens wuchs mit den Kreuzzügen enorm. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt nach dem Vorbild von Paris weiter ausgebaut.
Mietshaus mit Balkonen mit Wäsche darauf.
Hochhaus mit Fassade aus Glas.
Blick von der Straße auf den Hafen mit Autofähren. Im Hintergrund in der Mitte die Gefängnisinsel Château d’If.
Ein Gebäude mit Buchstaben an der Fassade. Es gehört zu Les Docks Village.
Direkt neben der Straße die alten Speicher.
Autofähre nach Algereien mit Fußball spielenden Kindern davor.
Autofähre nach Algerien.
Wandmalerei an der Seitenwand eines Mietshauses mit Motiven aus der langen Geschichte des Hafens von Marseille.
Cathédrale de la Major: sie liegt auf einer Terrasse im Nordwesten der Altstadt, über den neuen Hafenanlagen. Bischofskirche der katholischen Erzdiözese Marseille. 1852-1896 erbaut im neuromanisch-byzantinischen Stil. Entwurf: Léon Vaudoyer (1803-1872) und Henri-Jacques Espérandieu (1829-1874). An dieser Stelle stand bereits an der Wende von 4. zum 5 Jahrhundert eine – für frühchristliche Kirchen typische, nach Osten ausgerichtete Kirche (also die Fassade nach Osten!) mit Baptisterium. Die Fundamente wurde beim Bau der neuen Kirche aufgefunden. Bei den Sarazeneneinfällen (923) wurde sie zerstört und bereits 1073 der Neubau einer romanischen Kathedrale begonnen. In der französischen Revolution wurde das Bistum Marseille aufgehoben, die Kirche verfiel. 1852 besuchte Napoleon III. (1808-1873) die Stadt. Veranlasst durch den, 1995 heilig gesprochenen, Bischof Charles Joseph Eugène de Mazenod (1782-1861) legte er symbolisch den Grundstein des Neubaus. In der Krypta der Kirche sind die Gräber der Bischöfe von Marseille. Unter der großen Terrasse liegt ein Parkhaus.
Grundriss der Kirche
Informationstafel zur Lage der Kirche am Hafen mit historischen Fotos.
141 m lang und damit der größte Kirchenbau des 19. Jahrhunderts (Kölner Dom nur 135,6 m lang), Vierungskuppel 60 m hoch.
Detail einer kleineren Kuppel.
Wasserspeier
Die Westfassade, liegt unüblicherweise im Süden. Sie hat einen hohen Zentralbogen mit 2 Glockentürmen und reichem Skulpturenschmuck. Prägend ist der Wechsel von weißem und grünen Kalkstein.
Rechts neben der Fassade sieht man die Reste der Kathedrale Saint-Lazare oder Vieille Major, die alte Kathedrale, aus dem 4. – 12 Jahrhundert.
Die hier nach Süden ausgerichtete Fassade, die normalerweise im Westen liegt. Ein hoher zentraler Bogen wird begrenzt von zwei Glockentürmen mit Kuppeln. Über dem Bogen reicher Skulpturenschmuck mit Jesus in der Mitte.
Details des Eingangs. Über dem Eingang Mosaiken und drei kleinere Rundbögen.
Über dem Eingang im Rundbogen ein Mosaik. Jeweils am Ende 3 Nischen mit Rundbögen mit Statuen
Im Tympanon die Krönung Marias.
Ein anderes Tympanon mit Greifen.
Inneres:
Blick durch das Langhaus mit seinen beiden Seitenschiffen. Die Wirkung ist durch die farblich abgesetzten Steinlagen mit den Kuppeln und Bögen wieder byzantinisch. In die 3 Jochbögen sind Emporen eingearbeitet.
Blick auf eine der Emporen, die von 2 Säulen getragen wird.
Blick auf Fanfaren der Orgel auf einer Empore.
Kurz vor der Vierung, ein Kruzifix und unter einer der Emporen eine kleine Orgel.
Blick Richtung Chor und Vierung. Im Chor der neuromanische Überbau über dem ursprünglichen Hochaltar. Davor steht der heutige Hochaltar mit einer massiven Marmorplatte, getragen von goldenen, mit Flügeln versehenen, Symbolen der vier Evangelisten.
Blick zurück zum Eingang.
In der Vierung eine Pieta.
Heutiger Hochaltar in der Vierung.
Blick in die Kuppel der Vierung.
Blick in das links vom Altar liegende Querschiff, also das westliche Querschiff, da die Fassade unüblicherweise im Süden liegt.
Goldene Statue von Maria und zwei Engel.
Blick in das rechts vom Altar liegende Querschiff, also das östliche Querschiff, da die Fassade unüblicherweise im Süden liegt.
Statue des heiligen Josef mit dem Jesuskind.
Eine der Kapellen, die vom Querschiff ausgeht.
Die andere, vom Querschiff ausgehende Kapelle des heiligen Lazarus, dem die alte, wie die neue Kathedrale geweiht ist. Detail des Altars aus Marmor mit bunten Mosaiken.
Reliquienschrein des heiligen Lazarus von Bethanien, der von Jesus, gemäß dem Johannesevangelium, von den Toten auferweckt wurde.
Informationstafel.
Überbau über dem ursprünglichen Hochaltar.
Restaurierungsarbeiten am Übergang zum Chor.
Chorumgang
Neugotischer Beichtstuhl im Chorumgang.
Kapelle im Chor mit Statue von Jeanne d’Arc und Gedenktafel für Léon Vaudoyer, einem der Architekten der Kathedrale von Marseille.
Kapelle der Maria mit goldenen Mosaiken im Gewölbe.
Kapelle im Chor.
Modell der Kirche aus Holz.
Taufkapelle.
Denkmal für die Toten des 1. Weltkrieges aus Großbritannien, mit zahlreichen Wappen.
2 Stationen vom Kreuzweg an den Wänden der Kirche.
Informationstafel zu den Fußbodenmosaiken in der Kirche.
Details einiger Fußbodenmosaiken.
Ruine der alten Kathedrale Saint-Lazare oder Vieille Major, aus dem 4. – 12. Jahrhundert.
Denkmal für Henri François-Xavier de Belsunce-Castelmoron neben der Kathedrale. Er war Bischof von Marseille, Pair von Frankreich und Berater von König Ludwig XIV.
Das Denkmal von der Seite.
Zwei Museen stehen auf dem riesigen überbauten Parkhaus beim Hafen bzw. unterhalb der Cathédrale de la Major. Hier das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers oder Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée oder MuCEM.
Villa Méditerranée bzw. Cosquer Méditerranée: seit dem Sommer 2022 hat dieses Museum geöffnet. Baubeginn 2010, Architekt Stefano Boeri (1956-). Eingeweiht 2013, sollte es ursprünglich die Parlamentariswche Versammlung des Mittelmeers beherbergen.
Sie zeigt unter anderem einen 90%igen Nachbau der Cosquer-Höhle.
1985 wurde sie von Henri Cosquer in den Calanques von Marseille entdeckt. Der Eingang liegt 37 m unterhalb des Meeresspiegels. Die Malereien und Steinritzungen aus prähistorischer Zeit wurden allerdings erst 1991 entdeckt. Eine Art Lascaux unter dem Meer war völlig unerwartet und führte anfangs zur Diskussion über die Echtheit der prähistorischen Malereien. Durch die globale Erwärmung steigt der Wasserspiegel in der Höhle wieder und wird die originalen Kunstwerke langfristig wohl zerstören. Als Teile der Malereien entstanden, war es die Zeit des Gletschermaximus und der Meerespiegel lag 130 m tiefer, die Höhle war damals also trocken. Um die einmaligen Kunstwerke für Besucher erlebbar zu machen, wurde nach dem Vorbild von Lascaux 2, in den Jahren 2019-20121 mittels einer Digitalisierungskampagne die Höhle nachgebaut.
2 Zeiträume der Entstehung lassen sich datieren: 32.500 bis 26.500 v. Chr. und dann 25.000 bis 19.000 v. Chr.
In der Nachbildung der Höhle darf man nicht fotografieren, daher einige Fotos aus der Präsentation: Die Fundstelle in den Calanques.
Handabdrücke
Animation mit den in der Höhle dargestellten Tieren, unter anderem auch Pinguine.
Im Museum stehen die ausgestopften Tiere, die in der Höhle dargestellt sind. Auf den Informationstafeln als „Zitate“ die Darstellungsweise in der Höhle. Hier ein Bison.
Riesenhirsch oder Megaloceros
Auerochse
Blick aus dem Museum auf die Cathédrale de la Major.
Rothirsch
Steinbock
Wildpferd
Höhlenlöwe.
Saiga oder Saigaantilope
Gämse
Statue einer Frau der damaligen Zeit.
Kopfschmuck einer Frau aus der Zeit 24.000 v. Chr. mit kleinen Muscheln.
Kleines Boot mit Paddeln
Tritonschnecke (Charonia lampas) als Musikinstrument, 18.000 v. Chr.
Blick durch die zum Teil durchsichtigen Böden des Museums auf die Wasseroberfläche des Mittelmeers.
Kopf eines Pferdes mit Kohle gezeichnet. Die Gravur auf der Mähne wurde nach der Zeichnung angefertigt.
Blick vom Museum auf den Hafen.
Blick durch den zum Teil durchsichtigen Boden des Museums, auf einen Laufsteg über die Wasseroberfläche des Mittelmeers.
Blick durch das Fenster auf Marseille und die auf dem Berg liegende Kirche Notre-Dame-de-la-Garde.
Unter dem Museum ein Boot und der Laufsteg über der Wasseroberfläche. Im Hintergrund das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers oder Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée oder MuCEM. Auf der Dachterrasse des Museums der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers oder Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Es wurde 2013 anlässlich der Ernennung Marseilles als Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2013 eröffnet. Architekt ist der in Algerien geborene Franzose Rudy Ricciotti (1952-). Der Museumsbau ist ein verglaster Kubus. An zwei zum Hafen ausgerichteten Seiten, ist es mit einer netzartigen Betonkonstruktion versehen. Hier befindet sich ein Café.
Blick auf das 1660 unter Ludwig XIV. erbaute Fort Saint-Jean. Es erhielt seinen Namen durch den Umstand, dass hier vorher der militärische Zweig des Johanniterordens einen Sitz hatte.
Blick auf das Palais du Pharo. Ab 1858 ließ Napoleon III. (1808-1873) diesen Palast hier für seine Frau Eugénie de Montijo (1826-1920) erbauen. Napoleon III. beauftrage den Genfer Architekten Samuel Vaucher einen geeigneten Ort für diese Residenz zu suchen. Seine Pläne wurden dann vom Architekten Hector Lefuel überarbeitet. Baubeginn war 1858. Beim Sturz von Napoleon III. 1870 war der Palast nach zwölf Jahren Bauzeit immer noch nicht fertig, so daß das Kaiserpaar nie dort residiert hat. Nachdem das Gebäude bis Ende des 19. Jahrhunderts als Krankenhaus diente, wurde dort 1905 das Institut für Tropenmedizin im Dienste der Gesundheit der Armee eingerichtet. Seit 2012 ist es Sitz der Universität Aix-Marseille und enthält heute auch ein Kongresszentrum.
Von der Dachterrasse des Museums der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers führt ein Fußgängersteg über das Hafenbecken zum 1660 unter Ludwig XIV. erbauten Fort Saint-Jean. Es erhielt seinen Namen durch den Umstand, dass hier vorher der militärische Zweig des Johanniterordens einen Sitz hatte. Von hier aus hat man einen phantastischen Rundblick. Hier Blick zurück auf die beiden Museen und die dahinter liegende Cathédrale de la Major.
Blick auf das Mittelmeer mit dem Quai Jean Charcot, der den neuen Hafen begrenzt, außerdem eine Ecke des Kubus vom Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers.
Direkt gegenüber ein kleiner Hafen für private Boote.
Dreht man sich weiter nach links, Richtung Stadt sieht man das Fort Saint-Nicolas. Es wurde 1660-1664 im Auftrag Ludwig XIV. von Chevalier de Clerville erbaut. Diese Zitadelle der Stadt Marseille ist 51.260 qm groß und bisher nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Spätestens ab 2026 sollen hier Ausstellungen, Kultur- und Freizeitveranstaltungen und Schulungen stattfinden. Ab Mai 2024 soll der Park kostenfrei zugänglich sein.
Im Hintergrund die auf dem Berg liegende Kirche Notre-Dame-de-la-Garde, das Wahrzeichen der Stadt Marseille.
Basilique Saint-Victoire: die östlich von Fort Saint-Nicolas stehende festungsähnliche Kirche, gehörte zu einer im 5. Jahrhundert von Johannes Cassianus (ca. 360-435) gegründeten Abtei. Die zinnenbekrönten Türme stammen aus dem 11. und 14. Jahrhundert.
Silbermöwen
Blick auf die Kapelle Saint-Jean, die innerhalb des Forts liegt. Der quadratische Turm daneben ist der Tour du Roi René aus dem 15. Jahrhundert.
Durch die an einer Seite offene Galerie des Officiers, kommt man weiter in das Innere des Forts.
Blick zurück auf die „Bâtiment moderne du DRASSM“, in dem sich heute ein Museum befindet. Dahinter oben, liegt die Galerie des Officiers.
Neben dem Fort Saint-Jean liegt die Église Saint-Laurent.: 1150 aus rosa Stein aus La Couronne im romanischen Stil errichtet. Die Kirche ist dem heiligen Laurentius von Rom geweiht. Ursprünglich befand sich hier ein griechischer Tempel. Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche umgestaltet und der achteckige Turm errichtet.
Blick auf den alten Hafen, den „Vieux-Port“: er zählt zu den ältesten Hafenanlagen Europas, da er bereits in der Antike entstand. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, war es das wirtschaftliche Zentrum für den Seehandel im Mittelmeer und mit den französischen Kolonien. Heute ist es ein Yachthafen. Täglich findet hier noch ein Fischmarkt statt. Im Vordergrund links der „Consigne sanitaire“, ein Gebäude zur Gesundheitskontrolle im Hafen. Es wurde 1719 nach Plänen von Antoine Mazin, einem Militäringenieur, geschaffen. In den Gebäuden sind heute Verwaltungsdienste untergebracht.
Im Hintergrund die Fassade der Église Saint-Ferréol les Augustins. Der Kirchenbau stammt im Wesentlichen aus dem 16. Jahrhundert, wurde aber im 19. Jahrhundert erheblich umgestaltet.
Auf den alten Ruinen des Fort Saint-Jean, wurde ein Garten angelegt.
Türkentaube
Von hier aus bieten sich phantastische Ausblicke auf die Cathédrale de la Major und die modernen Museumsbauten.
Historisches Gebäude des Hotel Intercontinental in Marseille. Davor ein Denkmal mit dem Bildnis des Malers und Bildhauers Honoré Daumier.
Grand Rue, eine der elegantesten Straßen in Marseille. Seit der Gründung Marseilles durch die Griechen, befand sich an dieser Stelle eine Straße und bildet die Ost-West-Achse der Stadt. Große historische Wohnhäuser mit repräsentativen Fassaden, säumen die Straße.
Notre-Dame-de-la-Garde: Wahrzeichen der Stadt. Die Kirche liegt auf einem 154 m hohen Kalkfelsen im Süden von Marseille, der „La Garde“ heißt und der Kirche den Beinamen gab. Seit antiker Zeit befanden sich hier Beobachtungsposten. 1214 ließ der Marseiller Priester Pierre hier eine Marienkapelle errichten, die allerdings auch nach einer Erweiterung nur 60 Personen aufnehmen konnte. König Franz I. (1494-1547) ließ den La-Garde-Hügel zu einer Befestigungsanlage ausbauen, zeitgleich mit dem Bau der Inselfestung Château d’If. Die kleine Kirche blieb über eine Brücke für Pilger zugänglich. Seit etwa 1600 war es die Bitt- und Dankeskirche der Seefahrer. Erst 1851 wurde der Antrag beim Kriegsministerium gestellt, innerhalb der Festungsanlage eine größere Kirche mit einem hohen Turm errichten zu dürfen. Der erst 23-jährige Architekt Henri-Jacques Espérandieu (1829-1874) erhielt den Auftrag und entwarf eine Kirche im neuromanisch-byzantinischen Stil mit 65 m hohem Glockenturm. Die Mauern sind aus hellem und dunklem Naturstein im Wechsel erbaut, was wesentlich zu dem orientalisch wirkenden Charakter der Kirche beiträgt.
Wegen Geldmangels musste der Bau mehrfach unterbrochen werden. Bauzeit 1853-1864. Der Glockenturm wurde erst 1866 fertiggestellt. Oben eine Laterne, auf der eine vergoldete Marienfigur steht. Anders als bei christlichen Kirchen üblich, ist die Kirche nach Südosten ausgerichtet. Im Nordwesten befindet sich eine Treppenanlage, die in die Stadt führt. Hier ist auch das Hauptportal und der quadratische Glockenturm. Außenmaße: 52,5 m lang, 16,8 m breit.
Wenn man die Kirche umrundet, sieht man eine oktogonale Hauptkuppel auf einer nur angedeuteten Vierung.
Über einem der Eingänge ein Mosaik mit Maria und „Je vous salue Marie“ – ich grüße Dich Maria
Inneres:
Auf rechteckigem Grundriss sieht man eine Wandpfeilerkirche, deren Hauptschiff aus 3 Jochen besteht. Statt Seitenschiffen wird das Hauptschiff von Kapellen flankiert.
Blick in das mit Kuppeln überwölbte Hauptschiff, hinten die Apsis und kurz davor die Vierungskuppel. Auf Goldgrund sieht man reiche ornamentale und figürliche Darstellungen als Mosaik. Sie orientieren sich an Vorbildern in Rom und Ravenna.
Blick in die Kuppeln über dem Hauptschiff.
Blick vom Hauptschiff in die Seitenkapellen, die jeweils Fenster haben. Über den Rundbögen der Kapellen sind weitere Fenster unterhalb des Daches angebracht.
Blick in die Apsis mit dem Hochaltar und einer Marienstatue. Im Mosaik in der Apsis „Ave gratia plena“, ein Medaillon mit Segelschiff und zahlreiche Vögel zwischen Blumenranken.
Blick in die Kuppel über der scheinbaren Vierung. Im Mosaik halten Engel einen Kranz aus Blüten.
In den Gewölbezwickeln die Evangelistensymbole, hier der Engel für Matthäus und der Adler für Johannes.
Blick zurück Richtung Eingang.
Von den Decken hängen zahlreiche Modelle verschiedener Schiffe.
Blick in einige Kapellen. Sie sind übersät mit zahlreichen Votivgaben, die von Gebetserhörungen zeugen.
Rundbogen mit Mosaik über einer Kapelle.
Kapelle mit Altar und einer Statue von Petrus. Über dem Altar steht „Altare privilegiatum“. Die meisten Stauten in der Kirche wurden von Joseph Marius Ramus (1805-1888) geschaffen. Der Altar und sein Aufbau sind zum Teil mit kostbaren Halbedelsteinen verziert.
Weitere Kapelle. Über dem Altar ein neugotisches Reliquar.
Votivgaben in Form von einem Herz.
Eine Kapelle mit zahlreichen Orden aus verschiedenen Kriegen.
Am Ausgang eine Bitte um Spenden in zahlreichen Sprachen und Schriften.
Mit Flachreliefs dekorierter Türflügel aus Metall.
Ausblick von der Terrasse vor der Kirche, dem La-Garde-Hügel.
Blick über Marseille. Schwenk nach links Richtung Meer. Der Vieux-Port in der Mitte. Am Übergang zum Meer die verschiedenen Forts. Im Hintergrund die Kirche Notre-Dame-de-la-Garde und eine große Fähre. Ganz hinten der moderne Hafen. Links auf der Klippe das Palais du Pharo.
Weiter links die der Stadt vorgelagerten Inseln. Die kleinste Insel das berühmte Gefängnis Chateau d’If.
Blick über einen bebauten Hügel in die in die nächste Bucht mit dem Plateau de l’Homme Mort.
Blick auf die Hochhäuser beim Parc Roy d’Espagne. Dahinter das Plateau de l’Homme Mort.
Schwenk über die Stadt Richtung Landesinnere. In der Mitte rechts das Stade Vélodrome, seit 2016 Orange Vélodrome. Es ist die Heimat des Fußballclubs Olympique Marseille. Außerdem spielt hier die französische Rugbynationalmannschaft.
Kirche Saint-Vincent de Paul oder Église des Réformés. Der Name Église des Réformés geht auf die reformierten Augustiner zurück, die hier zuvor eine Kapelle besaßen.
Riesige Halle des Hauptbahnhofs Saint-Charles, der ein Kopfbahnhof ist. Sein erstes Empfangsgebäude wurde 1848 eröffnet.
La Palais Longchamp, 1862–1869 errichtetes Bauwerk im Stil des Historismus.
Votivtafeln an der Außenmauer.
Die Informationstafeln auf der Aussichtsterrasse.
Einschusslöcher aus dem 2. Weltkrieg (1944) in der Mauer.
Hochhaus mit Balkonen, die verschiebbaren Sonnenschutz aus Holz haben.
Zentrale von Haribo in Marseille
Riesige Hochhäuser in den Vorstädten von Marseille.
Graffiti an einer Brücke
Supermarkt in Frankreich: Fleischtheke, Bereich mit Gemüse und Obst, Käsetheke, Kassenbereich.
- Gardanne: Industriestadt mit etwas über 20.000 Einwohnern in der Nähe von Aix-en-Provence. Seit Ende des 17. Jahrhunderts wurde hier Kohle im Tagebau abgebaut und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde hier ein Aluminiumwerk eröffnet.
Industrieanlage.
Markt in Gardanne mit typisch provencalischen Produkten. Marktstände mit Körben, Kleidung, Wurst, Käse, Obst, Gemüse, Spielzeug, Geschenkartikeln.
Große Pfanne mit Paella.
Teppiche und Kissen, zum Teil mit Frida Kahlo als Motiv.
Marktstand mit Fisch auf Eis.
Marktstand mit Büchern.
Distelfalter (Schmetterling) an einem Marktstand mit Kleidung.
Marktstand mit Honig.
Spanferkel.
Marktstände und eine Frau, die Luftballons verkauft.
Inneres der Gemeindekirche von Gardanne oder Paroisse de Gardanne. Die Kirche trat an die Stelle eines galloromanischen Gebäudes, sie war ursprünglich die Kapelle des Schlosses.
Rathaus von Gardanne. - Eguilles: kleiner Ort in der Nähe von Aix-en-Provence.
Blick auf das ehemalige Schloss, welches heute Rathaus ist.
Rosafarben blühender Baum. - Rognes: kleiner Ort 19 in der Nähe von Aix-en-Provence. Kleine Kapelle Saint-Denis aus dem Jahr 1720. Sie wurde erbaut, nach dem die Pestepedemie abgewendet wurde, die damals in Marseille wütete.
Fassade der Kapelle mit Priestern und Besuchern des Gottesdienstes am Ostermontag.
Das schlichte Innere der Kapelle.
Kreuz aus Stein vor der Kapelle.
Historischer Pferdekarren und Kinder in provencalischer Tracht vor der Kapelle.
Radkappen als Dekoration an der Straße.
Alte Brücke -
Bassin de Saint-Christophe: 1882 erbaut nach Plänen des Architekten Montrichet. Es ist eines der Hauptbauwerke, die zur Klärung des Wassers des Marseille-Kanals beitragen. Da Becken ist 20 Hektar groß.
- Cadenet: kleiner Ort in der Nähe von Aix-en-Provence, an den Hängen des Luberon oberhalb des Tals der Durance.
Église Saint-Etienne: die Kirche stammt aus dem 12. und 16. Jahrhundert, mit einem neugotischen, quadratischen Glockenturm von 1844. Er ersetzt einen romanischen Glockenturm, der verfallen war.
Wasserspeicher. Ursprünglich muss es 7 Wasserspeier gegeben haben, die die 7 Todsünden repräsentiert haben.
Inneres: Blick durch das Hauptschiff Richtung Hochalter und Apsis. Sie wurde 1537 erbaut.
Blick vorbei an der Kanzel auf das Seitenschiff mit Nebenaltar und der Staute des Heiligen Josef. Der Schlussstein im blau ausgemalten Gewölbe zeigt ein Wappen.
Rosenkranzkapelle.
Blick vom Hauptschiff in ein Seitenschiff mit Gemälden des provencalischen Malers Mignard.
Blick zum Eingang mit der Orgelempore.
Die Orgel wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Victor Fenon, einem italienischen Orgelbauer und Schüler von Mentasti, erbaut.
Altenheim in einem historischen Gebäude.
Marktplatz mit dem immer am Montag stattfindenden Markt.
Marktstände mit französischem Nougat, Kleidung, Decken, Produkte aus Olivenholz.
Auf dem Platz die Statue des Tambour d´Arcole von 1894, als Erinnerung an den lokalen Helden André Estienne (1777-1838). Dieser war Trommler in der napoleonischen Armee, während der Schlacht von Pont d’Arcole in Italien.
Häuser am Marktplatz.
Bild aus Fliesen vor der Post, mit der Darstellung einer Briefmarke mit der französischen Nationalfigur Marianne.
Blühende Rapsfelder und Kirschbäume.
Alte Häuser und Bäume.
Wolfsmilchgewächs. - Vaugines, Église Saint-Barthélémy: Im frühen 11. Jahrhundert befand sich hier das Benediktinerklosters Saint-Sauveur, welches wahrscheinlich im 12. Jahrhundert aufgegeben wurde. Die Gemeinde von Vaugines erbaute in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, auf den Resten der alten Kapelle die Kirche Saint-Pierre. Sie besteht aus einem gewölbten Kirchenschiff mit 3 Jochen. Das Gewölbe ruht auf großen Bögen. Als von 1350-1450 die Pest, Kriege und Hungersnöte die Bevölkerung um die Hälfte dezimierten, wurde der Ort Vaugines mit seiner Kirche aufgegeben. Erst ab 1470 wird der Ort und die Kirche wieder hergestellt. Sie heißt nun Saint-Barthélémy. Ab 1630 werden nach und nach 5 Seitenkapellen angebaut.
Westfassade aus dem 13. Jahrhundert.
Auf der Nordseite befinden sich Reste eines Friedhofs.
Blick auf die Nordostecke der Kirche mit Glockenturm und Treppe, die zum Turm führt. Der Unterbau des Turmes birgt die Apsis aus dem 11. Jahrhundert.
Von der Südseite der Kirche hat man, vorbei an alten Platanen, einen Blick auf den Ortseingang von Vaugines.
Westfassade.
Inneres:
Informationen und Grundriss der Kirche.
Blick in das Hauptschiff Richtung Apsis aus dem 11. Jahrhundert. Die Apsis hat ein Halbkuppelgewölbe und stammt noch von der ehemaligen Klosterkirche.
Links neben der Apsis eine kleine bemalte Nische mit einem Tabernakel aus Holz.
Blick in eine Art Querhaus oder auch die 3. Kapelle im Süden. Laut Grundriss stammt sie aus dem 12. Jahrhundert. Es könnte sich auch um einen Konventssaal des ehemaligen Klosters handeln, welches erst später direkt in die Kirche mit einbezogen wurden. Ganz hinten eine Statue aus Holz von Maria mit dem Jesuskind aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.
Bild über einem Altar in der 1. Kapelle auf der Südseite, aus dem 17. Jahrhundert. Es ist das älteste Ausstattungsstück in der Kirche. Es zeigt Sankt Sebastian in der Mitte, Sankt Rochus rechts und Sankt Joseph mit dem Jesuskind auf dem Arm.
In der 2. Kapelle auf der Südseite ein Kopfreliquiar aus Holz aus dem 17. Jahrhundert und ein Gemälde von Jean-Antoine Coucelles von 1704 mit der heiligen Familie.
Seitenkapelle mit Taufbecken.
Seitenkapelle mit Statue von Maria.
Kreuzrippengewölbe.
Die Kirche von der Südseite mit einer blühenden Wiese und blühenden Bäumen.
Ortseingang von Vaugines. - Cucuron: kleiner Ort am Südhang des Luberon, der bereits in gallo-römischer Zeit besiedelt war. Um einen befestigten Hügel hat sich im 11. Jahrhundert ein mittelalterlicher Stadtkern gebildet, der von der Familie Reillanne-Valence aufgebaut wurde. Dank der günstigen Lage an Handelswegen und der Salzstraße, wuchs der Ort relativ rasch. So musste ein weiterer Mauerring errichtet werden. Während der Pestepedemier 1720 verringerte sich die Bevölkerung um ein Drittel und auch die Landflucht während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert führte zum wirtschaftlichen Niedergang des Ortes. Während des 1. Weltkrieges konnte man sich wirtschaftlich mit dem Anbau von Gemüse und Wein wieder etwas erholen.
Stadtplan: links der Löschwasserteich, das Teichtor ist „B“ direkt daneben. Die Kirche oben Nr. 3. Der Glockenturm oder Belfried liegt an der inneren Festungsmauer „C“.
Teichtor oder Portail de l’Etang: früher auch bekannt als Portail de Cabrières, ist eines von 2 erhaltenen Stadttoren der Befestigungsanlagen von 1545-1548. Ursprünglich gab es hier 4 Tore und 6 Türme. Das Bauwerk bestand aus einer Mauer von 600 Metern Länge, 9 Metern Höhe und 1 Meter Breite, auf der oben ein Gehweg entlang führte. Früher befand sich ein trockener Graben um die Mauer herum, welcher mittels einer Zugbrücke überwunden werden konnte.
Blick in eine der engen Straßen.
Löschwasserteich, umgeben von Platanen und Restaurants. Er wurde außerhalb der Stadtmauer Anfang des 16. Jahrhunderts für die Versorgung von drei Getreidemühlen angelegt.
Tauben am Wasser.
In den ringförmig angelegten kleinen Straßen und Wegen, haben sich zahlreiche historische und authentisch provencalische Häuser erhalten, die auch für Filmemacher gerne als Drehort verwendet werden.
Kleiner Brunnen.
Bei manchen Häusern hängen historische Fotografien.
Häuser aus Natursteinen säumen die aufsteigende Straße zu den weiter oben liegenden Resten der Stadtmauer und einem Turm. Erbaut 1542 während der Religionskriege. Cucuron war eine katholische Enklave, umgeben von protestantischen Dörfern.
Violett blühende Blume, evt. Orchidee.
Blick von oben auf die Dächer des Ortes.
Auf einem gegenüber liegenden Hügel die einzigen Überbleibsel der mittelalterlichen Burg.
Blick auf den Belfried, einen Glockenturm der 1540 auf einem Tor der Stadtmauer errichtet wurde. Er wird von einer Laterne und einem Kreuz gekrönt und symbolisiert die frühe Selbstständigkeit der Stadt.
Kleiner verwilderter Garten.
Eingang zu einem Haus mit einer Milchkanne davor.
Schmale Wege führen entlang des Hügels, vorbei an alten Häusern mit farbigen Fensterläden.
Weiße Blumen.
Blick von oben auf einen kleinen Platz mit dem alten Waschhaus (Lavoir) des Ortes.
Blick auf den Glockenturm der Kirche.
Kirche Notre-Dame-de-Beaulieu: erbaut im 13. Jahrhundert, mit einem 24 m hohen Glockenturm aus dem 16. Jahrhundert. Sie war der Ersatz für die nicht mehr existierende Kirche Saint-Michel. Im 14. Jahrhundert wurde das Langhaus um ein Joch mit 2 Kapellen verlängert. Der fünfeckige Chor und ein Westportal stammt auch aus dieser Zeit. Die Seitenkapellen der ersten 3 Joche, wurden von Bruderschaften im gotischen Stil des 17. Jahrhunderts eingerichtet.
Langhaus mit Blick auf die Apsis mit dem Hochaltar.
Links die Kanzel mit Intarsien aus Marmor.
Der Hochaltar wurde aus Marmor gefertigt und von der Herzogin von Modena eigentlich für die Heimsuchungs-Kapelle in Aix-en-Provence in Auftrag gegeben und dort 1661 aufgestellt. Ende des 18. Jahrhunderts erwarb die Gemeinde von Cucuron diesen Altar. Die Gemälde zeigen als Thema in der Mitte die Beschneidung, dann die Unbefleckte Empfängnis und die Lehre der Heiligen Martha. Darüber ein Flachrelief mit der Himmelfahrt Marias, welches Pierre Puget (1620-1694) zugeschrieben wird.
Kapelle Sainte-Tulle: Tullia war die Tochter des Heiligen Eucherius, der im 6. Jahrhundert hoch über dem Fluss Durance in einer Einsiedelei lebte. Seine Tochter lebte ebenfalls abgeschieden in einer Höhle beim Dorf Tetea. Der Altar stammt aus dem 18. Jahrhundert. Über der Statue der Heiligen ein Baldachin, der von 2 Engeln zur Seite geschoben wird.
In dieser Kapelle haben sich auch einige Wandmalereien erhalten.
Stark beschädigte Seitenkapelle mit einem Altar mit Maria und dem Jesuskind.
Weitere Seitenkapelle.
Taufkapelle mit einem mit Engelsköpfen verzierten Taufbecken.
Weitere, an den Wänden bunt bemalte Seitenkapelle.
Detail eines mit Papstkronen bemalten Bogens.
Orgel auf der Orgelempore. Pierre Duges erbaute die Orgel 1787, unter Verwendung von Elementen einer älteren Orgel von Pierre Marchand aus dem Jahre 1614.
Häuser und Aufgang zu den höher gelegenen ringförmigen kleinen Straßen.
Hôtel de Bouliers: errichtet in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts und heute das Museum Marc-Deydier.
Geht man die Straße von der Kirche weiter kommt man wieder zu dem kleinen Platz mit dem alten Waschhaus (Lavoir) des Ortes.
Katze
Bunte Häuser mit Balkonen.
Kleiner Hund auf einem Balkon.
Weitere enge Straßen, ein kleiner Platz mit Restaurants.
Blick durch eine enge Straße auf den Belfried.
Haus der Konsuln mit einer Statue von Maria mit dem Kind an der Hausecke.
Kleiner Platz vor dem Uhrenturm, dem Belfried. Brunnen mit Obelisk auf dem Platz.
Historisches Foto vom gleichen Platz.
Uhrenturm, Belfried am inneren Festungsring.
Rathaus, Balkone mit Gittern aus Metall und Gittern vor den Fenstern im Erdgeschoss.
Häuser aus Natursteinen
Felder mit abgeerntetem Lavendel.
Knorrige Weinstöcke vor den Hängen des Luberon.
Mauer mit einem Tor aus Metall mit Zypressen und Allee dahinter. Repräsentativer Eingang zu einem Weingut.
Windmühle
Mauer mit einem Tor aus Metall mit Zypressen und Allee dahinter. Repräsentativer Eingang zu einem Weingut.
Haus in Landschaft mit Olivenbäumen und Weinstöcken. - Ansouis: kleiner Ort im Süden des Luberon gelegen. Rechts das Schloss.
Schloss: ehemals als Burg erbaut, wurde es im 12., 13., 15. und 19. Jahrhundert immer wieder umgebaut. Die heutigen Gebäude stammen aus dem 17. Jahrhundert. Es ist die ehemalige Residenz der Familie Sabran. Bereits im 10. Jahrhundert wurde Ansouis als Herrengut erwähnt und ging 1178 in den Besitz der Familie Sabran über. Bis 2008 wohnten hier Mitglieder der Familie. Der Ort entwickelte sich um das Schloss herum. Im 14. Jahrhundert kam eine neue Stadtmauer als Schutz des Ortes dazu.
Altes Waschhaus und ein Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Häuser aus Naturstein, enge Straßen, bunte Fensterläden.
Unterhalb der Stadtmauer, Blick hoch zur Kirche Saint-Martin.
Alte Häuser aus Natursteinen.
Alter Hauseingang mit Tür aus Holz und Nieten.
Alte Hauseingänge und Fenster mit Bögen aus Stein.
Häuser aus Naturstein.
Blick auf den Glocken- und Uhrenturm.
Place du Chateau mit Befestigungsanlage und dem Eingang zum darüber liegenden Schloss.
Historisches Foto
Eingang zum Schloss.
Église Saint-Martin: an der Stelle eines älteren Heiligtums, wurde in der Zeit der Romanik direkt an die Stadtmauer eine Kirche erbaut. An ihrer Fassade nach Süden sieht man noch die Schießscharten, die sich in der Festungsmauer befinden.
Inneres:
Durch den Anbau an die Stadtmauer ergibt sich eine Verschiebung der Achse zwischen quadratischer Apsis und Langhaus. Wandmalereien imitieren Marmor.
Blick in das Tonnengewölbe.
Stark zerstörte Wandmalereien, Statue der Jeanne d’Arc
Barocker Seitenalter mit dem heiligen Sebastian und 2 anderen Heiligen.
Apsis mit Hochalter und 2 Seitenaltären.
Hauptaltar mit Statue von Jesus Christus.
Seitenaltar mit Maria und dem Jesuskind.
Seitenaltar aus dem 17. Jahrhundert mit den lokalen Heiligen Elzéar und Delphine.
Blick zurück in das Langhaus.
Skulptur einer Frau aus Metall.
Kreuz aus Metall, welches ursprünglich auf dem Dach der Kirche angebracht war.
Überquerung der Durance. Im Hintergrund die bewaldeten Hügel des Luberon.
Blühende Rapsfelder, mit der Ruine eines Schlosses.
Känguruh und Hühner beim Chateau de Seuil.
Blühende Schwertlilien, blühender Blauregen mit Holzbiene - Chapelle Saint Cyr et Sainte Juliette: die Kapelle liegt in der Gemeinde Lançon, 6 km südlich von Salon-de-Provence. Die dem Heiligen Quiricus und seiner Mutter Julietta geweihte Kirche, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Sie erlitten um 304 den Märtyrertod. Ursprünglich war die Kirche von einem Friedhof umgeben. Die beiden Seitenkapellen kurz vor dem Chor, erwecken den Eindruck eines Querschiffs. Das Satteldach und der halbrunde Chor ist mit Steinplatten gedeckt. Auf dem Dach ein Glockenturm. Der Eingang zur Kirche ist auf der Südseite und wird flankiert von einem Strebespfeiler und der südlichen Seitenkapelle.
- Grans: kleiner Ort südwestlich von Salon-de-Provence.
Allee mit Platanen.
Kleine enge Straßen und Häuser aus Natursteinen mit farbigen Fensterläden.
Brückenbögen unter einer Straße in der Nähe von Arles.
Alte, verfallene Häuser. - Arles:
Die Stadt am Ostufer der Rhone, nördlich der Camargue, ist seit dem Altertum besiedelt. Der keltische Name Arelate, bedeutet „sumpfiger Ort“. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts kam die Gegend in römischen Besitz. Seit dieser Zeit gab es einen Wettbewert mit dem von den Griechen gegründeten Massalia, dem heutigen Marseille. Unter Kaiser Konstantin (ca. 280-337) erlebte das antike Arles seine Blütezeit. Es war im 4. und 5. Jahrhundert auch Residenz der römischen Kaiser, 395 war es die Hauptstadt Galliens. Hier kreuzten sich wichtige Römerstraßen.
Ab dem 3. Jahrhundert war es Bischofssitz, war 879 Hauptstadt des Königreichs Burgund und wurde daher 1033 Bestandteil des Heiligen Römischen Reichs. Seit 1481 fiel die Stadt zusammen mit der Grafschaft Provence an Frankreich.
Tour Luma des Architekten Frank Gehry (1929-). Das Gebäude ist ein künstlerischer und kultureller Kulturkomplex, der von der Luma-Stiffung von Maja Hoffmans initiiert wurde. Auf einem ehemaligen Industriegelände, entstand ein 56 m hoher verspiegelter, unregelmäßiger Turm. Die Edelstahlrauten des Turms, spiegeln das Licht in vielen Facetten. Der Sockel des Turms ist ein gläserner Rundbau.
Reste alter Befestigungsanlagen.
Boulevard des Lices: historische Gebäude, Hôtel Jules Caesar, Konzertpavillion und historisches Karussel.
Boulevard Georges Clemenceau: Theater von Arles
Boulevard Craponne: Wohnhaus
Historisches Haus mit üppig verzierter Fassade.
Kleine Straße mit Blick auf den Uhrturm des Rathauses im Hintergrund.
Denkmal für die Reiter der Camargue. - Camargue: große Schwemmlandebene in der Provence, die zu wesentlichen Teilen aus dem Mündungsdelta der Rhone besteht. Bekannt ist die Camargue als Naturschutzgebiet. Touristische Attraktionen sind die wildlebenden Herden der weißen Camargue-Pferde, einer Rasse, die nur hier vorkommt. Außerdem gibt es große Herden von Camargue-Stieren, die bei meistens unblutigen Stierkämpfen in den Arenen der Provence eingesetzt werden.
Bauernhof
Camague-Pferde und Traktor vor einem Bauernhof.
Kalifornischer Mohn oder Schlafmützchen. Giftpflanze.
Automat mit lokalen Produkten der Camargue, wie Honig, Bienenwachs und Meersalz oder Fleur de sel.
Straße Richtung Aigues-Mortes mit kleinen Bergen aus Fleur de sel oder Meersalz und einer Maschine für den Abbau.
Aigues Mortes: eine der größten noch erhaltenen mittelalterlichen Festungsstädte. Der Name bedeutet „totes Wasser“ und wurde erstmals im 10. Jahrhundert verwendet. Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert als Hafenstadt konzipiert und lag an einer großen Lagune, die nur durch Kanäle mit dem Mittelmeer verbunden war.
Bis zu dieser Zeit besaß der französische König kein Land im Süden Frankreichs. So erwarb Ludwig IX., der Heilige (1214-1270) hier große Landflächen und begann mit dem Bau einer Bastide. 1241-1250 entstand die Tour de Constance und ab 1248 der Rest der Stadt. Nun hatte er einen Mittelmeerhafen auf eigenem Gebiet und brach von hier zum 6. und 7. Kreuzzug auf. Während des 7. Kreuzzuges verstarb er 1270 an Typhus.
Bahnhof.
Tour de Constance. Die Dicke der Grundmauern beträgt 6 m. 22 m Durchmesser, Höhe bis zur Laterne 33 m. Über die Jahrhunderte diente er immer wieder als Gefängnis.
Eines der 10 Stadttore in der Stadtmauer.
Heute liegt die Salzgewinnung der Camargue in den Händen der Salins du Midi, ganz in der Nähe von Aigues-Mortes. Riesige Berge aus Meersalz oder Fleur de Sel.
Camargue: Camargue-Pferde mit einem schwarzen Fohlen.
Weg zum Strand mit Zaun aus Holz.
Blick von der Düne auf das Mittelmeer.
Moderne Wohnhäuser mit architektonisch ungewöhnlicher Fassade.
Lagerung von kleinen Booten in Regalen.
Vom Wasser geprägte Landschaft der Camargue. Getarnte Beobachtungsstation für Ornithologen.
Flamingos und andere Vögel, die die zahlreichen Etangs in der Camargue belegen. Nirgendwo sonst in Südeuropa leben so viele Flamingos.
Neben den Flamingos, 1 Graureiher, auch 2 Brandgänse und Silbermöwen am Ufer. - Sète: das kleine Venedig des Languedoc. Eine Hafenstadt, ganz in der Nähe der Camargue. Sie liegt auf einer schmalen Landzunge zwischen Mittelmeer und dem Étang de Thau. Abgesehen von frühen Besiedelungsspuren der Bronzezeit, die heute unter Wasser im Étang de Thau liegen, war nur der Mont Saint-Clair eine Zuflucht für Seeräuber. Erst unter König Ludwig XIV. (1638-1715) wurde die Stadt zu einem Hafen ausgebaut und der im Zentrum liegende Canal Royal angelegt. Sète ist heute der wichtigste französische Fischereihafen am Mittelmeer.
Silbermöwen nisten auf einem Dach.
Blüte und Früchte eines Zitronenbaums.
Inneres eines Ladens für Stoffe.
Häuser mit Booten direkt davor im Wasser.
Segelschiff im Canal Royal, dem Königskanal.
Häuser am Ufer des Canal Royal.
Historische Fassade eines Hauses mit Balkonen und Gittern aus Metall.
Auslagen von kleinen Läden in einer Straße.
Théâtre de la Mer auf dem Weg zum Fischereihafen. Es ist das ehemalige Fort Saint-Pierre. Es diente als Kaserne, Gefängnis und dann als Krankenhaus, bevor es ab 1959 auf Anregung des Schauspielers Jean Deschamps (1920-2007), der dort sein Festival de la Mer veranstaltete, in ein Theater umgewandelt wurde.
Informationstafel zum Fischereihafen.
Hinten rechts die Halle für die Fischauktionen, die hier seit 1967 abgehalten werden.
Modernes Fischerboot und in Tonnen Zubehör für die Fischer.
Leuchtturm Saint-Louis hinter der Marina mit privaten Booten. Vorne Tonnen mit Zubehör für die Fischer.
Promenade du Môle, die den Hafen vom Mittelmeer trennt.
Extrem enge Treppe unten vom Hafen hoch zur Straße.
Schaufenster mit süßem Gebäck und Pizza, zum Teil belegt mit Sardellen bzw. Anchovis.
Historische Fassade eines Hauses mit Balkon aus Metall.
Schaufenster mit Dekorationen aus Holzstücken mit Fischmotiven, Papageien und Pinguinen.
Laden und Werkstatt mit Künstlerinnen, die Mosaike herstellen, aus unterschiedlichen Materialien.
Wappen von Sète als Mosaik.
Tintentisch, lebensgroßer Flamingo, Makrelen, verschiedene Vögel, abstrakte Motive, Seepferdchen aus Holzstücken, Koalabär, Papageien.
Place du Pouffre: hier liegt das rosafarbene Rathaus und die Fontaine le Poulpe. Der Brunnen mit einer riesigen Krake und Delfinen aus Metall stammt von Pierre Nocca (1916-2016).
Blüte einer Rose.
Kleine Straße mit bunten Häusern und einem Kandelaber als Straßenlaterne auf einem kleinen Brunnen.
Straße Richtung Mont Saint-Clair.
Am Canal Royal Werbetafeln mit Angeboten für Bootsfahrten. Sie zeigen auch Luftaufnahmen von Sète.
Schiffsanlegestelle am Canal Royal.
Ankerketten, Metallteile, Fischernetze
Blick auf die gegenüber liegenden Häuser am Wasser.
Blick hoch zur Kirche Saint-Louis mit ihrem Glockenturm mit einer 7 m hohen Statue aus Kupfer der Jungfrau Maria.
Werbung an einem Fenster für Entspannungsprodukte, wie zum Beispiel Hanf.
Hôtel l’Orque Bleue mit Booten davor.
Industrieanlage.
Blühender Judasbaum.
Balaruc les Bains: Restaurant Saint-Clair in einer Bucht des Étang de Thau mit Blick auf Sète und den Mont Saint-Clair.
Miesmuscheln
Weinfelder und ein verlassenes Haus.
Der Ort Villeveyrac von Weitem. - Fahrt zur Abbaye de Valmagne: die Abtei Saint-Marie de Valmagne ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster bei dem Ort Villeveyrac. Mönche des Benediktinerklosters Ardorel in der Nähe von Castres, waren auf der Suche nach einem Gelände für ein neues Kloster, da das andere Kloster zu klein geworden war. Sie fanden dieses ungenutzte Ödland und gründeten 1138 hier ein neues Benediktinerkloster. Allerdings bemühte sich bereits 1144 der Abt Peter um den Anschluss an die Zisterzienser. Ziel dieses relativ neuen Ordens, war die Rückkehr zu den ursprünglichen Regeln des heiligen Benedikt: Armut, Buße und Zurückgezogenheit. Auf dem höchsten Punkt des Geländes wurde die Abteikirche für achtzig Mönche errichtet. Den Regeln der Zisterzienser entsprechend, sollte die Kirche so schlicht wie möglich gestaltet sein, auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Im Süden schlossen sich die Klostergebäude an. Da Valmagne eine bedeutende Pilgerstation auf dem Jakobsweg war, sollte eine größere Kirche entstehen. 1257 erteilte der Bischof von Agde den Auftrag für eine neue Kirche. Bertrand d’Auriac war damals Abt. Er holte Baumeister und Steinmetze aus dem Norden Frankreichs. Hier war die Architektur bereits in der hochgotischen Phase. Die wechselvolle Geschichte führte Jahrhunderte später dazu, dass die Abtei hoch verschuldet war. Es gab kaum noch Mönche und die Laienbrüder hatten die ganze Arbeit zu verrichten. Das Land lag brach. 1790, ein jahr nach der Revolution flohen die letzten Mönche und der Prior. Der Pöbel der umliegenden Dörfer stürmte Das Kloster und verwüstete alles. Es haben sich keine Dokumente, Urkunden, Bücher oder Möbel erhalten. Es wurde Staatseigentum und 1791 an den Winzer Monsieur Granier verkauft. Der Besitzer baute die Kirche in einen Weinkeller um. Nach seinem Tod wurde das Kloster versteigert und gelangte 1838 in den Besitz von Henri-Amédée-Mercure de Turenne, dessen Familie es nunmehr seit mehr als 150 Jahren besitzt und die Weinkellerei betreibt.
Plan der Klosteranlage: Nähert man sich der ehemaligen Abtei durch eine Allee, liegt rechts ein mittelalterlicher Klostergarten (Nr. 8), links eine Sammlung unterschiedlicher Rebsorten (Nr. 9). Direkt beim Eingang (Nr. 1) liegt ein Raum für die Degustation, zum Kosten des Weins (Nr. 6). Klosterkirche (Nr. 2) und die ehemaligen Klosterräume (Nr. 3-5).
Grundriss des Klosters aus dem leihweise ausgehändigten Klosterführer.
Vor dem Eingang zum Kloster der Blick auf den Klostergarten und im Hintergrund die Kirche.
Seiten aus dem leihweise ausgehändigten Klosterführer.
In ehemaligen Nebenräumen sind historische Geräte und Weinpressen ausgestellt.
Gegenüber ein Feld mit Weinstöcken.
Nebengebäude und ein zum Teil überbautes Wasserbecken.
Raum für die Degustation, zum Kosten des Weins.
Fischbassin auf dem Ehrenhof. Da der Verzehr von Fleisch den Mönchen verboten war, hat jedes Zisterzienserkloster einen Fischteich, in dem die Mönche die Fische für den Verzehr hielten. Es wurde im 18. Jahrhundert wieder hergestellt. Es wird von der klostereigenen Quelle gespeist.
Auf dem Ehrenhof wurden Besucher und Schutzsuchende begrüßt und in dem etwas zurückgesetzten Gebäude neben der Westfassade der Kirche untergebracht. Moderne Statuen aus Metall sind hier im Hof heute ausgestellt.
Graureiher auf dem Dach des Gästeflügels.
Westfassade der Kirche mit Narthex: hinter einem Zaun beginnt der innere Bereich des ehemaligen Klosters. Die nach einem romanischen Vorgängerbau entstandene, wesentlich größere gotische Kirche, hat mit ihren Schießscharten oben in den Türmen fast einen festungsartigen Charakter. Gemäß den Regeln der Zisterzienser, sind die Türme recht niedrig gehalten, da sie das Kirchenschiff nicht überragen dürfen. Erbaut wurde sie zwischen 1257 und dem Beginn des 14. Jahrhunderts. Der Narthex ist oben begehbar und hat eine Balustrade im Stil Ludwigs XIII. Vorgebaut ist eine Vorhalle, ein Narthex. Er besteht aus 3 Gewölbefeldern und hat als Begrenzung kleine Säulen mit Kapitellen und verzierten Konsolen zeugen von einer Lockerung der strengen Zisterzienserregeln, die eigentlich figürliche Darstellungen verbieten. Hier gab es Gottesdienste für Gläubige der Umgebung und Konfirmantenunterricht für Taufwillige.
Details der figürlichen Darstellungen.
Inneres:
Das Langhaus ist 83 m lang, 24,5 m hoch. Das Querhaus ist 30 m lang. Der Grundriss ist der einer Basilika, also in der Form eines lateinischen Kreuzes.
Langhaus mit riesigen Fudern, großen Fässern aus Holz, in den Seitenschiffen, die im 18. Jahrhundert teilweise vermauert wurden. Wenn man sich diese nachträglichen Ergänzungen wegdenkt, sieht man hier eine gotische Kirche, die 20 Jahre vor dem Bau der ersten südfranzösischen Kirchen im gotischen Stil entstanden ist. Auch in der Kirche stehen moderne Statuen aus Metall.
Blick in das Gewölbe mit kunstvoll gestalteten Schlusssteinen.
Nahe der Vierung Blick in den Chor mit 9 Kapellen.
Blick in das nördliche Querhaus, in dem sich oben noch Reste von Maßwerk einer Fensterrosette erhalten haben.
Gewölbe des Chors, mit der Marienkrönung im Schlussstein.
Blick in die 9 Radialkapellen des Chores.
Apsiskapelle in der Mitte mit einer Mariendarstellung aus dem 17. Jahrhundert.
Blick zurück durch das Langhaus zum Eingang.
Kreuzgang:
Blick in den östlichen Kreuzgang mit der Tür zur Sakristei links. Die von hier abgehenden Räume stammen meist noch aus der Gründungszeit des Klosters.
Kleine Nische (Armanium) direkt beim Eingang zur Kirche. Hier legten die Mönche ihre Gebetstexte ab, wenn sie die Kirche verließen. Heute steht hier eine Vase.
Sakristeitür mit einen Sägeblattfries. Die Sakristei hat einen direkten Zugang zum südlichen Querhaus der Kirche.
Eingang zum Kapitelsaal mit Vasen unter den Arkaden.
Detail einer Vase.
Inneres des Kapitelsaals mit freitragendem Gewölbe, ohne stützende Säule.
Ostgalerie des Kreuzganges mit Blick in den Klosterhof. Laienbrüder konnten in der Ostgalerie an den Beratungen der Mönchen teilnehmen.
Klosterhof mit Blick auf den im Süden stehenden Brunnenhaus.
Brunnenhaus am südlichen Arm des Kreuzganges, direkt vor dem Refektorium, dem Speisesaal der Mönche. Gemäß den Regeln mussten sich die Mönche vor der Berührung des Brotes, als Symbol des Leibs Christi, am Brunnen eine rituelle Handwaschung vornehmen. Die bereits von den Römern entdeckte Diana-Quelle, versorgt den Brunnen und die zahlreichen Becken des Klosters mit Wasser. Heute schwimmen in dem achteckigen Brunnenbecken Goldfische und Zierkarpfen, Kois.
Refektorium aus dem 17. Jahrhundert, mit einem prächtigen Kamin aus der Zeit der Renaissance. Er stammt vom Château Cavillargues. Die Eigentümer von Valmagne verkauften dieses Schlosses im 19. Jahrhundert, um die Restaurierung von Valmagne zu finanzieren.
Farbige Glasfenster.
Westlicher Kreuzgang mit Blick auf das Brunnenhaus und den Glockenturm der Kirche.
Nördlichen Kreuzgang, Blick durch den Klosterhof auf das Brunnenhaus.
Abbau von roten Erden. - Sète:
Bewegliche Brücke, Pont Maréchal-Foch, die über den Canal Royal führt.
Blick auf den Canal Royal bei seiner Mündung in den Étang de Thau.
Historische Fassade mit großem Tor und einem Flachrelief von einem Löwen von Jean Magrou (1869-1945), 1909.
Blick auf Sète und die im Étang de Thau liegenden Austernbänke.
Kleiner historischer Eisenbahnwaggon auf einem Abstellgleis.
Schloss an der D 6110 - Moulézan: kleiner Ort nördlich von Montmirat, mit nur ca. 700 Einwohnern.
Kleine im Kern noch romanische Kirche.
Tor aus Metall mit Pfosten, auf denen ein Monogramm zu sehen ist.
Moderne Hochhäuser mit violetten Fassaden und ein Kran.
Autobahn A 75 Richtung Norden mit Blick in den Parc naturel régional des Grands Causses. Höhe Saint-Guilhem-le-Désert.
Landschaft und Orte an der Autobahn A 75 Richtung Norden. Felslandschaften der Corniches de l‘ Escalette.
Autobahntunnel. - Le Caylar: kleiner Ort mit nur ca. 500 Einwohnern, direkt an der A 75. Oben auf einem Hügel die Ruinen einer Burg und eine sehr alte Kirche.
Schild mit Rasthöfen an der Autobahn A 75.
Die Autobahn führt hier durch die Causse de Larzac. Diese Kalkstein-Hochebene ist die südlichste Causse des Zentralmassivs und liegt auf der Höhe zwischen 650 und 1200 Metern. - Viaduc de Millau: die einzige Stelle der Autobahn A 75, wo man bezahlen muss. Die 2460 m lange und 270 m hohe Brücke führt über das Tal des Tarn. Sie entstand nach Plänen von Michel Virlogeux (1946-) und wurde von Norman Foster (1935-) gestalterisch ausgearbeitet. Bauzeit 2001-2004. Sie ist die längste Schrägseilbrücke der Welt. Bei einer Höhe der Pfeiler von 343 m ist es auch das höchste Bauwerk Frankreichs und die höchste Brücke Europas. Wegen ihrer exponierten Lage in der Hauptwindrichtung, sind die Brückenpfeiler unterhalb der Fahrbahn y-förmig geteilt und wirken daher von der Seite nahezu grazil.
Die Stadt Millau und die umgebende Landschaft der Causse unterhalb der Brücke.
Silo in der Form eines Bleistifts.
Beeindruckende Felsen und weite Landschaft.
Eine Burg und ein kleiner Ort im Tal des Lot.
Eine Burg, modern ausgebaut.
Ungewöhnlicher Parkplatz mit vielen Stelen aus Stein. Tourism House area of Lozère an der Autobahn A 75, nördlich von Saint-Chély-d’Apcher - Truyèrebrücke Viaduc de Garabit: Eisenbahnbrücke über das Tal der Truyère. Erbaut Ende des 19. Jahrhunderts von Gustave Eiffel (1832-1923). Die Bauarbeiten begannen 1880 und waren 1884 abgeschlossen. 25 Jahre lang war es die höchste Eisenbahnbrücke der Welt. Nah an der Autobahn A 75 gelegen, gibt es hier einen Rastplatz mit einer Aussichtsterrasse.
Unterhalb der Brücke wird die Truyère aufgestaut.
Ein Raubvogel kreist über dem Wald unterhalb der Brücke.
Weiter rechts ein Bauernhof mit Pferden auf der Koppel.
Landschaft mit weiten grünen Wiesen.
Bauernhof in einem Tal mit Kühen auf der Weide.
Nördlich des Ortes Massiac, steht auf einem Felsen die kleine Kapelle Sainte-Madeleine de Cahlet. In der kleinen ehemalige Burgkapelle aus dem 12.-14. Jahrhundert, haben sich in der Apsis noch einige Wandmalereien erhalten.
Weitere kleine Orte, teilweise mit kleinen Burgen.
Altes Haus aus Natursteinen bei Saint-Germain-LembronOrt mit Burg- und Schlossruine.
Romanische Kirche Sainte Radegonde: sie liegt hoch auf einem Berg beim Ort Saint-Yvoine im Tal des Flusses Allier.Montpeyroux: 25 km südöstlich von Clermont-Ferrand. Das Dorf wird vom Tour de Montpeyroux, einem Festungsturm (Donjon) aus dem 13. Jahrhundert überragt.
Regenbogen südlich von Clermont-Ferrand. - Paray-le-Monial: Die Stadt mit fast 10.000 Einwohnern ist ein bedeutender Wallfahrtsort. Er liegt in der Region Bourgogne-Franche-Comté am Fluss Bourbince und dem parallel dazu verlaufenden Canal du Centre. Im 10. Jahrhundert wurde hier ein Benediktinerkloster gegründet. Der Bau der Kirche begann 1109, initiiert durch den heiligen Hugo (1024-1109), den berühmten Abt von Cluny. Im Mittelalter gab es hier eine bedeutende Tuchindustrie. Heute ist Paray-le-Monial das Zentrum der Herz-Jesu-Verehrung in Frankreich, ausgelöst durch die Visionen der Nonne Marguérite Marie Alacoque (1647-1690). Sie wurde 1920 heiliggesprochen. Seit dem späten 19. Jahrhundert ist Paray-le-Monial der am meisten besuchte Pilgerort Frankreich.
Hostellerie des de 3 Pigeons in der Rue Dargaud.
Blick durch die Rue Dargaud auf den Turm der ehemaligen Église Saint-Nicolas. Sie wurde ab 1531 erbaut und 1535 geweiht. 1549 erhielt die Kirche den massiven Glockenturm. Im Laufe der Geschichte hatte die Kirche mehrere Funktionen. Ehemals Kirche für Mönche, wurde sie nach der Revolution eine Pfarrkirche. Im Jahr 1792 wurden die Gottesdienste hier eingestellt. 1861 wurde das Gebäude umgebaut, die Apsis und die Seitenkapellen zerstört. Die Anbringung der Uhr, die zur Notwendigkeit für die Bevölkerung erklärt wurde, ist es zu verdanken, dass die Zerstörung des Turmes ausblieb. Sie diente aber auch als Gefängnis, Wachhaus und Gemeinschaftshaus. Heute ist sie ein Ort für wechselnde Kunstausstellungen.
Informationstafeln zur ehemaligen Kirche Saint-Nicolas.
Blick auf den Platz vor der ehemaligen Kirche.
Direkt neben der ehemaligen Kirche Saint-Nicolas steht das Rathaus.
Rathaus: es ist das 1525-1528 im Stil der frühen Renaissance erbaute Stadthaus des Tuchmachers Pierre Jayet. Seit 1862 befindet sich hier das Rathaus.
Die Fassade baut auf älteren Strukturen auf. Sie ist dekoriert mit italienisch beeinflussten Muschelornamenten. Ganz oben in Medaillons, die die Bildnisse der französischen Könige zeigen. Die Baluster über dem Eingangsportal, ein Muschelornament und Musiker, die wie Putten aussehen und wohl ebenfalls von der italienischen Kunst beeinflusst sind. In der ersten Etage halten Kinderfiguren im Hochrelief Wappen- und Familiendevisen. Dazwischen ist Pierre Jayet und seine Frau als Flachrelief verewigt.
Werbeschild für FDJ. Dies ist die teilstaatliche Lotterie-Gesellschaft Frankreichs – La Française des Jeux. Als Deutsche assoziiert man hier die Organisiation der „Freien Deutschen Jugend“ der DDR.
Am Platz beim Rathaus der ehemaligen Kirche Saint-Nicolas stehen weitere historische Gebäude, mit zum Teil aus der Gotik stammendem Fenstern und Türen.
Schaufenster eines Ladens mit Souvenirs und Statuen von Maria und Engeln.
Enge Gasse mit Läden in der Altstadt.
Haus an der Avenue Jean-Paul II., die zur Basilique de Sacré-Coeur führt.
Blick über den Fluss Bourbince von der Vieux Pont aus.
Vor der Kirche ein Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges.
Sacré-Coeur: es handelt sich um eine verkleinerte Nachbildung der ehemaligen Kirche des, nur 50 km östlich liegenden Klosters Cluny. Meisterwerk der romanischen Architektur und das am besten erhaltene Beispiel für die Baukunst von Cluny. 2 große Türme im Westen mit Narthex weisen direkt auf den vor ihr liegenden Fluss Bourbince.
Die heutige Kirche ersetzt 2 Vorgängerbauten (Paray I und Paray II). In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, wurde das Langhaus im Westen um die frühromanische Vorhalle (Narthex) und die Fassade mit 2 Türmen erweitert, was als Paray II bezeichnet wird. Im Gegensatz zur übrigen Kirche ist dieser Anbau in stark restaurierter Form noch heute erhalten. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, die Mauren waren aus Spanien vertrieben worden, entwickelten sich die Pilgerfahrten entlang des Jakobsweges nach Santiago de Compostela. Die Kirche wurde zu klein und so entstand ab 1090 Paray III. als spätromanischer Bau. Abt Hugo (1024-1109) von Cluny konnte bereits 1095 im neuen Chor den Hochaltar einweihen. Der alte Chor war dafür abgerissen worden. Der Hundertjährige Krieg sorgte für einen dramatischen Einbruch der Pilgerzahlen. Man musste sich wieder auf Pilgerfahrten zu eigenen Reliquien beschränke.
Marguérite Marie Alacoque (1647-1690) trat 1671 in Paray-le-Monial in den Orden der Heimsuchung Marias ein. Bald nachdem sie Nonne der Salesianerinnen geworden war, hatte sie mehrere Jesus-Erscheinungen, der ihr sein Herz zeigte. Ausgelöst durch ihre Visionen, wurde Paray-le-Monial das Zentrum der Herz-Jesu-Verehrung. 1920 wurde sie heiliggesprochen.
1873 wurde die Kirche von Notre-Dame in Sacré-Coeur umbenannt. Das Kloster ist direkt an die Kirche angebaut.
Blick über den Fluss auf die Westseite von Kirche und Kloster.
Vierungsturm: Quellen berichten, dass die Kirche einen gotisch gestalteten Vierungsturm besessen hat, der 1856 von einer neuromanischen Nachbildung ersetzt worden ist.
Informationstafel die beide Turmfassungen zeigt.
Fassade im Westen. Hier sieht man den Unterschied zwischen den beiden Türmen. Der rechte Turm stammt aus dem 11. Jahrhundert und stammt daher noch von dem Vorgängerbau. Der linke Turm entstand im 12. Jahrhundert. Insgesamt fällt auf, wie streng und nüchtern der Bau wirkt, durch das Fehlen von Bauplastik.
Detail des linken Turms.
Informationstafel
Narthex: die rechteckige Vorhalle, in der sich Überreste der 1004 geweihten Kirche erhalten haben. Sie wurden im 19. Jahrhundert aufwändig restauriert. 12 Pfeiler, die untereinander durch halbrunde Bögen verbunden sind, halten ein Kreuzgratgewölbe.
Detailreiche Kapitelle haben sich hier erhalten. Motive sind hockende nackte Menschen, Löwen und Pflanzen.
In der Mitte ein Portal, flankiert von reich verzierten Säulen, Türsturz und Kapitelle mit floralen Motiven.
Geht man in nördlicher Richtung, also im Uhrzeigersinn, um die Kirche herum kommt man nördlichen Querhaus mit Blick auf den Vierungsturm. Mit 9 Metern ragt das Querhaus weit über das Langhaus hinaus.
Durchgang durch einen Bogen auf einen hinter dem Chor liegenden Hof.
Nördliches Querhaus mit dem im Norden liegenden Portal.
Das Nordportal ist deutlich größer als das Hauptportal an der Westseite beim Narthex. Es zeigt reichen Schmuck. Friese mit Rosetten, reicht verzierte Säulen mit Schneckenmuster und vierblättrigen Kleeblättern. Die beiden hölzernen Türflügel haben dekorative Bänder aus Metall als Zierde.
Blick auf den Hof hinter der Kirche und den Chor von der Seite. In dem mehrstöckigen Gebäude hinten rechts, befindet sich die Chapelle Saint-Jean.
Der Chor mit seinem Kranz aus Kapellen. Er ist in der Höhe sechsfach abgestuft, was sehr beeindruckend wirkt.
Detail eines Kapitells am Chorhaupt.
Auf der Südseite, steht neben der Kirche das Kloster. Die Konventsgebäude wurden im 18. Jahrhundert renoviert und erneuert.
Giebel des Hauptgebäudes mit Balkon.
Blick in den Kreuzgang mit dem Klosterhof mit Garten. Dieser ist von zweigeschossigen Gebäuden umgeben.
Plan und Beschreibung des Gartens, der von mittelalterlichen Klostergärten inspiriert ist. Er wurde nach dem klassischen Kreuzplan neu angelegt. In der Mitte ein kleiner Brunnen.
In dem Rechteck zwischen Kreuzgang, Langhaus und südlichem Querhaus, ist eine Installation des Künstlers Joël Barguil (1947-) aus Eisen, Schiefer, Zement und Spiegeln, mit dem Titel „Lame de pluie“ ausgestellt.Informationstafel zu der Installation.
Direkt daneben befindet sich das Südportal der Kirche, welches den direkten Zugang vom Kreuzgang zur Kirche gewährleistete. Die flankierenden Säulen sind üppig mit graphischen Mustern verziert. Der Türsturz zeigt phantastische Tierwesen in Medaillons. Hier sind noch Reste der farblichen Ausmalung erhalten geblieben.
Detail eines Kapitells.
Inneres der Kirche:
Blick durch das 50 m lange, 7,90 m breite und 22 m hohe Langhaus Richtung Chor. Die Kirche ist dreischiffig. Die Seitenschiffe sind mit nur 11,50 m Höhe, nur halb so hoch wie das Mittelschiff bzw. Langhaus.
Bereich der Fenster im Obergaden.
Im nördlichen Seitenschiff haben sich farbig gestaltete Bögen und Kapitelle erhalten.
An den Pfeilern zu den Seitenschiffen haben sich kunstvolle Kapitelle erhalten.
Vor dem Chor mit dem Chorumgang und den 3 Apsiskapellen, steht der schlichte Hochaltar.
1935 hat man im Gewölbe der Chorapsis ein mehrfarbiges Fresko entdeckt. Es zeigt byzantinische Einflüsse.
Es zeigt den thronenden Christus „Pantokrator“ in einer Mandorla, die außen von geflügelten Evangelistensymbolen begleitet wird. 15. Jahrhundert.
Blick über die Vierung in den Chorumgang.
Der Chorumgang bzw. Ambulatorium ist relativ schmal.
Blick vom nördlichen Seitenschiff über das nördliche Querschiff in den Beginn des Chorumgangs.
Direkt daneben ein Altar mit einem Bildnis von Maria.
Blick vom nördlichen Beginn des Chorumgangs über die Vierung. Hinten die südliche, gotische Seitenkapelle.
Gewölbe des Chorumgangs.
Blick vom Chorumgang Richtung Vierung.
Linke Kapelle der Apsis mit Altar für den Heiligen Joseph.
Detail des steinernen Altars.
Mittlere Kapelle in der Apsis mit einem Foto von Papst Johannes Paul II. (1920-2005).
Auf dem Boden eine Platte, die an den Besuch von Papst Johannes Paul II. am 5. Oktober 1986 erinnert.
Farbiges Glasfenster in der Kapelle, mit der Darstellung unter anderem der Geburt Jesu.
Die rechte Kapelle der Apsis, in der sich alte Kapitelle erhalten haben, hier auch ein Meerweib.
In den farbigen Glasfenstern ist die Geschichte der Marguérite Marie Alacoque (1647-1690) erzählt, die mit ihren Jesus-Erscheinungen die Herz-Jesu-Verehrung in Paray-le-Monial ausgelöst hat.
Von der Vierung Blick durch das Langhaus Richtung Westen, zum ehemaligen Haupteingang.
Farbige Glasfenster über dem Eingang im Westen.
Blick in des nördliche Querschiff.
An der Wand ein Denkmal für die Toten des ersten Weltkrieges. Davor ein altes Lavabo, Wasserbecken, an dem sich die Mönche reinigen konnten.
Hier liegt die Taufkapelle, der sich noch romanische, farbige Bögen und Kapitelle erhalten haben.
Blick über die Vierung Richtung südliches Querschiff.
Von hier geht die im 15 Jahrhundert, im gotischen Stil neu errichtete Seitenkapelle ab. Sie diente der Stifterfamilie Damas-Digoine als Grabkapelle. Heute ist es die Kapelle des Allerheiligsten.
Vor der Kapelle rechts eine Pietà, umgeben von gotischem Maßwerk.
Gewölbe in der gotischen Kapelle.
Altar in der Kapelle des Allerheiligsten.
Detail vom unteren Teil des Altars aus Stein mit der Krönung Marias.
Neben dem Altar eine kleine Nische mit gotischem Baldachin.
3 farbige Glasfenster in der gotischen Kapelle, von links nach rechts:
links: die Geschichte von Jesus, unten mit der Geburt Jesu und der Anbetung der heiligen drei Könige und der Hirten.
Mitte: der Tod Marias
rechts: Verkündigung und Wurzel Jesse.
Weitere Glasfenster in der Kirche, die allerdings vom Ende des 19. Jahrhunderts und dem 20. Jahrhundert stammen. Die originalen Fenster wurden während der Revolution zerstört.
Fenster mit dem Heiligen Petrus.
2 Fenster mit rund gefassten Motiven aus der Bibel, zum Beispiel Adam und Eva oder die Verkündigung.
Gotisches Maßwerk
Umrahmte kleine Nische in der Wand.
Statue des Heiligen Petrus.
Kapitelle von verschiedenen Stellen des Innenraums.
Parc Chapelains:
Informationstafel
Büste vom 1992 heiliggesprochen Claude La Colobière (1641-1682).
Der Park liegt hinter der Kirche und dem Kloster. Der umzäunte Park wurde eingerichtet, um die Pilger zu empfangen, deren Zahl seit dem 200. Jahrestag der Erscheinungen 1875 deutlich zugenommen hatte. 1889 wurde das Maison des Chapelains auf den Grundmauern der ehemaligen Burg der Äbte von Cluny errichtet. Zwei Alleen mit Platanen in der Form eines Kreuzes werden 1890 angelegt.
An der Seite das Gebäude mit dem, zur Zeit wegen Renovierung geschlossenen, Diorama zum Leben der Heiligen Marguérite Marie Alacoque.
In der Mitte, am Kreuzungspunkt der Alleen ein 1902 errichteter Bau mit Kuppel, der für Gottesdienste im Freien vorgesehen ist.
Blick zurück zur Kirche und dem Bau des Diorama.
Grotte, Detail der Grotte und Kreuzigung auf dem Dach der künstlichen Grotte.
Blick vom Park zur Kirche Sacré-Coeur.
Blick vom großen, modernen Empfangsgebäude für die Pilger, dem Salle Sainte Marguerite-Marie, zurück zum alten, eingerüsteten Rundturm, der als einziges von der Burg der Äbte übrig geblieben ist.
Saint-Hugues Garten: der Garten liegt im Norden der Kirche, jenseits der Rue de la Visitation, gegenüber der Tourismusinformation.
Informationstafel
Neben dem schön angelegten Rosengarten, hat man von hier einen schönen Blick auf die Kirche Sacré-Coeur.
Rue du Dr. Griveaud mit historischem Fachwerkhaus.
Fassade eines Hauses in der Rue de la Visitation mit Balkonen und Gittern aus Metall.
Chapelle des Apparitions oder Chapelle de la Visitation:Informationstafel
An diesem Ort hatte die Salesianerin Margareta Maria Alacoque hier zwischen 1673 und 1675 die Erscheinungen des Herzens Jesu. Ihr Beichtvater, der Jesuitenpater Claude La Colombière (1641-1682) hat sie damals für echt befunden.
Die Kapelle des Klosters der Heimsuchung wurde 1663 erbaut und dann 1854 im neuromanischen Stil umgestaltet.
Fassade der Kapelle.
Tympanon mit der Darstellung des letzten Abendmahls als Flachrelief.
Inneres:
Das Wandgemälde in der Apsis zeigt die die Erscheinung des Herzen Jesu vor der Nonne Margareta Maria Alacoque.
Seitenaltar mit einer Statue des Heilen Joseph. Der Altar aus Stein zeigt die Geburt Jesu.
Lampe aus Metall im neuromanischen Stil.
Seitenaltar mit einer Statue von Maria mit dem Jesuskind.
Kapelle mit einer Grabfigur aus Wachs der Salesianerin Margareta Maria Alacoque in einem silbernen, neuromanischen Sarkophag mit Rundbögen, durch die man die Wachsfigur sehen kann.
Blick zurück zum Eingang der Kapelle.
Alte Fachwerkhäuser und andere historische Häuser, zum Teil mit rundem Turm.
Kleine Straße mit Läden.
Rue Pasteur mit der Seniorenresidenz Villa Medici mit einer Kirche, dahinter das Lycée Jeanne d’Arc.
Neben dem Gymnasium die Chapelle Saint-Claude-La-Colombière:
Die nach Nordosten ausgerichtete Kirche hat das lateinische Kreuz als Grundriss.
Sie wurde 1929-1930 erbaut. In einem Schrein werden die Reliquien des Heiligen Claude La Colobière (1641-1682) aufbewahrt. Er war der jesuitische Beichtvater der Heiligen Margareta Maria Alacoque und hatte ihre Herz-Jesu-Erscheinungen als echt befunden.
Inneres:Blick durch das Langhaus mit 2 Seitenschiffen Richtung Hochaltar. Säulen aus Marmor tragen zweifarbige Bögen, so dass das Innere wie eine byzantinische Kirche wirkt. Die Kapitelle im Langhaus von Henri Charlier (1883-1975) zeigen detailreiche figürliche Darstellungen. Die Mauméjean-Werkstätten fertigten die Mosaike und Buntglasfenster.
Über der Vierung eine Kuppel mit achteckigem Tambour.
Hinter dem Hochaltar ein Mosaik mit Christus vom heiligen Herzen. Er sitzt auf einem Thron, umgeben von Engeln und Gläubigen, sowie dem Jesuiten Claude La Colombière und der Salesianerin Nonne Margareta Maria Alacoque.
Rechts und links von der Hauptapsis befinden sich 2 weitere Apsiden. Links der heilige Jean François Régis (1597-1640), der im Land als Volksmissionar tätig war.
Blick zurück zum Eingang mit der Orgel auf einer Empore.
Musée du Hiéron: Der Name des Museums basiert auf dem griechischen Wort hieros für heilig und bezieht sich auch auf das griechische Wort hieron, für Räume, die sowohl religiös, als auch politisch sind.
Informationstafel.
1890 wurde das Museum auf Initiative des Jesuiten Victor Drevon, von Baron Alexis de Sarachaga gegründet. Architekt war Noël Bion (1845-?), inspiriert von Gustave Eiffel (1832-1923), erbaut 1890-1893. Hinter der monumentalen, klassischen Fassade an der Rue Pasteur, befindet sich eine Glas-Metall-Konstruktion. Es gilt als das älteste, bereits als Museum geplanter Bau für sakrale Kunst in Frankreich. Metallarchitektur mit Oberlichtern, die während des zweiten Kaiserreichs unter dem Einfluss von Napoleon III. entwickelt wurde. Das Gebäude hat, von oben betrachtet, die Form eines stilisierten Herzens. Dies war der Wunsch den Architekten, um die besondere religiöse Bedeutung der Stadt Paray-le-Monial zu reflektieren.
Eingang an der Spitze des Herzens. Nach einem Vestibül öffnen sich mehrere von oben beleuchtete Ausstellungsräume.
Daniel Gloria (1908-1989): Crucifixion, 1952. Als Fresko auf zweiseitiger Zementplatte gemalt.
Amédée Cateland (1876-1938): 30,5 cm hohes Kruzifix mit der Jungfrau, dem Heiligen Johannes und dem Heiligen Geist, Ende der 1920er Jahre. Bronze mit eingelegter Emaille.
Daniel Gloria (1908-1989) ?: Geburt Jesu
Daniel Gloria (1908-1989) ?: Verkündigung
Einer der von oben beleuchteten Ausstellungsräume.
Kleiner Altar für die Tasche, zum aufklappen.
Gregorsmesse: Deutschland, Ende 15. Jahrhundert. Öl auf Eichenholz. Es ist das erste Gemälde, welches 1879 in den Besitz des Museums kam.
Informationstafel zu diesem Gemälde zeigt unter anderem ein Detail des Bildes vor der Restaurierung.
Austellungsraum, von oben beleuchtet, mit roten „Blutstropfen“ aus Glas an der Wand. Hélène Mugot (1953-): Blut und Tränen. 200 rote Tropfen aus Glas und 350 Tropen aus klarem Glas. Das Kunstwerk wurde kreiert für die Ausstellung „Zeitgenössische Maria Magdalena“ in Toulon.
Jaro Hilbert (1897-1995): Das letzte Abendmahl. Öl auf Leinwand. Inspiriert von seinen Reisen nach Ägypten und Palästina, hat Hilbert die Jünger mit semitischen Gesichtszügen und orientalischer Kleidung dargestellt.
Joseph Chaumet (1852-1923): Via Vitae, 1904. Marmor, Alabaster, Onyx, Gold, Elfenbein, vergoldetes Silber, Granat, Diamanten und Rubine, Bergkristall, Messing.Höhe 2,70 m, Länge 3 m. An den Hängen eines Marmorberges, umgeben von Alabasterwellen, zeigen zehn Gruppen von Figuren das Leben von Christus. Der Juwelierkünstler hatte dieses Kunstwerk in seinen Salons in Paris am Place Vendome von 1894-1904 geschaffen. Bis 1933 wurde es in seinen Juweliersalons gezeigt und war damit nur wenigen privilegierten Besuchern zugänglich.
Großes Altarbild mit blauen Säulen: Frankreich, 17. Jahrhundert. Knochen, Papier, Pappe, Lametta, Stoff, Glas, Holz. Dieses halbkreisförmige Altarbild mit sechs geriffelten blauen Säulen vermittelt einen Eindruck großer Tiefe, der durch den schwarzen Hintergrund und das umgekehrte Profil des Rahmens noch verstärkt wird. Das unter dem Altar angebrachte Gemälde zeigt die Jungfrau, die Jesus hält, und an ihrer Seite den heiligen Johannes den Täufer als Kind. Auf der Unterseite sind drei Reliquien in Medaillons eingelassen. Höhe 55 cm, Breite 45 cm.Veranstaltungsraum, vom Vestibül aus gleich in der Mitte. Hinter dem Flügel das
Portal aus der Kirche von Ancy-le-Duc: es stammt von ehemaligen Eingang des Klosters, ca. von 1150 und wurde während der Revolution demontiert. Es ist ein bedeutendes Meisterwerk der romanisch-burgundischen Bildhauerkunst. Im Tympanon sieht man Christus in einer von Engeln gehaltenen Mandorla. Darunter als Türsturz mehrere Personen. In der Mitte Maria mit Jesus. Rechts heilige Frauen und links der Apostel Petrus mit dem Schlüssel. Links der heilige Stephanus, gekleidet in ein liturgisches Gewand des Diakons mit einem Buch in der Hand.
Schematische Darstellung des romanischen Tympanons.
Informationsblatt.Im gleichen Raum befinden sich kleinere Nachbildungen von ägyptischen und germanischen Grabdenkmälern. Dahinter jeweils Malereien die Szenen aus dem jeweiligen Kulturkreis zeigen.
Regal mit Gartenzwerge zum kaufen.
Schinken in Netzen und Würste zum kaufen
Regal und Verkaufstische in einem Buchladen mit Mangas und Comics. - Montceau-les-Mines: Die Stadt liegt nordöstlich von Paray-le-Monial, am Schifffahrtskanal Canal du Centre sowie am parallel verlaufenden Fluss Bourbince. Seit dem 19. Jahrhundert wurde hier Steinkohle abgebaut. 1992 stellte der letzte Untertagebau den Betrieb ein, 2002 schloss auch der letzte Tagebau seine Pforten.
Plan der Stadt
Blick auf den Canal du Centre und das weiter hinten liegende Bassin mit einem kleinen Hafen.
Kleiner Hafen am Quai General de Gaulle.
Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges, im Hintergrund die Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption.
Details des Denkmals, 1919 von Antoine Bourdelle (1861-1929) geschaffen.
Église Sainte-Barbe, heute Notre-Dame-de-l’Assomption: Die Compagnie des Mines de Blanzy ließ die Kirche von 1857-1861 nach Plänen des Architekten Paul Dumouza, im neuromanischen Stil errichten. Nach dem Tod von Jules Chagot, dem Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, wurde 1877 eine Trauerkapelle, die heutige Sakristei angebaut. Weitere Gebäude im Nordwesten der Kirche, wie zum Beispiel Unterkünfte für Nonnen und ein Versammlungsraum sind heute alle zerstört.
Inneres:
Die Kirche hat ein Langhaus mit 2 Seitenschiffe, ein Querschiff mit 3 Kapellen. Über der Vierung erhebt sich ein Glockenturm mit Dach aus Schiefer und einer Laterne.
Blick zum Altar
Blick zur Orgel und Orgelempore.
Kapitell mit Vögeln mit dem Kopf einer Frau. - Paray-le-Monial:
Alte Markthalle oder Galerie Commerciale, heute mit einem Restaurant und
Läden.
Die Stadt in nächtlicher Beleuchtung.
Blick auf die angestrahlte Kirche Sacré-Coeur mit Spiegelung im Wasser des Flusses Bourbince in unterschiedlichen Belichtungen und von unterschiedlichen Seiten.
Chapelle des Apparitions oder Chapelle de la Visitation bei Nacht.
Ehemaligen Kirche Saint-Nicolas bei Nacht.
Chapelle Saint-Claude-La-Colombière bei Nacht.
Musée du Hiéron bei Nacht.
Seniorenresidenz Villa Medici mit seiner Kirche bei Nacht.
Karte mit den romanischen Kirchen, die sich in der Umgebung von Paray-le-Monial befinden. - Montceaux-l’Étoile: kleiner Ort mit nur etwa 300 Einwohnern, 16 km südwestlich von Paray-le-Monial.
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul: ein Langhaus mit Tonnengewölbe. Die Kirche hat eine halbrunde Apsis mit einem Turm auf dem Chor. Sie wurde im Stil der Hochromanik von 1130-1140 errichtet. Die originale Apsis wurde 1777 aufgebrochen, um eine Grabkapelle für den Herrn des Ortes Abel de Vichy und sein Gattin anzubauen.
Auch die Sakristei entstand später. Der verwendete Kalkstein hat eine fast goldene Färbung. Der Grundriss ist ein langgestrecktes Rechteck.
Fassade im Westen mit dem kunsthistorisch bedeutenden Westportal. Am Giebelfirst ein steinernes Kreuz, das an karolingisches Flechtwerk erinnert. Über dem Westportal ein Fenster mit Rundbogen.
Westportal: Im Tympanon die Himmelfahrt Christi, der in einer von Engeln getragenen Mandorla steht. Darunter stehen als Türsturz, die kleinen Figuren der Apostel, Maria und ein Engel. Rechts von der Mitte Petrus mit einem überdimensionalen Schlüssel.
Die Kapitelle auf den Säulen zeigen links den Kampf eines fast nackten Kriegers mit einem nicht erkennbaren Wesen. Das Kapitell rechts zeigt einen Engel, der einen auf die Darstellung im Tympanon hinweist.
Am oberen Ende der Tür sieht man Konsolen mit Skulpturen. Links kämpft ein Engel im Kettenhemd mit erhobenem Schwert gegen ein Ungeheuer.
Auf der rechten Konsole sieht man ein geflügeltes Wesen mit menschlichem Kopf und Krallenfüßen.
Nordseite der Kirche.
Detail des Glockenturms von 2 Seiten.
Unterhalb des Daches ragen Kragsteine heraus, die mit Köpfen, Tieren und Fabelwesen verziert sind.
Südseite der Kirche. Hier ist im Mauerwerk ein zugemauerter, ehemaliger Eingang mit seinem Rundbogen erkennbar.
Steinkreuz mit Blick in die weite Landschaft.
Bauernhof mit Eseln auf der Weide.
Esel - Ancy-le-Duc: südlich von Montceaux-l’Étoile gelegener kleiner Ort.
Informationstafel
Ehemalige Prioratskirche Sainte-Trinité: erbaut ca. 1090-1130. Länge 44,3 m. Die Krypta stammt allerdings aus dem 10. oder frühen 11. Jahrhundert. Die Gründung des Klosters reicht bis in die karolingische Zeit zurück. Der erste Prior des neuen Klosters, Hugo von Poitiers, starb, stand aber schon im Ruf der Heiligkeit. So wurde sein Grab Ziel zahlreicher Pilger. Eine neue Kirche sollte einen würdigen Rahmen für die Gebeine des Heiligen bieten.
Der Vierungsturm von weitem. Er ist achteckig und hat 3 Geschosse.
Die romanische Kirche ist eine Basilika mit 3 Schiffen und ein weit ausladendes Querschiff. Westfassade und der Durchgang zum, von einer Mauer umgebenen ehemaligen Priorat, von dem noch Gebäudereste erhalten sind.
Westportal: Im Tympanon Christus in einer von Engeln gehaltenen Mandorla. Im Türsturz darunter die 12 Apostel und Maria.
In der leider stark beschädigten Archivolte und in den Kapitellen darunter, sieht man die 24 Ältesten der Apokalypse, die dem wiederkehrenden Christus Ehre erweisen.Auf dem Weg zur Nordseite der Kirche kommt man an einem alten Brunnen vorbei.
Nordseite der Kirche, die einen Staffelchor mit 5 Apsiden besitzt.
Vierungsturm
Die Kragsteine unter dem Dach sind mit menschlichen und tierischen Darstellungen verziert. Zum Beispiel ein bärtiges Monster aus dessen Nase Ranken wachsen und ein Blattmotiv.
Oder ein Mann der einen Tonkrug hält, eine Fratze und eine Person mit langen Hörnern einer Ziege.
Inneres:Blick in das Langhaus mit den beiden Seitenschiffen Richtung Hochaltar. Hier sieht man den Versuch der Baumeister im 11. Jahrhundert, statt eines Tonnengewölbes, ein Kreuzgratgewölbe zu verwenden, was auch höhere Fenster ermöglichte. Länge des Langhauses 24 m, Breite incl. der Seitenschiffe 13,2 m. Die Pfeiler, Bögen und Wände sind verputzt und teilweise noch mit älteren Fresken versehen. Es gibt aber auch jüngere Malereien. Hinter dem Kruzifix oben vor der Vierung, befand sich mal ein Fenster, welches zugemauert wurde.
3 Kapitelle in der Vierung. Die Kapitelle im Langhaus sind von besonderer künstlerischer Bedeutung. Ein Kapitell zeigt Tiere, evt. Löwen.
Blick von der Vierung auf die Apsis mit dem Hochaltar.
In den Apsiden befinden sich Fresken aus dem 12. Jahrhundert, die im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurden. In der Hauptapsis sieht man Christus in der Mandorla, die von zwei Engeln gehalten wird. Darunter stehen die 12 Apostel und 3 Frauen. Unter einem dunklen Band sieht man die die Evangelistensymbole.
Kapitell mit Atlanten, rechts von der Hauptapsis.
Rechts von der Hauptapsis, eine weitere Kapelle, die ganzflächig mit Fresken bemalt ist, die Szenen mit verschiedenen Heiligen darstellen.
Zwischen der Hauptapsis und der linken Kapelle, befindet sich wieder eine Säule, deren Kapitell Atlanten darstellt.
Links von der Hauptapsis, eine weitere Kapelle, die ganzflächig mit Fresken bemalt ist, die Szenen mit verschiedenen Heiligen darstellen.
Auf dem Altar eine Statue des Heiligen Abdon mit einem Löwen. Abdon war ein persischer Märtyrer aus der Zeit um 250 n. Chr. Er sollte in der Arena in Rom durch Löwen getötet werden. Da dies nicht gelang, mussten ihn Gladiatoren enthaupten.
Blick nach Westen mit der rechteckigen Öffnung für das Westportal. Es sitzt in einer rundbogigen Nische. In der Höhe des Türsturzes ist ein Flachrelief mit Bändern und Blattranken angebracht.
Blick in ein Seitenschiff.
Blick von einem der Seitenschiffe in das Langhaus.
Detail eines Kapitells mit Ringkämpfern mit Bärten.
Blick von einem der Seitenschiffe in das Langhaus.
Detail eines Kapitells in dem ein Engel mit Schild und Schwert mit Monstern kämpft.
Einige weitere der kunsthistorisch bedeutsamen Kapitelle: Köpfe von Menschen und Tieren, Mensch mit zwei Oberkörpern und Flötenspieler, Löwen und Köpfe von Menschen, Pflanzen werden mit Wasser aus Füllhörnern gegossen, Vögel, Löwen, Mensch und zwei Schlangen, Menschen und Tiere, Daniel in der Löwengrube.
Weitere kleine Apsiskapelle mit einer Herz-Jesu-Statue. Die Wandmalereien stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Krypta: erst durch Grabungen konnte der Zugang zur Krypta im nördlichen Querschiff wieder gefunden werden. Wahrscheinlich stammt sie noch aus dem 10. Jahrhundert und diente als Grablege des Heiligen Hugo von Poitiers.
Das ehemalige Priorat ist von einer Mauer umgeben. Hier haben sich noch einige Gebäude erhalten.Landkarte von Burgund, südlich von Paray-le-Monial, in der sich zahlreiche romanische Kirchen befinden.
- Baugy: der kleine Ort mit ca. 500 Einwohnern, liegt an der Loire, westlich von Ancy-le-Duc. Der Ort wurde erstmals im 6. Jahrhundert erwähnt. Der Name ist keltischen Ursprungs und bedeutet „sumpfiges Gelände“.
Alte Häuser aus Natursteinen in Baugy.
Église Saint-Pons: die romanische Kirche entstand in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts und gilt als eine der ältesten Kirchen des Brionnais. Sie ist dem Heiligen Pontius von Cimiez (ca. 210-257) geweiht. Die Kirche ist sehr schlicht aus dem typischen Kalkstein des Brionnais, als Bruchstein erbaut. Auf das Langhaus folgt eine halbrunde Apsis. Ein mächtiger, quadratischer Glockenturm wird durch einen Pyramidenhelm gedeckt.
Detail der Biforien (ein durch eine Säule geteiltes Fenster mit bogenförmigem Abschluss) im Glockenturm.
Chor und Glockenturm.
Verzierte Kragsteine unterhalb des Daches am Chor.
Südseite der Kirche.
Im Mauerwerk kann man hier noch ein zugemauertes südliches Portal erkennen.
Westfassade mit einem schlichten Portal mit Rundbogen und drei kleinen Fenstern. Der Eingang wird flankiert von 2 Säulen mit Kapitellen. Jeweils eine Reihe von Kugeln ist oberhalb von floralen Motiven angebracht und beim rechten Kapitell oberhalb von musizierenden Tieren, die Trompete, Cythera und Gambe spielen.Inneres:
Der Innenraum wurde im 19. Jahrhundert ausgemalt. Das Chorjoch ist von hohen Rundbogenarkaden eingefasst.
Konsole mit Blättern und einem Gesicht an der rechten Wand des Langhauses.
Blick in den Chor mit dem Altar. Dahinter 5 Rundbogenfenster mit Blendarkaden und teilweise figürlichen, bemalten Kapitellen.
Blick in die bemalte, achteckige Kuppel unter dem Glockenturm.
Detail von 2 bemalten Kapitellen im Langhaus.
Blick Richtung Westen zum Eingang.
Vor der Kirche ein Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges und ein Bücherschrank als Tauschbörse.Landschaft und Bauernhöfe im Tal der Loire. Charolais-Rinder auf der Weide.
Kleines historisches, gestreiftes Gebäude mit geschnitztem Giebel und einem Flachreflief aus Fayence mit dem Heiligen Martin am Giebel. - Saint-Martin-la-Vallée:
Informationstafel.
Erbaut gegen Ende des 11. Jahrhunderts, unterhalb des Hügels, auf dem sich die Festung von Semur entwickelte. Sie ist dem Heiligen Martin geweiht, der seit dem Mittelalter, bis in die heutige Zeit der populärste französische Heilige ist. Die Kirche war bis 1274 Pfarrkirche von Semur-en-Brionnais, bis ein Kanonikerstift im dortigen Ort diese Aufgabe übernahm. Die Kirche liegt beim alten Friedhof und hat einen an der Seite stehenden Glockenturm, etwas Einzigartiges im Brionnais. Der Turm hat auf allen Seiten Biforien.Skulptierte Kragsteine unter dem Dach vom Chor.
Inneres:
Informationstafel zur Restaurierung der Fresken, die 1999 begann.
Einschiffiges Langhaus mit halbrunder Apsis. Alle Fenster sind sehr schmal und stark nach innen abgeschrägt.
Die Wandmalereien stammen aus dem 12. bis 16. Jahrhundert.
Die Bemalung des Kirchenschiffs besteht aus zwei Malschichten, die teilweise unter der Tünche verborgen ist. An der Nordwand sieht man um die Fenster herum ein Dekor in rot, weiß und gelb aus dem 16. Jahrhundert und Weihekreuze.
An der Südwand rechts und links vom Zugang zur Privatkapelle, 2 Szenen, wovon eine als die Heilige Anna identifiziert wurde. Darunter wieder Weihekreuze.
Der Chor mit Malereien in der Apsis. Beim Borgen vor dem Chor, wurden im 12. Jahrhundert schlicht die Fugen zwischen den Steinen rot bemalt.
Oben in der Apsis, aus dem 16. Jahrhundert ein Bildnis von Christus, umgeben von den Evangelistensymbolen.
Darunter die Prozession der Apostel, angeführt von Petrus.
In der Mitte im unteren Bereich Maria mit dem Kind unter einem Baldachin.
Von der an der Seite liegenden Privatkapelle eine Leiter hoch in den Glockenturm.
Blick durch das Langhaus zum Eingang im Westen. - Semur-en-Brionnais: kleiner Ort mit ca. 700 Einwohnern, der auf einer kleinen Anhöhe, 6 km östlich der Loire liegt.
Informationstafel.
Das Schloss von Semur-en-Brionnais, wurde vom 10. bis 18. Jahrhundert erbaut. Erhalten blieben zwei quadratische Türme zur Verteidigung des Eingangs, aus dem 10. Jahrhundert. Das Schloss mit seinen Verteidigungsanlagen war Symbol der Macht der Herren von Semur. Einer seiner Söhne, Hugues (1024-1109), war Großabt von Cluny und maßgeblich an der Ausbreitung des Ordens von Cluny beteiligt. Außerdem gilt er als Initiator des Baus der Kirche Sacré-Coeur von Paray-le-Monial. Die Familie Semur ist mit dem Adel von Burgund und den Königen von Frankreich verwandt.Jahrelang wurde das Gebäude auch als Gefängnis genutzt, später dann als Steinbruch. Zum Glück konnte das dann unterbunden werden und teilweise wiederhergestellt werden.
Altes Haus mit einer historischen Wasserpumpe, einer Wipppumpe aus dem 19. Jahrhundert.
Rathaus. Rechts am Bildrand sieht man das Hôtel Précy, im 18. Jahrhundert erbauter Sitz der Familie Précy.
Église Saint-Hilaire:
Informationstafel.
Die ehemalige Kollegiatsstiftkirche wurde im 12. Jahrhundert erbaut und ist einer der spätromanischen Bauten im Brionnais. Sie ist dem Heiligen Hilarius von Poitiers (Hilarius, Pictaviensis) (ca. 315-367) geweiht.
Sie ist eine dreischiffige Basilika mit einem Langhaus mit 4 Jochen, einem nicht weit herausragenden Querschiff und einem Chor mit 3 Apsiden.
Blick auf den Chor mit seinen Apsiden, dem Querschiff. Der Giebel der Mauer, die das Chorjoch abschließt, hat eine Zwillingsarkade und ein rundes Fenster. Der achteckige Turm auf der Vierung hat 2 reich gegliederte Stockwerke.
Details vom Vierungsturm.
Kapitell eines Strebepfeilers an der Chorapsis.
Südseite der Kirche mit schlanke rundbogigen Fenstern. Auf beiden Seiten kleine Säulen mit pflanzlich dekorierten Kapitellen.
Südportal im 3. Joch. Es ist recht schlicht gestaltet. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich hier einmal die Klostergebäude befunden haben.
Skulptierte Kragsteine unter dem Dach der Südseite.
Nordseite der Kirche. Diese Seite wies zum öffentlichen Raum des Ortes. Daher ist das Nordportal üppiger dekoriert als das Südportal, allerdings ohne figürlichen Schmuck. Es befindet sich beim 4. Joch, direkt neben dem Querschiff. Das Bogenfeld ist mit einem Flachrelief in Form eines Dreipasses dekoriert.
Skulptierte Kragsteine unter dem Dach der Nordseite.Westfassade: Die dreigeteilte Fassade hat einen leicht vorspringenden Mittelteil, der im oberen Bereich ein großes Rundfenster hat.
Das Westportal ist reich geschmückt. Säulen und Archivolten sind von kleinteiligen geometrischen Mustern überzogen. Schlanke Säulen flankieren das Portal, die äußeren sind spiralförmig gedreht, die inneren mit Blumenrosetten bedeckt.
Türsturz und Tympanon zeigen detaillierten figuralen Schmuck. Den äußeren Rahmen des Portals bildet ein rechteckiger Pilaster, der mit Flechtwerk überzogen ist. Im Scheitel sieht man das Relief des Lamm Gottes.
Der Türsturz zeigt Reliefs mit der Geschichte des Heiligen Hilarius. Links steht Bischof Hilarius von Poitiers mit seinen Schriften über die Trinität in der Hand. Auf einer Empore sitzen seine Widersacher, die Hilarius einen Sitz verweigern. Darauf erhebt sich wunderbarerweise der Boden: Im Zentrum kauert der Bischof Hilarius auf dem erhöhten Boden mit einer Mitra auf dem Kopf und wird von einem Engel mit Weihrauch beräuchert. Ganz rechts sieht man den häretischen Papst Leo, der auf dem Latrinenstuhl seine Seele aushaucht. Die kleine aus dem Mund herausfahrende Figur wird sogleich von mehreren Teufeln ergriffen. Die Geschichte vom Papst Leo, der gegen Bischof Hilarius kämpft und auf der Latrine verstirbt, beruht auf einer Verwechselung mit Hilarius von Arles, dem Widersacher von Papst Leo I. Aber die betonte Plastizität der Reliefs ist erst eine Errungenschaft des 12. Jahrhunderts. Man datiert die Schaffung des Türsturzes auf die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts eingestuft, wegen der lebhaften Ausdrucksstärke der Reliefs. Zu dieser Zeit ging die romanische Kunst in Burgund bereits ihrem Ende zu.
Im bereits leicht spitzbogigen Tympanon thront Christus in der Mandorla, die von 2 Seraphim gehalten wird. Ihn umgeben die geflügelten Evangelistensymbole.
Säulen auf der rechten Seite des Portals.
Kapitell und Kragstein auf der linken Seite der Portalöffnung.
Kapitell und Kragstein auf der rechten Seite der Portalöffnung.
Inneres:
Blick in das dreischiffige Langhaus.
Blick in das Gewölbe des Langhauses.
Zum Chor und zu den Seitenschiffen haben die Bögen bereits Spitzen.
Rundbogenfenster im Obergaden, darunter ein Triforium mit Arkaden mit doppelten Säulen.
Blick Richtung Hochaltar, kurz vor der Vierung.
Blick auf die Seitenwand mit Fenstern im Obergaden und Triforium.
Details eines Kapitells.
Blick hoch in die Vierungskuppel, die eine Spitztonne ist und den oktogonalen Vierungsturm trägt.
Hauptapsis mit dem Hochaltar.
Blick Richtung Westen zum Eingang. Über dem Westportal ist eine Tribüne (Michaelskapelle), die eine Miniaturkopie der gleichen Kapelle in der Abteikirche von Cluny III darstellt.
Blick vom nördlichen Seitenschiff in das Langhaus.
Apsis rechts vom Hochaltar mit einer Herz-Jesu-Darstellung.
Kapitell links neben dieser Apsis mit dem Teufel als Atlant.
Blick vom südlichen Seitenschiff Richtung der Chorapsiden.
Apsis links vom Hochaltar mit einer Statue der Maria.
Kapitell rechts neben dieser Apsis mit einem Atlant.
Mit Gitter abgesperrter Bereich mit historischen Ausstattungsstücken.
Informationstafel dazu.
Weitere Kapitelle in der Kirche.
Die Kirche ist nur durch eine schmale Gasse von umgebenden Gebäuden getrennt.
Dem Westportal gegenüber liegen historische Wirtschaftsgebäude, teilweise mit großen Rundtürmen, der Prieuré Saint-Hugues.
Auf der Nordseite das Hauptgebäude der Prieuré Saint-Hugues. Erbaut 1830. Seit 1992 ist hier das Priorat der Apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes untergebracht.
Bauernhäuser mit Charolais-Rindern auf der Weide. - Saint-Martin-du-Lac: kleiner Ort am Ostufer der Loire, 27 km südlich von Paray-le-Monial, mit weniger als 300 Einwohnern. Informationstafel zur Lage der romanischen Kirchen. Saint-Martin-du-Lac liegt links unten.
Kirche Saint-Martin:
Informationstafel zur Kirche Saint-Martin
Umum 1100 errichtete romanische Pfarrkirche. Aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammen Chor, Apsis und der Turm. Das Langhaus wurde im 19. Jahrhundert neu errichtet. Vor der Kirche steht ein Kreuz aus Stein. Hinter der Kirche ein Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Bauernhaus - Iguerande: Ort am Ostufer der Loire gelegen mit ca. 1000 Einwohnern, 34 km südlich von Paray-le-Monial. Die hügelige Umgebung war bis in das 19. jahrhundert vom Weinbau geprägt, der allerdings durch die Reblauskrise beendet wurde. Heute sind vor allem die Charolais-Rinder typisch für die Gegend.
Blick von dem Hügel auf dem die Kirche steht in den Ort und die dahinter fließende Loire.
Schafe auf der Weide.
Monument Notre Dame de la Paix
Église Saint-André oder Saint-Marcel:
2 Informationstafeln. Iguerande liegt auf der Landkarte unten links.
Erbaut im späten 11. Jahrhundert. Heute ist die Kirche Saint-Marcel geweiht. Südseite der sehr kompakt wirkenden Kirche mit einem nahezu quadratischer zweigeschossiger Vierungsturm. .
Detail des Vierungsturms.
Blick von Osten auf den Chor mit 3 Apsiden und links der im 19. Jahrhundert angebauten Sakristei.
Detail des Vierungsturms von Osten.
Skulptierte Kragsteine, meist mit Darstellungen von Tieren.
Westfassade mit Portal, mit einem schlichten Rundbogen. 2 Säulen mit Kapitellen flankieren den Eingang.
Detail der Kapitelle, die u.a. Granatäpfel zeigen, ein Symbol der Unsterblichkeit.
Inneres:
Blick durch das Langhaus Richtung Chor und Altar. Es handelt sich um eine Hallenkirche, da das Mittelschiff keine eigenen Fenster (Obergaden) besitzt. Das Langhaus ist innen 16,10 m lang und etwa doppelt so breit wie die Seitenschiffe. Das Mittelschiff wird von einer Rundtonne geschlossen, die Seitenschiffe hingegen von einem Kreuzgratgewölbe.
Blick in den Chor mit 3 Apsiden. Das Joch vor dem Chor ist im Gewölbe und an den Bögen mit floralen Mustern bemalt.
Blick in das Chorjoch von Süden.
Detail eines Kapitells mit Blättern und Blüten.
Detail des Chorjochs mit bemalten Bögen und einem weiteren Kapitell.
Detail des Kapitells mit Löwen.
Chorapsis mit 3 Rundbogenfenstern, Blendarkaden auf einem Sockel. In den beiden äußeren Arkaden haben sich Fresken erhalten, die die Apostel Petrus und Paulus darstellen.
Detail des Freskos mit Petrus.
Detail des Freskos rechts mit Paulus. Diese Seite der Chorapsis ist durch den Anbau der Sakristei stark gestört, der untere Teil von Paulus durch die Tür zur Sakristei zerstört.
Blick durch das Langhaus Richtung Eingang im Westen.
Blick durch das Mittelschiff auf das südliche Seitenschiff.
Blick vom Querschiff durch das nördliche Seitenschiff Richtung Westen.
Blick vom Eingang durch das südliche Seitenschiff.
Blick vom Eingang durch das Mittelschiff in das nördliche Seitenschiff.
Pfeiler und 2 Kapitelle.
Details weiterer Kapitelle. - Am Ufer der Loire, Weiden mit Charolais-Rindern.
- Charlieu: eine Stadt mit ca. 4000 Einwohnern. Sie lag an der Via Lemovicensis, einer der Hauptrouten des Jakobswegs. Davon profitierte der Ort und die Abtei, da sie häufig Station für Pilger war. Da die Stadt an der Grenze zu Burgund lag, wurde sie unter den Schutz der französischen Könige gestellt. König Philipp II. (1165-1223) ließ die Stadt 1180 befestigen. Handel und Handwerk blühten und so konnte sich die Stadt im 13. Jahrhundert den Bau der Kirche Saint-Philibert leisten.
Saint-Philibert: 1238 erstmals urkundlich erwähnt. Der Chor entstand im Stil der burgundischen Gotik, das Langhaus mit Mittel- und Seitenschiffen stammt vom Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts. Noch später wurden sie Seitenkapellen angefügt. Sie stammen aus der Zeit Ende des 15. Jahrhunderts und aus dem 16. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurde die Fassade angefügt und die Kirche um 2 Joche verlängert.
Informationstafel mit Grundriss.
Westfassade am Place Saint-Philibert.
Kleine Straße direkt neben der Kirche mit alten Fachwerkhäusern.
Links der Kirche die Rue Charles de Gaulle mit alten Häusern und der Nordseite des gotischen, rechteckigen Chores, dem ältesten, noch erhaltenen Teil der Kirche.
Details von Wasserspeiern in der Form von Tieren.
Inneres der Kirche:
Blick in das Langhaus Richtung rechteckigem Chor.
Erste Seitenkapelle auf der rechten Seite mit dem Sankt-Joseph-Altar in neugotischen Stil und farbigem Glasfenster mit 3 Heiligen.
Farbige Glasfenster
Neugotischer Seitenaltar mit Statue von Christus, flankiert von knienden Engeln.
Die letzte Seitenkapelle auf der rechten Seite mit der Tür zur Sakristei. Statue von 1931 der Sainte Anne von Bérola. Darunter ein Retabel aus dem 15. Jahrhundert, aus mehrfarbigem Stein mit der Darstellung der Heimsuchung Marias und der Geburt Jesu. Rechts eine Statue von Saint-Philibert, links von Saint-Honoré.
Blick von Osten durch das Mittelschiff auf das südliche Seitenschiff und die daran angrenzenden Seitenkapellen.
Blick von Hochaltar nach Westen zum Eingang und der Orgel auf der Orgelempore. Rechts eine steinerne Kanzel aus dem 15. Jahrhundert.
Chorgestühl aus dem 15. Jahrhundert, geschnitzt und bemalt mit Figuren von Heiligen.
Informationstafel zum Glockenspiel und der Orgel der Kirche.
Fachwerkhaus am Place Saint-Philibert.
Fachwerkhaus.
Historische Häuser in der Rue Chanteloup mit kleinen Läden.
Fachwerkhaus.
Kleine Strassen und Gassen mit historischen Häusern.Klosterkirche Charlieu oder Saint-Fortunat: Die ehemalige Abtei war zunächst in karolingischer Zeit ein bischöfliches Kloster, gegründet ca. 870-875 von Bischof Robert von Valence. Ca. 930-940 wurde es der Abtei von Cluny unterstellt und wurde damit eine cluniazensische Benediktinerabtei. Sie liegt an der Kreuzung zweier wichtiger Straßen und wurde ca. 872 von Bischof Ratbert von Valence gegründet. Nach mehreren Vorgängerkirchen entstand im Laufe des 11. Jahrhunderts eine neue Kirche, die 1094 geweiht wurde. Nach der französischen Revolution wurde 1793 die Kirche bis auf den Narthex und ein Joch abgebrochen.
Informationstafeln zur Geschichte der Abtei.Vorhalle, Narthex der Kirche: Der Eingang zur Vorhalle, befindet sich aus Platzmangel auf der Nordseite. Die Fassade wurde 1989-1990 restauriert. Hierbei wurden Silikonsegmente zum Schutz der Fassade eingefügt. Die Dekoration stammt aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts.
Links daneben sieht man etwas von den 1926 begonnenen Ausgrabungen, die die Fundamente der beiden Vorgängerkirchen freigelegt haben und einen runden Turm der Stadtbefestigung, genannt Philippe Auguste Turm. Hinter den Grundmauern der früheren Kirchen sieht man Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Klosters und die Priorkapelle mit dem kleinen Turm auf dem Dach.
Philippe Auguste Turm wurde 1180 erbaut. Davor ein Denkmal für die Gefallenen des 2. Weltkrieges.
Blick auf die Grundmauern der ehemaligen romanischen Klosterkirche. Dahinter Wirtschaftsgebäude und die kleine Priorkapelle. Da wo das Dach höher wird, befand sich der Kapitelsaal mit dem dann rechts anschließenden Kreuzgang hinter der Mauer.
Fassade des Narthex: Große Öffnung mit gestuftem Gewände und reich verzierten Säulen. Ganz oben am Rundbogen das Lamm Gottes.
Im Tympanon Christus in der Mandorla, umgeben von den Evangelistensymbolen. Während der Revolution wurden viele Figuren beschädigt.
Auf dem Türsturz in der Mitte Maria, flankiert von Engeln und den 12 Aposteln. Es haben sich noch wenige Farbreste erhalten. Links am Türsturz Boso (ca. 825-887), der König von Niederburgund.
Rechts am Türsturz Bischof Robert und daneben Johannes der Täufer in seinem Schaffell.
Neben dem Durchgang ein Rundbogenfenster mit der Hochzeit von Kanaan im Tympanon. Im Türsturz Darstellung von Tieropfern. Im Rundbogen von links nach rechts: Heiliger Jakobus, Heiliger Johannes, Christus, Moses, Prophet Elias und Apostel Petrus mit dem Schlüssel.
Kapitelle rechts und links der Fensteröffnung.
Oberhalb des großen Durchgangs ein weiteres Rundbogenfenster.
Blick in das Innere der Vorhalle mit Kreuzgratgewölbe und dem Zugang zum Kreuzgang.
Detail des Grabdenkmals aus Marmor.
Durchgang vom Kreuzgang in den Narthex.
Westportal der ehemaligen romanischen Kirche. Dieses Portal verband den ca. 40 Jahre später angebauten Narthex mit dem Langhaus der Kirche. Der Rundbogen ist schlicht gestaltet. Nur Tymponon und Türsturz zeigen ein flaches Relief. Im Tympanon Christus in der Mandorla, die von zwei Engeln getragen wird. Es entstand kurz vor 1094 und ist damit eines der ersten großformatigen Bildhauerarbeiten in der burgundischen Kunst. Auf dem Türsturz sind die 12 Apostel in Blendarkaden dargestellt. Alle Gesichter der Personen sind zerstört.
Von hier aus hat man einen Blick auf die Grundmauern der Vorgängerkirchen und auf den Turm der Stadtbefestigung, den Philippe Auguste Turm.
Man steht jetzt im ersten Joch der ehemaligen Kirche, dreht man sich um schaut man auf die Westwand der ehemaligen Kirche mit romanischen Kapitellen. Sie zeigen Sirenen, andere Mischwesen und florale Motive.Blick auf die Reste des ersten Jochs der ehemaligen Kirche von außen, direkt neben dem Narthex.
Detail eines Kapitells am ersten Jochbogen mit Löwen und Köpfen von Menschen.
Weitere Kapitelle, deren Motive noch die Eintracht zwischen Heidentum und dem frühen Christentum zeigen. Daniel in der Löwengrube, Sirenen, Mischwesen aus Ziege und Fisch, Akrobaten, streitende Zentauren und die Jakobsmuschel als Symbol für die Pilger, die hier Rast machten.
Die westliche Seite des Narthex von außen.
Ein doppeltes Rundbogenfenster.
Die ehemalige Abtei ist heute ein Museum.
Kreuzgang:
Der nicht ganz rechtwinklige gotische Kreuzgang, stammt aus dem 13. Jahrhundert und lösten den ursprünglich romanischen Kreuzgang ab. Die Arkaden zum im Inneren liegen Klostergarten zeigen Maßwerk mit Dreipässen.
Blick in die Westgalerie.
Blick auf die Westgalerie mit dem in der Mitte liegenden Trinkwasserbrunnen. Dahinter der zweigeschossige Narthex.
Südgalerie mit Blick über den Klostergarten Richtung Ostgalerie.
Im Osten haben sich noch einige Räume des Klosters erhalten.
Zugang zum Kapitelsaal, der sich fast in der ganzen Breite zum Kreuzgang hin, mit rundbogigen, romanischen Arkaden präsentiert. Kleine Zwillingssäulen tragen skulptierte Kapitelle.
Detail von Kapitellen am Kapitelsaal.
In der östlichen Außenwand des Kapitelsaals, befindet sich ein breites rundbogiges Fenster. Wahrscheinlich befand sich oberhalb des Kapitelsaals das Dormitorium, der Schlafsaal der Mönche.
Betritt man den Kapitelsaal, fällt der Blick auf die sich geradezu öffnende Priorkapelle aus dem 15. Jahrhundert. Die Tür rechts führt in den Wirtschaftshof des Klosters. Dort befindet sich auch das Haus des Priors.
Blick von der Priorkapelle zurück in den Kreuzgang.
Kapitelsaal mit vier gotischen Kreuzrippengewölben, die sich in der Mitte auf einer Säule treffen.
Detail eines Kapitells
Blick vom Kapitelsaal auf den Kreuzgang.
Ehemaliges Parlatorium: Es war der Raum, in dem die Mönche, zeitlich begrenzt, von ihrem Schweigegelübde entbunden waren. Es befindet sich direkt neben dem Kapitelsaal und wird von 2 Kreuzrippengewölben überdeckt. Heute befinden sich hier steinerne Ausstellungsstücke des Museums, es ist also zum Lapidarium geworden.
Relief in dem ein Löwe mit Krone ein Lamm ergreift.
Romanisches Relief aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts. Es zeigt die Verkündigung und zwei Heilige.
Weitere Fragmente aus Stein, Reliefs, Kapitelle und Konsolen.
Jungfrau mit Vogel und Kind aus dem 15. Jahrhundert aus Eichenholz.
Blick von der Ostgalerie auf die Westgalerie mit dem Brunnen.
Blick von der Nordgalerie auf die Südgalerie. Im Süden befand sich eventuell das ehemalige Refektorium, der Speisesaal der Mönche.
Wirtschaftshof des ehemaligen Klosters. Durch die Tür in der Priorkapelle betritt man den Hof in dem ein Brunnen steht. Hinter dem großen Tor sieht man den Philippe Auguste Turm.
Dreht man sich um, steht man direkt vor dem Haus des Priors, erbaut Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts. Rechts und links schließen sich Wirtschaftsgebäude an.
Eingangsportale zu den beiden Türmen. Oberhalb der Tür Flachreliefs mit Wappen.
Das Haus des Priors von außerhalb des Klostergeländes gesehen.
Weg mit alten Häusern in der Nähe des Franziskanerklosters.
Couvent des Cordeliers:
Grundriss des ehemaligen Klosters.
Franziskanerkloster außerhalb der Altstadt von Charlieu. Das im 13. Jahrhundert gegründete Cordeliers-Kloster ist eines der wenigen erhaltenen mittelalterlichen Franziskanergebäude in Frankreich. Um 1250 standen die Bürger von Charlieu im Konflikt mit den Benediktinern. Da kamen die Franziskaner in die Stadt und Papst Alexander IV. (1199-1261) erlaubte ihnen die Gründung eines Klosters in der Stadt. Die Benediktinermönche lehnten dies strikt ab und so gab es sogar einen Angriff auf das Lager der Franziskanermönche. Daraufhin wurde sogar der Abt des Klosters Cluny exkommuniziert. Letztendlich zwang Papst Nikolaus III. (ca. 1212-1280) die Benediktiner, ein zweites Kloster in Charlieu zu akzeptieren. Es wurde dann etwas außerhalb in Saint-Nizier-sous-Charlieu 1280 mit dem Bau begonnen.
Während des Hundertjährigen Krieges wurde fast das ganze Kloster zerstört. Nach der Zerstörung im Jahr 1362, nutzten die Franziskaner die eingekehrte Ruhe und die zuströmenden Spenden, um es wieder aufzubauen. Auch während der Religionskriege im 16. Jahrhundert, führen ständige Überfälle dazu, dass das Kloster verlassen wird. Endgültig aufgelöst wird es allerdings erst nach der französischen Revolution. 1910 wird das Klostergelände an einen Pariser Antiquitätenhändler verkauft. So beginnt der stückweise Verkauf der historischen Bausubstanz an Amerikaner, die damit ihre Tennisplätze dekorieren wollen. Dem Eingreifen der Gesellschaft der Freunde der Künste von Charlieu gelingt es, die Reste der Bausubstanz unter Denkmalschutz zu stellen und damit den Verkauf zu stoppen.Blick auf die Kirche und den „Bibliothek“ genannten Bau aus dem 16. Jahrhundert. Es ist einer der wenigen Reste der früheren Klostergebäude. Eingang zu dem zweigeschossigen Bau.Gotischer Kreuzgang aus dem späten 14. Jahrhundert, in dem sich eine Vielzahl von skulptierten Kapitellen erhalten hat. Der Wiederaufbau des Kreuzgangs zwischen 1370 und 1410 wurde größtenteils von der Familie Châteaumorand finanziert. Nach der Revolution verdankt es seine Erhaltung der Umwandlung in ein Wohnhaus und einen Garten. Die Kapitelle der nördlichen Galerie zeigen eine Reihe von Figuren und Tiere oder Szenen aus der antiken Mythologie.
In der Mitte des Hofes ein rundes Wasserbecken. Dahinter die Reste der schlichten einschiffigen Kirche.
Zahlreiche Kapitelle
Wasserspeier
Reste eines Reliefs mit einem Wappen.
Ein Bogen, wie ein Dreipass innerhalb des Kreuzgangs.
Kirche: Der schlichte einschiffige Kirchenbau aus dem 14. Jahrhundert, ist von einem offenen hölzernen Dachstuhl gedeckt. Blick durch das Kirchenschiff Richtung Westen, auf die südliche Kapelle.
Reste von Wandmalereien, die Mauerwerk und Fugen imitieren, an der südlichen Wand.
Blick in den Chor mit Apsis.
Wandmalereien im Chor, aus dem 14., 15. und 16. Jahrhundert.
Die Malereien zeigen gotische Baldachine mit Figuren darunter.
Oben 2 Engel, die ein Wappen halten.
Links unter einem Baldachin kann man Maria mit dem Christuskind erahnen.
Blick in den Dachstuhl über dem Chor.
Vom Chor nach Süden geht die Kapelle Châteaumorand ab, mit dem Grabmal eines Ehepaares und einem Wappen über der Grabplatte mit lebensgroßen liegenden Figuren. Zu den Füßen der zum Teil zerstörten Figuren die Wappentiere.
Blick in den riesigen Dachstuhl Richtung Westen.
Das Kirchenschiff Richtung Westen.
Die südliche Kapelle mit Kreuzrippengewölbe. - Charollais-Rinder und durch Hecken begrenzte Weiden in hügeliger Landschaft.
- Varenne-l’Arconce: kleiner Ort mit etwas über 100 Einwohnern, 15 km südlich von Paray-le-Monial. 976 erstmals urkundlich erwähnt. Haus aus Natursteinen.
Église Saint-Pierre-aux-Liens: der Ort und die Pfarrei gehörten seit 1094 zum cluniazensischen Priorat und das Kloster war von 1130 bis zu seiner teilweisen Zerstörung in direkter Abhängigkeit von der Abtei Cluny. Die romanische Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die Klostergebäude existieren nicht mehr, da sie während des Hundertjährigen Krieges und den Religionskriegen zerstört wurden. Die Kirche ist dem heiligen Petrus in Ketten geweiht.
Informationstafel
Blick auf die Kirche von Nordosten. Die romanische Kirche ist weitestgehend im Originalzustand erhalten. Dreischiffig mit einem stark ausladenden Querschiff und einer halbrunden Apsis, der ein Chorjoch vorgelagert ist. Auf der Vierung ein Turm.
Auf der Nordseite ist eine kleine Sakristei angebaut.
Blick von Osten auf den Chor.
Skulptierte Konsolen unterhalb des Daches der Apsis.
Vierungsturm mit pyramidalem Dach. Auf allen Seiten von vorgelagerten Halbsäulen umgeben. In zwei Etagen mit Rundbogenarkaden. Das oberste Geschoss wurde im 19. Jahrhundert von dem Architekten Tony Selmersheim (1871-1971) in neuromanischen Formen erneuert.
Südseite der Kirche.
Südportal mit Lamm Gottes im Tympanon. Dieses schlichte Portal diente den Mönchen zum Betreten der Kirche, da es den ehemals vorhandenen Klostergebäuden zugewandt lag.
Westfassade: Im vorspringenden Mittelrisalit ist das Westportal mit Rundbögen. Das Tympanon ist ohne Relief. Im Geschoss über dem Portal, ein Gesims und ein Rundbogenfenster mit kannelierten Pilastern. Ganz oben im Giebel sieht man noch ein kleines Rundbogenfenster.
Inneres:
Blick in das dreischiffige Langhaus. Das Mittelschiff ist nicht durch eigene Fenster beleuchtet, daher handelt es sich um eine Hallenkirche. Mittelschiff und Seitenschiffe sind durch Spitzbogenarkaden getrennt. Spitztonnengewölbe decken das Mittelschiff, die Querschiffe und den Chor. Die Seitenschiffe sind durch Kreuzgratgewölbe bedeckt.
Blick nach Osten in den Chor.
Die Apsis ist mit einer Halbkuppel überwölbt. Hinter dem Altar sieht man eine fünfteilige Rundbogenarkatur mit skulptierten Kapitellen, aber nur 3 Fenstern.
Blick nach Westen zum Eingang. Neben dem Rundbogenfenster über dem Eingangsportal befinden sich 2 Biforien mit skulptierten Kapitellen.
Blick von Westen in das südliche Seitenschiff.
Detail des Kapitells an der ersten Säule.
Blick vom südlichen Seitenschiff durch das Mittelschiff, auf die Vierung und das nördliche Querschiff.
Altar im südlichen Seitenschiff mit Bildnis von Maria mit dem Jesuskind und einer Herz-Jesu-Darstellung.
Erstes Joch des nördlichen Seitenschiffs.
Blick durch das nördliche Seitenschiff.
Spärliche Reste einer Wandmalerei in dem ansonsten in recht schlechtem Zustand befindlichen Innenraum.
Kapitelle mit Vögeln, Kentauren und Fabelwesen.Brücke über den kleinen Fluss Arconce, Bauernhof und Weiden.
- Poisson: Ort mit ca. 600 Einwohnern in der Nähe von Paray-le-Monial.
Lachender Baumstamm mit Eule, geschnitzt vor einer Landkarte.Église Saint-Jean-Baptiste: Kirche aus dem 19. Jahrhundert, im neuromanischen Stil. Der Glockenturm stammt noch aus dem 16. Jahrhundert.
Blick auf die Nordseite der Basilika mit 3 Schiffen, einem Querschiff und einem Turm über der Westfassade.
Blick auf den Chor
Blick auf die mit Blendarkaden versehene Südseite der Kirche.
Westseite mit einem Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege davor.
Westfassade mit Rundbogenportal, flankiert von jeweils 3 kleinen Säulen. Im Tympanon Christus in der Mandorla. Oberhalb des Portals eine kleine Fensterrose zwischen kannelierten Säulen.
Inneres:
Blick in das mit Kreuzgratgewölben gedeckte Mittelschiff. Kräftige Rundbögen trennen es von den Seitenschiffen. Über den Bögen Fenster.
Blick auf den Chor mit Hochaltar in der Apsis und 2 weiteren Apsiden.
Chorapsis mit 5 Rundbogenfenstern. Unterhalb der Fenster 3 lebensgroße Statuen von Christus zwischen 2 weiblichen Heiligen.
Blick vom südlichen Seitenschiff auf den Chor und die südliche Chorapsis mit Seitenaltar.
Blick durch das Mittelschiff Richtung Westen.
Farbige Glasfenster mit dem Heiligen Paulus, dem Apostel Petrus und dem heiligen Benedikt. - Charolles: Die Stadt mit ca. 3.000 Einwohnern, liegt an der Einmündung des Flusses Semence in die Arconce. Sie liegt etwa 12 km östlich von Paray-le-Monial. Charolles war die Hauptstadt der Grafschaft Charollais und es ist die Wiege der Charollais-Rinderrasse und gab ihr ihren Namen.
Blick von der Brücke über den Fluss Arconce. Hier mündet der Fluss Semence. In der Mitte eine schmale Landzunge, rechts ein Wehr und Häuser, die direkt am Flussufer stehen.
Blick über die Brücke in Richtung der Kirche Sacré-Coeur.
Blumenbeet auf der Brücke.
Wandmalerei als Werbung für eine Fleischerei mit Schinken, Würsten und Kopf eines Schweins.
Schmale Strasse
Häuser am Fluss
Orientalisch anmutender Ort als Dekoration in einer Garage, vielleicht Kulissen für kleines Puppentheater?
Sacré-Coeur oder Herz-Jesu-Kirche: 1862-1866 im neuromanischen Stil erbaut, nach Plänen des Architekten André Berthier (1811-1873). Sie war der Ersatz für die alte Kirche Saint-Nizier, die sich an der Stelle des heutigen Parkplatzes befand.
Entgegen der sonst üblichen Ausrichtung der Fassade nach Westen, zeigt diese Fassade nach Osten, um einen leichteren Zugang von der Stadt aus zu ermöglichen. Der Chor liegt im Westen. Die Fassade zeigt die drei-schiffige basilikale Gestalt der Kirche. 3 Rundbogenportalen, Blendarkaden und eine Fensterrose über dem größeren Hauptportal. Über der Fensterrose ein Glockenturm mit Biforien in der obersten Etage. Die Portale und Blendarkaden sind ohne skulptierte Dekoration, sehr schlicht gestaltet.
Blick auf den Turm über der Westfassade vorspringenden Fassade des Querschiffs mit Blendarkaden und 3 Rundbogenfenstern im Giebel.
Detail der Chorkapellen.
Blick von Südosten auf das Chorhaupt mit seinen Apsiden.
Inneres:
Blick in das Mittelschiff, welches mit Kreuzrippengewölbe gedeckt ist.
Mittelschiff und zwei Seitenschiffe. Blick Richtung Chor und Querschiff.
Blick von der Vierung auf den Hochaltar im Chor und den Chorumgang mit den Apsiskapellen.
Gewölbe in Chor, welches stilistisch eher an eine gotische Kirche erinnert. Fenster und Biforien darunter gestalten den halbrunden Chor.
Kapelle im Chorumgang mit modernem farbigen Glasfenster.
Blick vom Chorumgang über den Hochaltar durch das Mittelschiff zum Eingang.
Im südlichen Querschiff steht die 2016 eingeweihte Orgel.
Dachdecker auf der Plattform eines Krans, bei der Reparatur eines mit Holzschindeln gedeckten Daches.
Historische Gebäude am Place Baudinot.
Ehemaliges Klarissenkloster, in dem sich heute die Touristeninformation befindet. Im Mittelalter handelte es sich um ein bürgerliches Wohnhaus. 1632 lassen sich hier Klarissen nieder und richten auf der Galerie im Innenhof Zellen für Novizinnen ein. Hier empfing die Heilige Marguérite Marie Alacoque (1647-1690) ihre erste Kommunion. Sie war die Nonne mit den Herz-Jesu-Erscheinungen.
Blick in den Innenhof und zurück zum Eingang.
Durch die Rue Baudinot gelangt man zum Rathaus und der ehemaligen Festung.
Schloss Charles-le-Téméraire oder Schloss Charolles: Seit dem 10. Jahrhundert ist auf dem von 2 Flüssen umgebenen Felsvorsprung eine Burg belegt. Ab dem 15. Jahrhundert veranlassen die Herzöge zahlreiche Baumaßnahmen, um die Stadt weiter zu befestigen.
Durch einen überbauten Torbogen, neben einem runden Festungsturm, dem Tour de Diamant, gelangt man in den inzwischen als Garten angelegten ehemaligen Bereich des Schlosses.
Blick auf den Tour Téméraire.
Blick auf die Stadt Charolles, rechts der Turm der Kirche Sacré-Coeur.
Das weiße Gebäude auf dem Hügel ist das Krankenhaus von Charolles.
Informationen an der Aussichtsterrasse.
Alte Flak auf einer der Festungstürme.
Rosafarbene Kamelie.
Enge Straße
Landschaft mit Bauernhof und Weiden.
Frühlingsschlüsselblumen vor einer niedrigen Mauer mit Moos. - Gibles: der kleine Ort mit ca. 600 Einwohnern liegt ganz in der Nähe des 771 m hohen Mont Saint-Cyr.
Église Saint-Martin: 1854 erbaute neuromanische Kirche. Nordseite der dreischiffigen Kirche. Blick auf die Fassade des nördlichen Querschiffs und den Glockenturm über der Westfassade.
Südseite der Kirche und der Chor.
Westfassade mit Glockenturm und einem Rundbogenportal mit dem Heiligen Martin im Tympanon. Deutlich sieht man die beiden niedrigeren Seitenschiffe. Über dem Portal ein Fensterrose. Darüber Blendarkaden und im oberen Geschoss dem Turmes Biforien.
Detail der Fensterrose. Oberhalb rechts und links Flachreliefs von Fabelwesen mit eingerolltem Schwanz.
Detail des unteren Geschosses vom Turm mit 2 Rundbogenfenstern, die durch Säulen getrennt sind.
Detail des Eingangsportals mit dem Heiligen Martin im Tympanon. Flankiert von jeweils 3 Säulen mit floralen Kapitellen. Rote Türen mit schwarzen Beschlägen aus Metall.
Inneres:
Blick in das Mittelschiff, welches mit Rundbogenarkaden von den beiden Seitenschiffen getrennt ist. Die kräftigen Säulen tragen florale Kapitelle.
Oberhalb der Rundbogenarkaden Rundbogenfenster, die das Mittelschiff beleuchten.
Blick von der Vierung in den Chor mit dem Hochaltar und den beiden seitlichen Chorkapellen.
Detail des Chors mit dem Chorgestühl und den Rundbogenfenstern im Chor.
Hochaltar aus Stein. Im oberen Bereich unter Rundbögen die 12 Apostel.
Blick durch das Mittelschiff zum Eingang im Westen.
Über dem Eingang 2 Biforien, die ein zentrales Rundbogenfenster rahmen.
Detail des aus dunklem Holz geschnitzten Chorgestühls.
Kanzel aus dunklem Holz.
Detail des Kanzelkorbes.
Südlichen Seitenschiff mit skulptierten Kapitell mit Gesichtern.
Seitenaltar im südlichen Seitenschiff.
Nördliches Seitenschiff mit skulptierten Kapitell mit Vögeln.
Seitenaltar im nördlichen Seitenschiff mit einer bunten Statue der Maria mit dem Christuskind.
Direkt daneben ein Sarkophag mit gläsernen Wänden, der die Wachsfigur einer Nonne enthält.
Beichtstuhl aus Holz. - Bois-Sainte-Marie: kleiner Ort mit knapp 200 Einwohnern. Der Name des Ortes erinnert daran, dass der Ort früher einmal in einem Wald lag. Es gab ursprünglich eine Priorei, die im 16. Jahrhundert während der Hugenottenkriege (1562–1598) zerstört wurde. Im Mittelalter war der Ort von einer Stadtmauer mit drei Stadttoren umgeben. Wie man sieht, hat sich davon nichts mehr erhalten, nur die romanische Pfarrkirche aus dem 12. Jahrhundert.
Notre-Dame-de-la-Nativité: die im 12. Jahrhundert erbaute Kirche hat das Patrozinium Mariä Geburt. Mitte des 19. Jahrhunderts stand der Bau kurz vor dem Verfall und wurde von Eugène Louis Millet (1819-1879), einem Schüler von Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) restauriert.
Nordseite der Kirche, mit dem im Westen liegenden Eingang und Vierungsturm. Die Basilika hat 3 Schiffe mit einem Querschiff.
Blick von Norden auf den Chor mit Detail eines Kapitells, auf dem Engel dargestellt wurden.
Blick von Süden auf den Chor.
Details von zwei Kapitellen an der Außenseite des Chors mit Darstellungen von Personen und ein Kapitell mit Tierköpfen und Arkanthusblättern.
Blick von Süden auf die Vierung mit Turm und die Fassade des Querschiffs. Oben ein Rundbogenfenster mit rot-weißem Bogen und flankierenden kleinen Säulen. Vorgelagert ein wohl neuerer Anbau mit einer Fensterrose.
Blick auf die Südseite, das Südportal und die Vierung.
Mit Gesichtern verzierte Konsolen am Dach auf der Südseite.
Südportal mit der Flucht nach Ägypten aus dem 19. Jahrhundert im Tympanon. Im Brionnais war es üblich, dass das Südportal der Zugang für Eingeweihte der christlichen Dogmen vorgesehen war.
Information zum Portal
Weitere mit Gesichtern versehene Konsolen unterhalb des Daches.
Blick von der nordwestlichen Ecke auf die Westfassade mit der vorgelagerten Treppe.
Blick auf das Portal mit rot-weißem Rundbogen. Auf der vorgelagerten Treppe steht eine Statue von Maria von 1875.
Blick von der Treppe in eine enge Straße.
Details der Westfassade: Rundbogen mit flankierenden Säulen mit stark verwittertem Flachrelief von Maria mit dem Kind.
Details von 2 Kapitellen
Inneres:
Blick durch das mit einem Tonnengewölbe versehene Mittelschiff Richtung Chor. Leicht spitzbogigen Arkaden trennen das Mittelschiff von den Seitenschiffen. Dies zeugt vom cluniazensischen Einfluss auf die Architektur. Oberhalb befinden sich Fenster.
Blick in den Chor von der Vierung aus. Die halbrunde Apsis hat einen Säulenkranz mit Umgang, für das Brionnais eine einzigartige Architekturform. Darüber Rundbogenfenster.
Detail eines Kapitells in der Vierung mit Gesichtern und Köpfen von Tieren.
Säulenkranz in der Apsis mit dem dahinter liegenden Chorumgang mit Fenstern.
Blick von der Mitte des Chorumgangs über den Hochaltar, die Vierung durch das Mittelschiff Richtung Westen.
Blick vom Hochaltar in das sehr kurze, nördliche Querschiff mit einem Seitenaltar.
Blick in die flach gewölbte Kuppel der Vierung.
Blick durch das Mittelschiff auf das südliche Seitenschiff.
Detail eines Kapitells aus dem Mittelschiff mit der Darstellung der Höllenqualen.
Detail eines Kapitells aus dem Mittelschiff mit Greifvögeln.
Blick durch das, mit Kreuzgratgewölbe gedeckte, südliche Seitenschiff Richtung Chor. Rechts die offene Tür des Südportals
Inneres Tympanon mit einem Kreuz vom Südportal.
Beginn des südlichen Chorumgangs. Kreuzgratgewölbe und Rundbogenfenster, die von jeweils 2 Säulen flankiert werden.
Blick durch das, mit Kreuzgratgewölbe gedeckte, nördliche Seitenschiff Richtung Chor.
Detail eines Kapitells im nördlichen Seitenschiff mit floralen Motiven und Köpfen von Tieren.
Weitere Kapitelle: sitzende Tiere und Blätter, Fabelwesen, sitzende Menschen als Atlanten, kämpfende Männer mit Schilden, Vögel. - La Clayette: Ort mit ca. 2000 Einwohnern, 25 km südlich von Paray-le-Monial. Der Ort wurde 1435 von der Familie Chantemerle gegründet.
Église de l’Assomption de Notre-Dame: 1889-1894 im neugotischen Stil, nach Plänen von A. Rinchard, errichtete Kirche. Dreischiffig mit Querschiff und einem Chor.
Grundriss
Westfassade mit zentralem Glockenturm. Die Basilika hat 3 Portale mit Spitzbögen.
Oberhalb des mittleren Portals ein Geschoss mit Fenstern, die von Spitzbögen gerahmt sind. Darüber erhebt sich der Turm mit einem Geschoss für die Uhr und darüber Biforien.
Unteres Geschoss der Westfassade mit den 3 Portalen.
Tympanon des mittleren Portals (von 1925) mit der Marienkrönung. Im Türsturz der Tod Marias. Oberhalb der Archivolten ein Spruchband.
Linkes Portal von 1924: im Tympanon die Huldigung der gekrönten Maria mit Kind durch Jeanne d’Arc und den heiligen König Louis – Ludwig IX. von Frankreich. Im Türsturz die sitzenden Figuren von 8 Heiligen.
Rechtes Portal von 1924: im Tympanon hält Maria Jesus über ihren Kopf, der die Gläubigen mit ausgebreiteten Armen grüßt. Im Türsturz kniende Personen, die die Vorfahren Jesu zeigen anhand der Wurzel Jesse.
Nordseite der Kirche.
Inneres:
Blick durch das, von zwei Seitenschiffen flankierte, Mittelschiff Richtung Chor.
Die Seitenschiffe sind vom Mittelschiff durch Spitzbogenarkaden getrennt. Oberhalb der Arkaden sind Fenster. Das Gewölbe ist ein Kreuzrippengewölbe.
Neugotische Kanzel aus Stein. Am Kanzelkorb Jesus und die 4 Evangelisten.
Die Chorapsis mit dem Hochaltar.
Seitenaltar im südlichen Querschiff.
Weiterer Seitenaltar im neugotischen Stil mit farbigen Statuen, einer mit Herz-Jesu-Darstellung, einer Nonne und Jeanne d’Arc.
Weiterer Seitenaltar im neugotischen Stil mit farbiger Statue von Maria.
Hinter einem Gitter aus Metall das Taufbecken mit einer neugotischen Schauwand aus Stein, auf der oben Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird.
Farbige Glasfenster
Blick durch das Mittelschiff Richtung Westen
Orgelempore mit Orgel.
Château de La Clayette: privates Wasserschloss, welches teilweise bereits aus dem 14. Jahrhundert stammt. Bis zur Französischen Revolution war es eine der größten Besitzungen in der Region. 1380 wurde die existierende Burg von Philibert de Lespinasse (ca. 1310-1392) in ein Schloss mit Rundtürmen umgebaut. Das Schloss wechselte mehrmals den Besitzer. 1722 kaufte Bernard de Noblet das Schloss und wurde Baron von Clayette. 1736 wurde La Clayette zur Grafschaft erhoben und seither ist es im Besitz der Familie. Schon von weitem sieht man das von Wasser umgebene Schloss.
Lageplan des Schlosses mit seinem Park an einem See.
Umgeben von Wasser, liegt das Schloss auf einem Rechteck. Das Schloss besteht aus einem Gebäudekomplex mit Hauptgebäude im nördlichen Teil und zwei parallelen rechteckigen Nebengebäuden.
Nähert man sich von Osten sieht man den Haupteingang des Schlosses, der im Osten von zwei Rundtürmen flankiert wird. Eine Straße führt über den See zu einem Tor, das für sich schon wie eine kleine Burg wirkt.
Im Hintergrund der Park des Schlosses.
Eine Turmruine im Park, zum Teil von außerhalb des Parks fotografiert.
Blick auf die Orangerie.
Das Tor mit Zugbrücke, dahinter der Haupteingang des Schlosses.
Das Hauptgebäude des Schlosses mit einem sich anschließenden großen Rundturm.
An den großen Rundturm schließt sich ein weiteres Gebäude an.
Blick zurück zum Torbau mit einer kleinen Bogenbrücke davor und dem aufgestauten Wasserbecken darunter.
Geht man um das Schloss herum sieht man die zwei parallelen rechteckigen Nebengebäude mit jeweils einem überhängenden Eckturm, die einen Hof umrahmen.
In Hintergrund eine der von Türmen flankierten Fassaden des Hauptgebäudes.
Zugang zu weiteren Nebengebäuden und einem weiteren Hof.
Blüten einer Magnolie
Dem Schloss gegenüber steht die öffentliche Bibliothek.
Tulpe
Beet mit Blumen, Tulpen, Narzissen. - Saint-Germain-en-Brionnais: romanische Pfarrkirche eines kleinen Ortes mit ca. 200 Einwohnern. Sie ist dem heiligen Bischof Germanus von Auxerre (ca. 380-448) und dem heiligen Abt Benedikt von Nursia (480-547) geweiht. Die Kirche entstand im Zusammenhang mit der Gründung eines Augustiner-Chorherrenstifts im Jahr 1095, durch den Herren der benachbarten Burg Dyo. Das Kloster wurde bereits im Mittelalter aufgelöst. Die Klostergebäude wurden während der Hugenottenkriege 1569 zerstört. Im 19. Jahrhundert waren die Gewölbe der Kirche einsturzgefährdet und wurden durch mächtige Stützpfeiler gefestigt.
Mehrere Informationstafeln mit Grundriss, Aufriss und Querschnitt der Kirche.
Westfassade: Die Kirche ist eine Hallenkirche mit 3 Schiffen ohne Querschiff. Der seitlich versetzte Glockenturm ist etwas später entstanden. Er besitzt schmale Fenster, wie Schießscharten.
Nordseite der Kirche.
Inneres:
Die Kirche ist eine Hallenkirche, da das Mittelschiff keine eigenen Fenster hat. Das Mittelschiff ist mit einem Tonnengewölbe gedeckt, die Seitenschiffe mit Kreuzgratgewölben. Die 3 Schiffe münden direkt ein drei halbrunde Apsiden, da ein Querschiff fehlt.
Neugotischer Hochaltar in der mittleren Apsis. Dahinter drei durch Pilaster getrennte Rundbogenfenster mit Blendarkaden darüber.
Blick durch das Mittelschiff zurück Richtung Westen zum Eingang. Rechts ist der Kanzelkorb aus dem 19. Jahrhundert zu sehen.
Nördliches Seitenschiff mit dem Grabmal der Sybille de Lucy (gest. 1298), Dame von Dyo und Sigy. Sie entstammt der Familie, die die Klostergründung erst möglich gemacht hatte.
Detail des Grabmals mit der lebensgroßen, liegenden Statue der Toten aus dem späten 13. Jahrhundert. Sie hat die Haltung einer Betenden und zu ihren Füßen liegt ein Windhund.
Informationstafel
Neuromanischer Altar in der linken Apsis mit farbigen Statuen und einem Rundbogenfenster dahinter.
Südliches Seitenschiff. An der rechten Seite sieht man einen romanischen Altar, der auf der Rückseite ein Loch hat. Hier konnte man den Kopf hineinstecken, um gemäß einer lokalen Überlieferung von Geisteskrankheiten geheilt zu werden.
Informationstafel.Altar in der rechten Apsis mit vergoldeten Statuen und einem Rundbogenfenster dahinter.
Steingrabkreuz außerhalb der Kirche. - Lugny-lès-Charolles: Kleiner Ort mit ca. 350 Einwohnern.
Plan des Ortes und der Umgebung.
An der Straße nach Paray-le-Monial, am Fuße des Schlosses, liegt die Kirche Saint-Martin aus dem 19. Jahrhundert.
Blick von der Straße auf die Kirche, mit dem dahinter auf einem Felsen gelegenen Schloss aus der Zeit um 1770. Es entstand auf den Fundamenten einer älteren befestigten Burg.
Kalvarienberg aus dem 16. Jahrhundert. Seine Kreuzarme enden in vierlappigen Gebilden.
Blick von Süden auf die neuromanische Kirche mit Glockenturm über der Westfassade.
Inneres:
Ein Kirchenschiff mit einer halbrunden Apsis. Rundbogenfenster, die von Rundbogenarkaden gerahmt sind und flankiert von halbhohen Säulen auf Konsolen.
In der Apsis 5 Rundbogenfenster.
Blick zurück zum Eingang im Westen. Neben der Tür ein großes Kruzifix.
Konsole mit floralem Motiv.
An der Wand Erinnerungen an Gefallene des ersten und zweiten Weltkrieges mit kleinen Fotos der toten Soldaten.
Das Tor des Friedhofs zeugt vom Bau einer romanischen Kirche im 11. Jahrhundert, die hier früher mal gestanden haben muss.
Eingangsportal zum Schloss.
Bauernhöfe mit Charollais-Rindern auf der Weide. - Gourdon: der Ort hat etwa 900 Einwohner und liegt nordöstlich von Paray-le-Monial.
Église de l’Assomption: Bereits 534 ist in Gourdon ein Kloster urkundlich erwähnt. Die bestehende Kirche, die unter dem Patronat der Himmelfahrt Marias steht, dürfte an der Stelle des ehemaligen Klosters stehen. Die romanische Kirche entstand Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts.
Informationstafel
Westfassade. Davor ein Brunnen und eine Säule mit einem Kreuz aus Metall. Die Basilika hat 3 Schiffe und ein Querschiff mit einem Vierungsturm.
Das schlichte Portal hat einen Rundbogen und wird von je zwei Säulen flankiert.
Details der stark verwitterten Kapitelle an den Säulen.
Nordseite der Kirche, die von einem Friedhof umgeben ist. Kurz vor dem Querschiff die kleine Sakristei. Der nördliche Teil des Querschiffs entstand bereits im 12. Jahrhundert zusammen mit dem Chor.
Blick vom Friedhof auf den im 12. Jahrhundert erbauten Chor mit den Apsiden und dem Querschiff mit dem wuchtigen Vierungsturm mit Biforien im oberen Bereich.
Friedhof um den Chor der Kirche herum. Im Hintergrund ein altes Haus mit gotischen Fensterlaibungen.
Verzierte Konsolen unter dem Dach.
Inneres:
Blick durch das von zwei Seitenschiffen flankierte Mittelschiff Richtung Chor. Das Mittelschiff ist durch Kreuzgratgewölbe gedeckt. Die großen Rundbogenarkaden, das Triforium und die hohen Rundbogenfenster darüber, entstanden erst in einer zweiten Bauphase im 12. Jahrhundert.
Detail eines Kapitells aus dem Mittelschiff.
Blick von der Vierung in den Chor mit der Apsis.
Informationstafel. Obwohl die Fresken bereits 1940 entdeckt wurden, konnte erst 1971 der wichtigste Teil des ikonographischen Programms ausgedeckt werden. 1987 wurde die Restaurierung beendet.
Mittlere Chorapsis mit Fresken von zwei heiligen Bischöfen in Büstenform zwischen den drei Rundbogenfenstern.
Details der beiden Kapitelle an der Seite mit Atlanten.
In der halbrunden Kuppel Christus in der Mandorla, umgeben von den geflügelten Evangelistensymbolen.
An der Decke des Chorjochs ein Band mit graphischem Muster und in der Mitte ein Kreis mit dem Lamm Gottes.
Nordwand des Chorjochs:
oben 6 Apostel. Der Apostel Petrus führt die Prozession an. In der Mitte in einem Kreis das Antlitz von Christus.
Darunter die Geburt Christi. Maria liegt auf einem Bett, Josef steht am Kopfende.
Daneben in einem Rundbogen die Verkündigung.
Darunter neben der Säule die fantasiereiche Darstellung eines Elefanten.
Südwand des Chorjochs:
oben 6 Apostel. Der Apostel Paulus führt die Prozession an.
Darunter Christus und die beiden Pilger von Emmaus. Es zeigt das Brechen des Brotes, eine Episode, die im Lukasevangelium erzählt wird.Blick in die achteckige Kuppel der Vierung.
Blick zurück nach Westen zum Eingang. Darüber ein Rundbogenfenster, flankiert von Fresken, die zwei Bischöfe darstellen. Darunter zwei Blendarkaden. Die trapezförmigen Kapitelle in den Fenstern der Westwand erinnern an die Baustelle von Cluny III.
Blick vom Mittelschiff auf das erste Joch der Nordwand. Unten steht ein Taufbecken im nördlichen Seitenschiff. Der dreigeschossige Aufriss mit Arkaden, Triforium und Obergaden ist in Burgund eine Besonderheit der Kirche von Gourdon. Dies kann durch die Einflüsse von Cluny und von der Schule von Saint-Martin in Autun erklärt werden.
Über dem Triforium noch erkennbare Wandmalereien, die rote Fugen zeigen, die Mauerwerk imitieren.
2. Joch der Nordwand.
Detail eines Kapitells an dieser Stelle mit Köpfen von Menschen und Tieren.
3. Joch der Nordwand.
Triforium vom 3. Joch der Nordwand.
Detail eines Kapitells an dieser Stelle mit sitzenden Tieren.
4. Joch der Nordwand, direkt vor der Vierung. Unten die Tür zur Sakristei mit einem kleinen Rundbogenfenster darüber.
Triforium vom 4. Joch der Nordwand. Die Kapitelle mit floralen Motiven und Tieren.
Blick durch das Mittelschiff auf die südliche Wand des Mittelschiffs.
Detail eines Triforiums an der südlichen Wand des Mittelschiffs.
Details von zwei Kapitellen, die dort zu sehen sind.
Blick durch das nördliche Seitenschiff Richtung Westen, hinten das Taufbecken.
Nördliche Apsis am nördlichen Querschiff.
Details von zwei Kapitellen mit Tierdarstellungen an dem Rundbogen davor.
Nördliche Apsis mit 3 Rundbogenfenstern, von denen nur noch ein Fenster geöffnet ist. Links ein im 15. Jahrhundert eingebautes gotisches Fenster.
Blick durch das südliche Seitenschiff Richtung Osten zum Chor.
Detail eines Kapitells am südlichen Seitenschiff mit sitzenden Menschen und Köpfen von Tieren.
Blick vom südlichen Querschiff zur südlichen Apsis.
Details von drei Kapitellen, die man von dort sieht. Sitzende Tiere – ein Mensch, der in einer Hand ein Lamm und in der anderen Hand eine Schlange hält und schlichte florale Motive.
Südliche Apsis am südlichen Querschiff. Hier haben sich auch Fresken erhalten, die allerdings schwer zu deuten sind.
An der Südwand des Querschiffs sieht man ein Wandgemälde auf schwarzem Hintergrund, welches die Krönung Marias durch zwei Engel zeigt.
Details von weiteren Kapitellen mit Darstellung von Tieren, Menschen und floralen Motiven.
Die Häuser direkt vor der Kirche mit dem Brunnen und einer Säule mit einem Kreuz aus Metall darauf.Alte Häuser in Gourdon, zum Teil mit Natursteinmauern.
Hügelige Landschaft mit Weiden, Charollais-Rindern und Bäumen Richtung Mont-Saint-Vincent - Mont-Saint-Vincent: der kleine Ort mit ca. 350 Einwohnern, liegt südöstlich von Gourdon auf einem Plateau. Von 988 bis 1506 war Mont-Saint-Vincent ein Cluniazensisches Priorat und wurde zu einer Pfarrei.
Blick von der Anhöhe des Ortes auf die umgebende hügelige Landschaft.
Informationstafel zum Ort.
Informationstafel zum Place Bayard
Torbogen zwischen zwei Häusern am Place du Chateau.
Laden eines Kunstschmiedes.
Bauernhof mit Scheune und Wohnhaus aus Natursteinen. Hier werden auch Zimmer vermietet.
Hinweisschild „Livres vagabonds“ für eine Tauschbörse für Bücher.
Blaues Eingangstor aus Metall zu einem Haus mit blauen Fensterläden.
Blick in eine kleine Straße mit alten Häusern.
Alte Haustür mit Nieten und Beschlägen aus Metall.
Informationstafel zum Haus der Familie Leclerc.
Familienwappen über dem Torbogen.
Alte Haustür mit Türklopfer in der Form einer Hand und Türknauf aus Metall mit einem Kopf darauf.
Alter Hauseingang mit einem kleinen Ziergiebel mit Wappen darüber und einer Tür mit Nieten.
Blick in einen kleinen privaten Garten mit einer Streuobstwiese.
Blumen
Informationstafel zum Platz vor der Kirche.
Église Saint-Vincent: davor ein Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Die Kirche stammt aus dem 11. und dem Anfang des 12. Jahrhunderts.
Die Kirche steht inmitten eines Friedhofs und hat einen großen Narthex, dessen Bau wie eine Tordurchfahrt wirkt. Sie Kirche hat keinen Turm.
Der Friedhof mit typisch französischen Gräbern aus Stein mit Blumen aus Keramik.
Nordseite der Basilika mit Narthex, dem abgestuften Dach für Mittelschiff und Seitenschiff, sowie dem Friedhof. Der Bau erfolgte in mehreren Etappen. Zuerst wurde das Kirchenschiff an einen Chor aus dem 11. Jahrhundert angebaut. Als das Kirchenschiff fertig war, wurde der alte Chor abgerissen, um Platz für das Querschiff und den jetzigen Chor zu schaffen.
Der Chor von Nordosten mit einer kleinen Apsis mit großem Bogen darüber. Dies stammt noch vom Vorgängerbau, vom Anfang des 11. Jahrhunderts.
Der Chor von Südosten.
Narthex mit großen Rundbögen zu drei Seiten. Im Obergeschoss befand sich eine Kapelle mit Gewölbe und einer Empore, von der aus man durch die ganze Kirche schauen konnte.
Portal im Westen mit Türen aus Holz mit Nieten und Beschlägen aus Metall.
Tympanon mit Christus in der Mandorla, flankiert von 2 Heiligen oder Aposteln.
Konsole und Kapitell auf der linken Seite sind stark verwittert.
Konsole mit Atlant und Kapitell mit Tieren und floralen Motiven, auf der rechten Seite.
Inneres:
Informationstafel
Blick von Westen durch das Mittelschiff Richtung Chor mit dem Hochaltar.
Eine architektonische Besonderheit ist, dass jedes Joch von einem Quergewölbe gedeckt ist, welches im rechten Winkel zur Kirchenachse verläuft.
Details von zwei Kapitellen aus dem Mittelschiff.
Blick von der Vierung in die Apsis des Chors mit 3 Rundbogenfensters und einer stark verwitterten Wandmalerei in der halbkreisförmigen Kuppel mit einem christlichen Symbol.Blick vom Hochaltar zurück zum Eingang Richtung Westen. Blick durch das südliche Seitenschiff mit Kreuzgratgewölbe. Blick vom nördlichen Seitenschiff durch das Mittelschiff. Hier sieht man gut die ungewöhnlichen Gewölbe des Mittelschiffs. Neugotischer Seitenaltar. Seitenalter und altes Taufbecken. Taufbecken aus dem 19. Jahrhundert. Auf dem Deckel Jesus, der von Johannes dem Täufer getauft wird, umgeben von sitzenden Engeln. Das Taufbecken ist aus schwarzem Stein mit nur einigen goldfarbenen Akzenten. Mehrere skulptierte Kapitelle. Farbiges Glasfenster mit der Taufe Christi. Haus bei der Kirche neben einem kleinen Park mit Rasen, Bäumen, Bänken und Tischtennisplatten. Ausblick auf die umgebende Landschaft. Schnurgerade Straße durch die hügelige Landschaft.
-
Château de Chaumont Laguiche: Um das Jahr 1000 bedeckte ein riesiger Wald die gesamte Landschaft des Charolais. Zu dieser Zeit stand hier eine Festung, die der Familie Semur gehörte. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Festung dann im 16. Jahrhundert zu einem Renaissanceschloss, das seit 1465 von der Familie bewohnt wurde. Information zu der Restaurierung der Ställe des Schlosses Die Stallungen wurden 1648-1652 nach Plänen des Architekten François Blondel (1618-1686), im Auftrag von Henriette de Laguiche erbaut. Er war Architekt von König Ludwig XIV. und orientierte sich bei diesem Auftrag stark an Bauprojekten Leonardo da Vincis. Henriette de Laguiche war die Frau von Louis Emmanuel de Valois (1596-1653), einem Enkel von König Karl IX. Er war Generaloberst der leichten Kavallerie und sie erteilte den Auftrag für die fürstliche Leibgarde ihres Mannes. Es handelt sich um eine der größten privaten Pferdeställe des Ancien Régime in Frankreich. Die Fassade wird unterteilt von zwei monumentale Treppen. Gemäß den Überlieferungen durfte wohl nur der König selbst Pferdeställe für 100 Pferde besitzen. Dieser Pferdestall bot Platz für 99 Pferde. Aber das hundertste Pferd war das Reiterstandbild von Philibert de Laguiche (1544-1607), die über der Ehrentür angebracht ist. Flachrelief eines Wappens. Detail eines Portals mit Architrav und Giebel mit Wappen. Rückseite der Ställe mit einem abgestellen Kran. Gaube mit Fenster auf dem Dach. Gestell aus Holz zum Beschlagen von Pferden. Frühlingsschlüsselblumen Bauernhof aus Natursteinen
-
Château de Corcheval: das Schloss aus dem 12. Jahrhundert liegt bei dem kleinen Ort Beaubery. Nach Zerstörungen in Kriegen, wurde es im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut. Im 19. Jahrhundert erfolgte dann ein umfangreicher Umbau des Schlosses und der Wiederaufbau des Eckturms. Das Schloss ist Privatbesitz. Landschaft mit von Hecken begrenzten Weiden mit Charollais-Rindern.
-
Château de Drée oder Château de la Bazole: im Wesentlichen im 17. Jahrhundert erbaut. Blick von Süden, auf das im Privatbesitz befindliche Schloss, welches allerdings für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Schloss auf einer Postkarte von oben. Das Château de Drée wurde ab den 1650er Jahren von François de Bonne de Créquy (ca. 1599-1677), 3. Herzog von Lesdiguières und Gouverneur von Dauphiné, an der Stelle der Festung La Bazolle erbaut. Es ist das erste große Schloss, das im Charolais-Brionnais errichtet wurde und zeugt von der Bedeutung seines Besitzers. 1748 wurde es an Etienne Comte de Drée (1692-1779) verkauft. Im 19. Jahrhundert ging es in den Besitz der Familie Tournon-Simiane über und wurde bis 1993 von dem belgischen Prinzen de Croÿe-Solré bewohnt. 1995 kaufte der jetzige Eigentümer Ghislain Prouvost das Haus. Das Schloss besteht aus drei Flügeln, die einen Hof bilden. Im Westen und Osten des Schlosses befinden sich formal gestaltete Barockgärten. Im Osten wird dieser von zwei, sich parallel gegenüber liegenden Nebengebäuden begrenzt. Davor verläuft ein Weg, an dem zwei achteckige Pavillons stehen. Weg mit den zwei achteckigen Pavillons rechts und den Nebengebäuden auf der linken Seite. Bei dem ersten Pavillon handelt es sich um einen Taubenschlag. Inneres des Taubenschlags. Er diente der Taubenzucht, die der Ernährung des Hausherren dienten. Der Besitz eines Taubenschlags war unter dem Ancien Régime ein herrschaftliches Recht. Die Anzahl der Nester orientierte sich an der Größe des Landbesitzes. Hier sind 805 Nistmöglichkeiten, was mehr als 400 Hektar Land entspricht. Die Nebengebäude. Eine Allee mit kegelförmig geschnittenen Nadelbäumen Richtung Osten. Der zweite achteckige Pavillon. Im 18. Jahrhundert wurde der zweite Taubenschlag in ein Gefängnis umgewandelt. Die Herren von Drée konnten die Gerechtigkeit ausüben, die es ihnen ermöglichte, Urheber geringfügiger Verstöße einzusperren, wie zum Beispiel Hühnerdiebstahl, öffentliche Trunkenheit, Wilderei oder Nachbarschaftsstreit. Allerdings diente das Gefängnis wohl eher der Abschreckung, denn es wurde selten genutzt. Der zentrale Raum mit Kamin für die Wache, war umgeben von mehreren Zellen. Blick in eine der Zellen. Zellentür. Hinter dem Nebengebäude auf der rechten Seite befindet sich ein Hof mit weiteren Nebengebäuden, wie auf einem Bauernhof. Blick durch ein Portal aus Metall, auf die im Osten liegende Hauptfassade des Schlosses mit dem barocken Garten davor. Der Barockgarten besteht aus beschnittenen Eiben und Buchsbaum, sowie mehreren Ziervasen. Hauptfassade des Schlosses hat in der Mitte ein aus 3 Jochen bestehendes Risalit. Im Erdgeschoss ein Portikus aus Säulen mit Kapitellen mit Tierköpfen. Darüber ein Balkon mit einer Balustrade aus Stein. Zwischen den Säulen mit Kapitellen mit Fischköpfen und floralen Motiven, öffnen sich drei Fenster. Darüber ein Gesims mit sitzenden Löwen und einem Wappen der Tournon-Simiane mit einer Krone darüber. Vor dem Eingang eine Kopie der Statue von Giambologna (1529-1608) mit dem Raub der Sabinerinnen. Details des barocken Gartens vor der Hauptfassade. Buchsbäume und Eiben im Formschnitt bilden geometrische Formen, in deren Feldern zum Teil Lavendel gepflanzt ist. Begrenzt wird der Garten durch eine Reihe von ebenfalls beschnittenen Bäumen, die vor den Nebengebäuden stehen. Nach der Restaurierung des Schlosses in den 1990er Jahren, wurde Ende der 1990er Jahre der französische Garten durch den Landschaftsarchitekten Moncorgé neu angelegt. Südseite des Gartens mit einer Stützmauer für das Gartenparterre direkt am Schloss. Runde Eibe mit einem gläsernen Gewächshaus dahinter. Im Hintergrund Blumenbeete und einem ovalen Bassin. Gewächshaus Oval aus mit Rosen bepflanzten Blumenbeeten mit ovalem Bassin mit Statuen von Putten, die Fische halten. Weiße Gartenbank in der Form eines Schwans. Blick auf die Fassade des Schlosses von Süden, über den ovalen Rosengarten und die Stützmauer hinweg. Blick auf die Westfassade des Schlosses, die in Richtung des Parks liegt. Sie ist wesentlich schlichter gestaltet. In dem aus beschnittenen Buchsbäumen bestehenden Garten, steht die Nachbildung einer Statue des griechischen Gottes Apollo. Eine Freitreppe führt zu dem, aus drei Fenstern je Ebene bestehenden Bereich der Fassade, die von einem Giebel bekrönt ist. In der Mitte der Treppe unter einem Rundbogen, die Statue des Gottes Dionysos mit einem Faun. Blick auf den prachtvollen 10 Hektar großen Park mit seinem französischen Garten und jahrhundertealten Bäumen im Bereich des englischen Landschaftsgartens im Hintergrund. Postkarte mit der gleichen Sicht. Südliche Seite des Barockgartens. Nördliche Seite des Barockgartens mit Statue der Göttin Artemis mit Hirsch im Zentrum. Mittlere Achse des Gartens Richtung Westen. Im Hintergrund tiefer liegendes ovales Wasserbassin mit Statuen von liegenden Nymphen. Ganz hinten ein weiteres rundes Bassin. Kleines Gartenhaus an der Seite des nördlichen Barockgartens Als Kugel geschnittene Buchsbäume mit der Statue eines Hirschs im Hintergrund. An der Südseite des Schlosses liegt der private Garten des jetzigen Hausherren mit beschnittenen Buchsbäumen. Statue des Meeresgottes Poseidon steht an einem Privatschwimmbad. Große Ziervasen mit Reliefs von Köpfen von Engeln und floralen Motiven. Rosenlaube mit einem runden Tisch.
-
Scharbockskraut Neugotische Kirche auf dem Weg zurück nach Paray-le-Monial.
-
Avallon: die Stadt Avallon hat fast 7000 Einwohner und liegt zwischen Orléans und Dijon in Burgund. Bereits vor 2000 Jahren gab es hier eine gallische Festung. Ihre Lage auf einem Granitplateau über dem Tal des Flusses Cousin ist strategisch wichtig. Der spätantike Heerführer Riothamus, der auch als König der Brittonen gilt, unterlag im Jahr 470 hier den Goten. Avallon wurde zu seinem Fluchtsitz. Das Leben dieses Königs und Heerführers und die Legenden um seine historische Person, machten ihn zu einem der Vorbilder für die Artus-Sage. Während des Mittelalters wurde Avallon zu einer wichtigen Festung ausgebaut und mit einer mächtigen Stadtmauer umgeben, die zahlreiche Türme hatte. Ab der Zeit des Absolutismus sank die Bedeutung der Stadt. Als im 19. Jahrhundert das Interesse für mittelalterliche Städte wuchs, entwickelte sich die Stadt zu einem Zentrum für den Tourismus. Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges. Denkmal für den Festungsbaumeister von König Ludwig XIV. Sébastien Le Prestre de Vauban, im Norden der Altstadt. Straße mit Läden. Place du Général de Gaulle mit Fontaine de Cérès von Mathurin Mreau (1822-1912). Sieben Jahrhunderte lang stand auf diesem Platz die Kirche Saint-Julien. Sie wurde 1793 abgerissen, richtet die Stadt hier einen Markt ein. Nach dem 2. Weltkrieg erhält der Platz seinen heutigen Namen, wird aber von den Einheimischen Place de la Mairie genannt, da das Rathaus an einer seiner Ecken steht. Informationstafel Markthalle. Rathaus von 1770. Tour Catin: Der Tour Catin ist ein achteckiger Treppenturm, der Teil eines Gebäudes war, das im 15. Jahrhundert an der Stelle der Residenz aus dem 13. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde. Es gehörte einem Sohn von Herzog Hugo IV. von Burgund. Informationstafel Straße mit Läden. Tour de l'Horloge: 49 m hoch, 1456 erbaut. Er war Teil der mittelalterlichen Stadtmauer und Sitz der städtischen Nachtwache. Es wurde vom Maurermeister Jehan Berg entworfen und befindet sich an der Stelle des südlichen Eingangs des antiken Aballo und der Burg der Grafen von Avallon. Im 18. Jahrhundert wurde er als Waffenlager genutzt. Die seltene Uhr stammt aus dem 15. Jahrhundert. Informationstafel Mittelalterliche Häuser und ein Fachwerkhaus an der Ecke Rue du Collège. Auf der anderen Seite des Tour de l'Horloge. Informationstafel. Fachwerkhaus mit der Touristeninformation. Vor der Touristeninformation das Bildnis eines Frosches vom Ufer des Flusses Le Cousin vom Bildhauer Yvan Baudouin 2015 geschaffen. Haus der Herren von Domecy. Ein typisches burgundischen Haus aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde im 18. und 19. Jahrhundert restauriert und 2010-2011 umgebaut. Église Saint-Lazare: ehemalige Stiftskirche. Eine erste Kapelle aus dem 5. Jahrhundert stand innerhalb der Burg von Avallon, wahrscheinlich an der Stelle eines merowingischen Grabes. 1078 wurde sie von Hugo I., Herzog von Burgund, den Mönchen von Cluny geschenkt. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts brachte Heinrich der Große (Herzog von Burgund) den Schädel des Heiligen Lazarus aus Palästina mit und schenkte ihn der Kirche, was Ursache für den heutigen Namen der Kirche war. 1106 wurde die Kirche erweitert und neu von Papst Paschalis II. (1050-1118) geweiht. Als Abt von Avallon gab er die Kirche dem Bischof von Autun zurück. Pilger strömten zu den Reliquien des Heiligen Lazarus, die die Eigenschaft hatten, die Pest zu heilen. Die heutige Kirche wurde 1160-1170 errichtet und ist damit eine der spätesten romanischen Kirchen in Burgund. 1633 stürzte der Nordturm ein und zerschmetterte das Portal im Norden. 1859 wurde Saint-Lazare, hier vor allem die Apsis, durch Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) restauriert. Informationstafeln. Grundriss der Kirche. Westfassade: die ehemals dreifache Portalanlage stammt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Das linke Portal ist durch den Einsturz des Turmes im Norden zerstört worden, ebenso wie die ehemals vorhandene Vorhalle, die nach dem Vorbild von Sainte-Marie-Madeleine in Vezelay auch vorhanden war. Rechts der Eingang zur Kirche Saint-Pierre, die direkt angebaut ist. Details des mittleren Portals: unter einem großen Rundbogen sind zwei Türen mit Nieten und Beschlägen aus Metall. Die ehemals vorhandenen Reliefs des Türsturzes und des Tympanons sind verschwunden und die Bögen wurden im 17. Jahrhundert erneuert. In den Archivolten sind Reste von Engeln, den 24 Ältesten, Tierkreiszeichen und Darstellungen der Monate zu erkennen. Linkes Gewände mit kleinen Säulen, die am Fuß stark beschädigt sind. Im rechten Gewände hat nur eine Statue eines Propheten, die protestantischen Bilderstürme von 1562 und der Revolution überlebt. Diese sehr schlanke, strenge Gestaltung der Statue zeugt von der stilistischen Verwandtschaft zum Königsportal der Kathedrale von Chartres. Der Prophet wirkt säulenhaft durch die eng anliegenden Gewänder mit den feinen Falten, die parallel verlaufen. Der mittlere Pfeiler des Portals, der Trumeaupfeiler, besteht aus 3 Säulen, die mit einem Kapitell zusammengefasst werden. Fratzen im Bogen direkt über der Tür. Details des rechten Portals: das rechte Portal ist heute zugemauert und hat nur ein vergittertes Fenster in der Mitte. Im Tympanon sieht man die stark zerstörten und nur noch in Teilen vorhandenen Reliefs der Heiligen Drei Könige, im Türsturz die Auferstehung und der Abstieg Jesu in die Vorhölle. Auch hier im linken Gewände kleine Säulen mit abwechslungsreichen Mustern. Am Fuß der Säulen sind noch stark beschädigte Reliefs erhalten, hier ein Löwe und ein Reiter. Weiter rechts ein Kentaur und Vögel mit Menschenköpfen. Im rechten Gewände kleine Säulen, ebenfalls am Fuß mit stark beschädigten Reliefs. Eingang zur rechts direkt anschließenden Kirche Saint-Pierre mit einem Bildnis des Apostels Petrus. Der seltsam schräg geschnittene Narthex. Stufen führen von der Straße herunter. An der Wand eine Kreuzigungsszene mit Statuen. Inneres: Dreischiffige Basilika. Das Mittelschiff ist 52 m lang. Blick Richtung Chor, dem ältesten sichtbaren Teil der Kirche. Blick vom Chor zurück zum Eingang im Westen mit der Orgel auf der Orgelempore. Die Empore soll noch aus dem 15. Jahrhundert stammen, enthält aber wesentliche Erweiterungen, die von der Restaurierung im 19. Jahrhundert stammen. Das Orgelprospekt stammt von 1850. Details der Orgelempore. Engel mit Fanfaren und einem Schriftband tragen die Empore. Die mit gotischen Motiven gestaltete Brüstung wird durch Statuen unter gotischen Baldachinen in regelmäßigen Abständen rhythmisiert. Die beiden größeren Statuen musizieren auf Harfen, zum Beispiel König David.. Blick vom südlichen Seitenschiff durch das Mittelschiff auf das nördliche Seitenschiff. Hier steht eine Kanzel aus Holz. Etwas weiter rechts davon, Richtung Chor steht eine kleine Orgel. Blick durch das südliche Seitenschiff Richtung der südlichen Chorapsis mit dem Altar des Heiligen Josef. Die Wände der Chorapsis wurden im 19. Jahrhundert mit Wandmalereien versehen. Die nördliche Chorapsis mit Seitenaltar und Wandmalereien aus dem 19. Jahrhundert. Blick zurück durch das nördliche Seitenschiff mit der Rückseite der kleinen Orgel. Blick zurück durch das nördliche Seitenschiff mit der Rückseite der Kanzel und dem Mittelschiff. Im Süden der Kirche schließt sich der Kapitelsaal an. Die Wände und das Gewölbe sind mit Grisaille-Malerei versehen. Altes Fachwerkhaus, daneben der alte Salzspeicher aus dem 15. Jahrhundert. Torbogen zum ehemaligen Collegium Odebertinum, in dem sich heute das Musée de l'Avallonnaise befindet. Kleine Straßen mit alten Häusern.
-
Pontaubert: der kleine Ort mit ca. 400 Einwohnern liegt zwischen Avallon und Vezelay. Das Dorf hat seinen Namen von einer Brücke (Pons), kombiniert mit dem Namen des Grafen Aubert von Avallon. Brunnen, Fontaine au Lion, im Hintergrund die Westfassade der Kirche Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité: die Gegend war ein Sammelpunkt für Pilger nach Santiago de Compostela. Die Tempelritter erhielten das Land um Pontaubert 1190 und schützten die Pilger auf ihrem Weg. Später empfingen und pflegten die Ritter des Hospitalorden Saint-Jean-de-Jerusalem bzw. Johanniter die Kranken und Verwundeten. Geschwächte Pilger wurden in einer Kompturei aufgenommen, die um 1167 von Jocelin Lord von Vault-de-Lugny gegründet wurde. Neben einer Brücke und einer Zisterne, wurde die Kirche Notre-Dame im 12. Jahrhundert erbaut. Im 13. Jahrhundert kam der hohe Glockenturm dazu. Der Narthex mit darüber befindlicher Terrasse stammt vom Ende des 15. Jahrhunderts. Nordseite der Kirche mit dem davor liegenden kleinen Garten. Westseite der Kirche mit Vorhalle bzw. Narthex und der darüber liegenden Terrasse. Information zum Tympanon. Portal mit Rundbögen und Tympanon aus dem 13. Jahrhundert. In der Mitte sitzt majestätisch die Jungfrau mit Kind. Links die Anbetung der Könige, rechts die Himmelfahrt Marias. Darüber nehmen Engel sie in Empfang. Inneres: Blick durch das mit Kreuzgratgewölben bedeckte Mittelschiff Richtung Chor und Hochaltar. Die Basilika hat 2 Seitenschiffe. An den Säulen die Fahnen des Malteserordens. Der Chor mit 3 Rundbogenfenstern. Kruzifix mit farbigen Statuen von Maria und Johannes. Farbiges Glasfenster mit Motiven aus dem Leben von Maria. Christi Geburt, Verkündigung und Himmelfahrt Marias. Blick auf ein Joch des Mittelschiffs mit der Kanzel. Blick durch das südliche, mit Kreuzgratgewölben gedeckte Seitenschiff. Im Hintergrund am geraden Abschluss ein Taufbecken aus Stein.
-
Vézelay: Der Ort Vézelay ist ein weit über Frankreich hinaus bekannter Wallfahrtsort und einer der Ausgangspunkte nach Santiago de Compostela, dem sogenannten Jakobsweg. Der Stadthügel mit der Abteikirche von Vézelay zählen seit 1979 zum UNESCO-Welterbe. Die Geschichte von Vezelay begann im Jahr 858/859 mit der Gründung einer Benediktinerabtei. Anfangs ein Frauenkloster zu Ehren Christi und der Jungfrau Maria, wurde es in späteren Jahren in ein Männerkloster umgewandelt. Ab Mitte des 11. Jahrhunderts wurde es Cluny unterstellt. Zu einem bedeutenden Wallfahrtsort wurde der Ort durch seine Schutzheilige Maria Magdalena. Reliquien der Heiligen befanden sich wahrscheinlich schon seit dem späten 9. Jahrhundert in Vézelay. Cluny förderte ihren Kult und so war Vézelay im 12. Jahrhundert das Zentrum des Magdalenenkultes. Wirtschaftlicher Aufschwung ging damit einher und zeitweise war der Ort Zentrum wichtiger politischer Geschehnisse, zum Beispiel rief hier 1146 Bernhard von Clairvaux zum 2. Kreuzzung auf. Es es Treffpunkt von Königen bevor der 3. Kreuzzug begann. Seine Stellung büßte der Ort ein, als Karl II. von Anjou (1254-1309) 1279-1280 aufwendige Untersuchungen zur Tradition der Magdalenenreliquien anstellen ließ. Hierbei wurde in einem Sarkophag in einer Kapelle der provenzalischen Abtei Saint-Maximin, Gebeine der Heiligen entdeckt und die angeblich echten Reliquien per Urkunde verbürgt. Ein Streit zwischen den beiden Abteien brach aus und 1295 entschied Papst Bonifatius VIII. zugunsten der Abtei von Saint-Maximin. Der Abtei in Vézelay gingen die Einkünfte aus den Wallfahrten verloren. Und im Jahr 1569 gingen im Zuge der protestantischen Bilderstürmer die Magdalenenreliquien verloren. Der von Bögen überwölbte Weg neben dem Ursulinenkloster, gegenüber der großen Wallfahrtskirche. Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege. Blick vorbei an alten Häusern zur imposanten Westfassade der Kirche Sainte-Marie-Madeleine. Alte Häuser am Platz vor der Kirche. Église Sainte-Marie-Madeleine: Grundriss der Kirche und des daran anschließenden Klosters. In hellerer Farbe kenntlich gemacht sind die nicht mehr existierenden Gebäude. Die Basilia steht an der Stelle einer ehemaligen karolingischen Kirche. Nach und nach wurde der Bau durch romanische Elemente ersetzt. Zuerst durch Abt Artaud der Chor, der 1104 geweiht wurde. Dann wurde das 1120 durch einen Brand beschädigte Kirchenschiff erneuert. Zwischen 1140-1150 entstand die Westfassade mit den 3 Portalen und der Vorhalle, dem Narthex. Erst um 1260 entstand der Turm und das Tympanon an der Westfassade. Während der Französischen Revolution wurde der gesamte Figurenschmuck an der Fassade der Basilika zerstört. Erst in den Jahren 1870/76 wurde die Bedeutung für den Magdalenenkult noch einmal wiederbelebt: Neue Reliquien der Heiligen wurden eingesetzt, und seitdem strömen die Pilger wieder nach Vézelay. Nordseite der Kirche Blick von unterhalb der alten Stadtmauer auf den Chor mit seinem Kapellenkranz. Südseite der Kirche mit dem einen, im 13.-14. Jahrhundert erbauten Turm an der Westfassade und dem zwischen 1120-1149 entstandenen Mittelschiff. Blick in den ehemaligen Klostergarten mit Brunnen. Hier hat sich der Ostflügel des Kreuzgangs erhalten. Die Basilika hat ein kaum auskragendes Querhaus mit einem weiteren Turm in der Ecke zum Kreuzgang. Kreuzgang: vom nach 1165 entstandenen Kreuzgang hat sich der östliche Flügel erhalten. Kapitelsaal, getrennt vom Kreuzgang durch Rundbogenarkaden. Der Kapitelsaal hat ein gotisches Gewölbe, getragen von zwei Säulen mit zum Teil noch gotischen Kapitellen und Konsolen. Westfassade der Kirche Sainte-Marie-Madeleine: in der Gotik errichtet, wurde die Fassade im 19. Jahrhundert durch Viollet-le-Duc teilweise erneuert. Details des spitzbogigen Tympanons neben dem Südwest-Turm. Stehende Statuen unter gotischen Baldachinen, bekrönt von einer sitzenden, stark zerstörten Statue. Bei den drei Portalen im Westen hat sich nur das Tympanon und der Türsturz des mittleren Portals erhalten. Tympanon und Türsturz des mittleren Portals: Das Tympanon von 1856 zeigt den thronenden Christus als Weltenrichter zwischen dem Tor zur Hölle und dem Himmel. Umgeben ist er von den Symbolen der Evangelisten und Fanfaren blasenden Engeln. Auf dem Türsturz links die Erweckung des Lazarus, rechts Maria Magdalena zu Füßen Jesu. In den Archivolten zahlreiche sitzende Figuren. Links von Christus Maria und Petrus, sowie Engel, die die Seelen der Seligen in den Himmel tragen. Rechts von Christus das Tor zur Hölle in der Form eines aufgerissenen Mauls eines Ungeheuers. Davor der Erzengel Michael mit der Seelenwaage und dem Teufel. Links vom Türflügel Kapitelle und Konsolen mit Darstellungen von Tieren, Personen und Engeln. Rechts vom Türflügel im Kapitell der Szene der Verkündigung und Kapitelle mit floralen Motiven. An der Seite rechts eine stark beschädigte Statue von einem sitzenden Mann, auf dem ein weiterer Mann steht. Säulenbasis mit Fröschen oder Kröten. Linkes Portal: Detail einer Konsole links mit einem Kentaur mit Pfeil und Bogen. Konsole rechts mit einem Menschen und einem Engel. Vorhalle, Narthex: erbaut 1140-1150 im romanischen Stil am Übergang zur Gotik. Er hat 3 Schiffe und 3 Joche. Im Hintergrund kann man die 3 Portal zur Kirche erkennen, die durch den Schutz des Narthex in sehr gutem Erhaltungszustand sind. In der oberen Etage des mittleren Schiffs des Narthex befinden sich Rundbogenarkaden. Zahlreiche kunstvoll gestaltete Kapitelle, die später als die Kapitelle des Kirchenschiffs entstanden sind: Samson überwindet den Löwen aus 2 Perspektiven. 2 Männer essen Weintrauben. Enthauptung des Johannes? Petrus und Paulus erwecken einen in der Mitte stehenden jungen Mann zum Leben. Versuchung des Heiligen Benedikt? Mann mit Pfeil und Bogen zielt auf einen zweiten Mann Eventuell erscheint die heilige Maria Magdalena der Prinzessin der Provence, ein Motiv aus einer legendäre Erzählung. Der Heilige Benedikt erweckt ein Kind zum Leben, welches bereits in ein Leichentuch gewickelt ist. Vorwürfe des Propheten Nathan gegen König David, der sich in der Mitte an seine Brust klopft als Zeichen seiner Reue über seine Fehler. Mehrere Männer Kleine Konsolen in Form von Köpfen. Blick durch den Narthex auf das mittlere Portal. Zwischen den beiden Türen des mittleren Portals, im Trumeau, Johannes der Täufer, der in den Händen eine Schale hält, in der einmal ein Lamm war. Mittleres Portal: errichtet 1120-1140 im Zusammenhang mit dem Neubau des Kirchenschiffs. Im Tympanon der thronende Christus mit weit ausgebreiteten Armen, der den Aposteln den Heiligen Geist spendet. Es zeigt sowohl das Pfingstereignis, als auch die Aussendung der Apostel zur Mission. In den kastenartigen Feldern im Bogen, sind die Völker der Erde dargestellt. Links im 2. Fach zum Beispiel Juden. Links von der Mitte Araber und Inder mit Hundeköpfen. Rechts ganz unten Armenier, darüber evt. Byzantiner In den Medaillons der Archivolten die Tierkreiszeichen und die Monatsarbeiten. Auf dem Türsturz links die Skythen und Römer oder Juden. Rechts Riesen, Pygmäen, Großohrige. Linkes Portal: auf dem Türsturz die 3 Etappen aus der Geschichte der Emmaus-Jünger. Oben im Tympanon die Himmelfahrt Jesu. Die Konsolen auf beiden Seiten der Tür zeigen Engel, die Dämonen vertreiben. Rechtes Portal: im Tympanon oben, sind die 5 Weisen zu sehen, die Jesus auf dem Schoß seiner Mutter anbeten. Darunter die Verkündigung, die Heimsuchung und die Geburt Jesu. Die Konsolen auf beiden Seiten der Tür zeigen Engel. Inneres der Kirche: Blick in das 60 m lange romanische Mittelschiff Richtung Chor. Es ist 18 m hoch und 9 m breit. Mittelschiff und Seitenschiffe sind durch Kreuzgratgewölbe gedeckt. Die zweifarbigen Arkaden und Gurtbögen haben ihre Vorbilder in der byzantinischen und karolingischen Architektur. Ansonsten folgt die romanische Architektur dem Vorbild der ab 1188 errichteten dritten Kirche der Benediktinerabtei Cluny. Blick in das Gewölbe des Mittelschiffs. Blick durch das Mittelschiff auf Kanzel und das nördliche Seitenschiff. Detail der Kanzel aus Holz. Auf dem Kanzelkorb die vier Evangelisten. Blick von der Vierung in das nördliche Querschiff. Querschiff und Chor sind frühgotisch und haben den typischen dreigeschossigen Wandaufbau, bestehend aus Arkaden, dem Triforium und Obergaden mit Fenstern, die zwar schon spitzbogig, aber noch ohne Maßwerk sind. Die Arkaden des Triforiums sind Biforien mit spitzbogigen Öffnungen, aber noch runden Bögen darüber. Chor mit Hochalter und Gewölbe. Dieser erst nach 1165 entstandene Bereich ist mit Kreuzrippengewölbe gedeckt.. Blick vom Chor zurück durch die Vierung und das Mittelschiff. Kreuzrippengewölbe der Vierung und der Querschiffe. Blick in eine Querschiff. Blick durch das nördliche Seitenschiff Richtung Westen. Blick vom Eingang, beim nördlichen Seitenschiff durch das Mittelschiff. Stark beschädigtes Grabmal an der Wand. Reste von Bemalung an einer Säule. Kapitelle: von den 99 Kapitellen aus der Zeit von 1120-1140, sind nur 8 durch Kopien der Originale im 19. Jahrhundert ersetzt worden. Es handelt sich überwiegend um Darstellungen des Guten und des Bösen. Mystische Mühle Vision des Heiligen Antonius. Links betrachtet Antonius voller Schrecken, wie 3 Dämonen einen liegenden Mönch heimsuchen. Mann mit Pfeil und Bogen, zweiter Mann hinter Blättern. Mehrere Mönche. Personifikation der vier Winde. David bändigt einen Löwen. Die weltliche Musik und der Dämon der Unreinheit. Links spielt ein Musiker Flöte. Rechts lässt sich eine Frau von einem Dämon streicheln. Daniel in der Löwengrube in einer sehr traditionellen Darstellungsweise. Kampf eines Ritters gegen einen Drachen Jakobs Kampf mit dem Engel. 2 Männer in einer Art Mandorla. Ein Mann mit einem Wanderstock. Segnung Jakobs durch Isaak. 2 Dämonen, eine Frau und ein Mönch. Ein Mann mit Bischofsstab auf einem Thron, flankiert von 2 Männern. Die 4 Flüsse des Paradieses. Gemäß jüdischer Überlieferung fließen vier Flüsse durch das irdische Paradies. Die Flüsse werden durch nackte, gekrönte Personen dargestellt. Tiere beten einen Heiligenschein mit einem Kreuz an. An den Seiten zwei Männer. Kein originales Kapitell. Engel Raphael als Sieger über den Dämonen Asmodi. Kein originales Kapitell. Adam und Eva mit dem Baum der Erkenntnis und der Schlange. Es ist eines der ältesten Kapitelle in der Kirche, evt. noch aus der Zeit der Karolinger. Versuchung des heiligen Antonius, den 2 Dämonen misshandeln. Kein originales Kapitell. Das Mahl der heiligen Einsiedler Paulus und Antonius. Die beiden Heiligen teilen das Brot. Vision des heiligen Antonius. Links betrachtet Antonius voller Schrecken die Szene. Ein Mönch wird von 3 Dämonen heimgesucht. Sie haben ihn von einem Turm gestürzt und ein Dämon schlägt im auf den Kopf. Vögel die Trauben fressen. David lasst den Mörder Sauls hinrichten. Links David und rechts der Mörder, der angeblich seinem Henker Widerstand leistet. Der Basilisk, sein Blick versteinert jeden, der seine Augen nicht schützt. Die riesige Heuschrecke versinnbildlicht die bekehrten Völker, die gegen das Böse kämpfen. Ein Mensch hält eine Schale. Legende der heiligen Eugenia. Sie ist die Tochter eines heidnischen Richters, tritt ohne Angabe ihres Geschlechtes in ein Männerkloster ein. Sie wird von einer Frau, die links steht, der Vergewaltigung angeklagt und vor dem Richterstuhl ihres Vaters, der rechts sitzt, enthüllt sie ihre wahre Identität, indem sie vorne ihr Gewand öffnet und man den Ansatz ihrer Brüste sieht. Ein Mann mit Krone wendet sich ab von einem Engel, der über ihm sein Schwert erhebt. Benedikt erweckt ein totes Kind zum Leben. Darunter 2 Dämonen. Moses und das goldene Kalb. Als Moses vom Berg Sinai mit den 10 Geboten zurückkehrt, ist sein Volk in den Götzenkult, mit der Anbetung des goldenen Kalbes, zurück gefallen. Ein Dämon entweicht dem Maul des Kalbes. 3 Dämonen. 3 Männer die an einem Tisch sitzen, von rechts kommt eine weiterer Mann mit einem Topf. Der Tod Abschaloms, eines Sohne von David. Joab, ein Offizier Davids, schlägt Abschalom den Kopf ab – links. Vorne ein Pferd. David besiegt den hünenhaften Philister Goliath. Der heilige Martin und der Baum der Heiden. Martin fordert die Heiden auf einem Kultbaum zu fällen. Sie wollen ihn auf Martin fallen lassen, die kann er durch ein einfaches Kreuzzeichen verhindern. Krypta: Sie befindet sich unter dem etwas erhöhten Chor. Sie ist 19 m lang und 9,20 m breit. Auf 12 Säulen ruht ein Kreuzgratgewölbe. Sie enthielt die angeblichen Reliquien der Maria Magdalena. Die zentralen runden Säulen stammen noch aus der romanischen Bauphase, die Kapitelle wurden im 13. Jahrhundert neu bearbeitet. Die anderen Säulen stammen dann aus gotischer Zeit. Nach dem Brand von 1265, wurde der Krypta-Boden 60 cm tiefer gelegt und man zog ein Kreuzgratgewölbe ein, bemalt mit falschen Steinen und Kreuzbögen. Im hinteren Teil der Krypta steht ein schlichter Altar mit einem Kruzifix. Die Wände sind mit bemalt. Informationstafel Romanisches Haus: es dient heute als Herberge für Pilger auf dem Jakobsweg. Die Pilger haben an ihren Taschen und Fahrrädern die bekannte Jakobsmuschel als Erkennungszeichen. Innenhof des romanischen Hauses. Straße mit historischen Häusern etwas unterhalb der Wallfahrtskirche. Gemauerte historische Bögen mit Blick in die Landschaft Der Uhrturm und Glockenturm des alten Saint-Pierre. Blick zurück in die Straße, die hoch zur Wallfahrtskirche führt. Rathaus Hinter dem Rathaus ein kleiner Garten mit Blick auf das Dach eines tiefer liegenden alten Hauses mit Dachgauben und Blick in die Landschaft. Informationstafel mit einem Luftbild von Vezelay. Gotischer Hauseingang mit einem Kielbogen. Altes Auto Blick auf einen Friedhof unterhalb der Wallfahrtskirche und die umgebende Landschaft. Gemswurz, gelbe Blume. Allee Porte Neuve: gut erhaltenes Stadttor aus dem 15. Jahrhundert. Allee unterhalb der alten Stadtmauer.
-
Clamecy: Stadt mit ca. 4.000 Einwohnern, die auf einem Felsplateau oberhalb des Flusses Yvonne, an der Einmündung des Beuvron und nur wenige Kilometer westlich von Vezelay gelegen. Nachdem sie bereits im 7. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde, ist sie im 14. Jahrhundert während des Hundertjährigen Krieges total zerstört worden. Église Saint-Martin: ehemalige Kollegialstiftskirche. Bereits im 8. Jahrhundert stand hier eine Kirche. Das Kollegialstift wurde dann 1075 vom Vicomte Guy de Clamecy gegründet. Am Anfang des 13. Jahrhunderts wurde mit einem Neubau begonnen, aber es wurden auch Teile des Vorgängerbaus verwendet. Am Anfang des 16. Jahrhunderts folgte die Westfassade und der Glockenturm im Süden. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika, ohne Querschiff, mit rechteckigem Chor mit Chorumgang – eine Seltenheit. Südseite der Basilika mit dem hohen Mittelschiff und den niedrigeren Seitenschiffe und Strebepfeilern. Westfassade: als sie gebaut wurde, verlängerte man das Kirchenschiff um ein Joch. Die Stadt hatte es inzwischen zu Reichtum durch die Flößerei von Brenn- und Bauholz gebracht und so entstand eine reich dekorierte Fassade im spätgotischen Flamboyant-Stil. Der restliche Außenbau wirkt dagegen sehr schlicht. Oben ein Giebelfeld mit großer Fensterrose. Der quadratische Turm im Süden hat 4 Geschosse und gleicht dem Turm der Kathedrale von Nevers. Wasserspeier Dem Portal im Westen, wurden während der französischen Revolution die Statuen geraubt. Nur die Figuren in den Archivolten haben sich erhalten. Dargestellt sind 32 Szenen aus der Legende des heiligen Martin. Bogenfelder links und rechts unterhalb der Nischen für die Figuren mit gotischem Maßwerk und Flachreliefs aus der Zeit der Renaissance. Sie zeigen Figuren und dekorative Formen. Tür aus Holz mit Schnitzereien im Motiven der Renaissance, zum Beispiel Medaillons mit Köpfen im Profil. Inneres: Grundriss, das Westportal liegt hier rechts auf dem Grundriss. Blick in das Mittelschiff Richtung Chor im Osten. Die beiden Seitenschiffe sind durch Spitzbogenarkaden vom Mittelschiff getrennt. Die Gewölbe sind mit Kreuzrippengewölben gedeckt. Der Beginn des rechteckigen Chorraums, ist durch eine Tribüne markiert, auf der ein Kruzifix steht. Die Tribüne stammt von Viollet-le-Duc und ersetzt eine ursprünglich vorhandene Empore aus dem 16. Jahrhundert. Ein Querschiff fehlt. Blick in das südliche Seitenschiff. Blick vom südlichen Seitenschiff durch das Mittelschiff, welches dreigeschossig gegliedert ist, Richtung nördliches Seitenschiff. Unten große Arkaden, darüber das Triforium und der Obergaden, mit dem für Burgund typischen Laufgang davor. Blick durch das Mittelschiff Richtung nördliches Seitenschiff. Hochaltar im rechteckigen Chor. Der rechteckige Chorumgang auf der südlichen Seite. An der Außenwand niedrige Rundbogenarkaden. Blick zum Hochaltar und dem dahinter liegenden nördlichen Chorumgang mit zwei Fensterrosen. Blick über den Hochaltar zurück zum Eingang im Westen mit der Orgel und der großen Fensterrose. Nördliches Seitenschiff Richtung Westen. Blick in das Mittelschiff mit der Kanzel aus Holz, Richtung Westen. Ein Kopf aus Stein an einer der Spitzbogenarkaden. Details der Rundbogenarkaden oberhalb der Kapitelle mit Köpfen. Farbige Glasfenster. Je weiter die Fenster im Westen sind, desto eher wurde gotisches Maßwerk verwendet. Fensterrosen: Maria mit dem Kind, umgeben mit den Vorfahren Jesu, der Wurzel Jesse. Blick zurück zur Kirche, auf den im Süden stehenden Turm. Rathaus Zwei alte Fachwerkhäuser. Turmfalke
-
Saint Fargeau: Der schon im 4. Jahrhundert erstmals erwähnte Ort hat heute ca. 1500 Einwohner. Er liegt ganz in der Nähe von Guédelon. Nach mehrfachen Besitzerwechseln, heiratete 1515 eine Erbin René d'Anjou (1409-1480) und so kam Saint Fargeau in den Besitz der königlichen Familie. Eine Kusine von König Ludwig XIV., die „Grande Mademoiselle“, Anne Marie Louise d'Orléans, Duchesse de Montpensier (1627-1693), wurde 1652 hierher verbannt. Sie ließ von François Le Vau (1624-1676) die Arbeiten am Schloss Saint-Fargeau ausführen, eine Sehenswürdigkeit im Ort. Le Relais du Château, eine ehemalige Poststation, jetzt Hotel. Innenhof Tour de l'horloge, der Uhrenturm. Bauernhof mit Fachwerkhäusern und Scheune. Fachwerkhaus mit Backsteinen zwischen den Stützen. Marktplatz Château de Saint-Fargeau: Ursprünglich stand hier ein 980 errichtetes Jagdhaus eines Bischofs. Der heutige Bau wurde ab 1453 errichtet. Das burgähnliche Schloss gehörte unterschiedlichen Familien. Seine Form ist ein unregelmäßiges Fünfeck mit sechs Türmen, um einen großen Hof. 1652 zog Anne Marie Louise d'Orléans, Duchesse de Montpensier (1627-1693) hier her. Die Cousine von Ludwig XIV. wurde nach den Ereignissen der Fronde (eine gegen den französischen Absolutismus gerichtete Bewegung des Hochadels 1648-52) zu 5 Jahren Exil in Saint-Fargeau verurteilt. 1713 kaufte die Familie Le Pelletier das Schloss und 1979 kam das baufällig gewordene Schloss in den Besitz von Michel Guyot, dem Begründer des Projektes von Guédelon. Grundriss Eingangstor aus zwei riesigen runden Türmen. Burggraben mit den Ställen daneben. Burggraben mit Pferd und den Häusern des Ortes. Eingangstor Wappen mit der königlichen Lilie über dem Tor. Anne Marie Louise d'Orléans, Duchesse de Montpensier (1627-1693) ließ das Schloss durch François Le Vau (1624-1676) in den Jahren 1653-1657 renovieren und modernisieren. Es ist eines der besten Beispiele für den französischen Klassizismus, was man besonders gut an den Fassaden den Innenhofes sehen kann. Innenhof Dach mit Laterne.
-
Guédelon (Treigny): in der Nähe von Saint-Fargeau, wird seit 1997 mit den Methoden und Materialien des 13. Jahrhunderts eine Burg erbaut. Der Begründer des Projektes Michel Guyot, der heutige Besitzer des Schlosses Saint-Fargeau, hatte seit Jahren diesen Traum. Man suchte lange nach einem geeigneten Platz, an dem auch ausreichend Baumaterial wie Stein, Holz und Wasser zur Verfügung steht. An einem stillgelegten Steinbruch begannen 1997 die Arbeiten. Vorbild ist die Festungsarchitektur aus der Zeit vom französischen König Philipp II. (1165-1223). Nach dem Baubeginn begannen Wissenschaftler der verschiedensten Bereiche, sich für das Projekt zu interessieren. So erhielt das Projekt eine Fachberatung und -begleitung von Kultur-, Bau und Kunsthistorikern, Architekten und Archäologen. Burg als Spielzeug mit Figuren in einem Laden. Andenkenladen bei der Burg, innen mit alten Balken und Treppen. Die Burg vom Eingang aus gesehen. In der Mitte die Torburg. Rechts beim östlichen Eckturm der Laufradkran. Das Projekt wird unter möglichst authentischen Bedingungen durchgeführt, entsprechend den Grundsätzen der experimentellen Archäologie. Daher tragen die Handwerker und Mitarbeiter mittelalterliche Gewänder. Laufradkran, der zwecks Arbeits- und Gesundheitsschutz allerdings eine Sicherheitsbremse erhielt. Weiter links ein weiterer Eckturm mit dem dahinter liegenden Kapellenturm. Handwerker auf der Festungsmauer. Fässer mit Mörtel Kalkbrennofen Innenhof der Burg mit dem Palas links und dem Bergfried rechts. Innenhof der Burg mit dem Palas rechts und dem anschließenden Kapellenturm. In der Mitte ein Kegel aus Steinen aus dem Steinbruch. Eine Treppe führt auf die mit Zinnen versehenen Mauern der Burg. Vor einem Eckturm steht eine Hubmaschine, die durch die Kraft eines Menschen bis zu 500 kg heben kann. Rechts daneben der Brunnen. Durch den Zugang zum Grundwasser im Burghof, den Wünschelrutengänger gefunden hatten und dem Auffinden 1998 eines riesigen, homogenen Sandsteins, konnte eine 2 x 2 m große und 30 cm dicke Platte als Monolithkappe für den Brunnen geschnitten werden. Informationstafeln Neben dem Brunnen können sich Kinder beim Bauen von Rundbögen mit Steinen ausprobieren. Ein Brett mit den beim Bau verwendeten mittelalterlichen Werkzeugen. Rechts oben eine Setzwaage. Sie ist der Vorläufer der Wasserwaage und besteht aus einem gleichschenkligen Dreieck, an dessen Spitze ein Lot aufgehängt ist. Inneres: Im Inneren eines Turms mit seinen Schießscharten. Sechsteiliges Kreuzrippengewölbe mit Bemalung, die Mauerwerk nachahmt. Das Erdgeschoss im Palas mit Vorratsraum und Küche mit Kamin als Herd und Backofen. An den Fenstern Sitzbänke aus Stein und eine kleine Mühle. Beschläge aus Metall in Form von Schlangen an einer Tür. Ein weiteres sechsteiliges Kreuzrippengewölbe. Informationstafel Das oberste Geschoss des Bergfrieds. Es hat einen Innendurchmesser von 6 m und die Mauern haben eine Dicke von 3,15 m. Schießscharten. In der Etage darunter, befindet sich ein Zimmer für den Burgherren mit Kamin. Sechsteiliges Kreuzrippengewölbe. Spitzbogiges Fenster mit Sitzbank davor und einer Leiter aus Holz. Mittelalterliche Toilette. Erste Etage im Palas mit dem Versammlungsraum oder Festsaal. Blick in den Dachstuhl aus Holz. Kamin. Informationstafel Die Fenster der Burgen aus dem 13. Jahrhundert bestanden aus Holz, welches mit einem durchscheinenden Schutz bedeckt war. Man verwendete Pergamentleder und gewachste Leinwand, die auf den Rahmen gespannt war und teilseise noch mit natürlichen Farben bemalt wurde. Gästezimmer oder auch Kemenate im Palas. Die Wände sind mit aus Naturmaterialien hergestellten Farben bemalt. Kamin Dachstuhl aus Holz. Kapelle in der ersten Etage des Kapellenturms: Informationstafel Nische mit dem Altar und einem Maßwerkfenster darüber. Es besteht aus 17 Natursteinen, die vorher passgenau gefertigt werden mussten und dann von einem Team in 3 Stunden zusammengesetzt und fixiert wurden. Spitzbogenfenster mit bemaltem Pergamentleder und Holzrahmen. Ansatz mit Konsolsteinen des Kreuzrippengewölbes. Dezente Waldmalerei im Gewölbe und an der Wand. Detail einer Konsole mit einer Rauchschwalbe. Blick von der Burgmauer auf den Eckturm neben dem Eingang, die Mauern mit Zinnen, unten im Hof in der Ecke den Brunnen und die Hubmaschine. Blick von der Burgmauer auf den Hof, den im Bau befindlichen östlichen Eckturm und die Torburg mit dem Eingang. Beim Bau des östlichen Eckturms hilft der Laufradkran, die schweren Steine nach oben zu befördern. Linke Seite der Burg mit Kapellenturm und Eckturm von außen. Rund um die Burg herum, befinden sich Hütten und Stände mit den verschiedenen mittelalterlichen Gewerken. Sie alle sind Zulieferer der Baustelle. Auf dieser Seite der Burg befindet sich der Steinbruch. Neben dem Steinbruch die Hütte der Steinmetze. Informationstafel. Die Steinmetze bearbeiten den im Steinbruch gewonnenen Sandstein. Ihre Hauptwerkzeuge sind Hammer und Meißel. Um ihre Arbeit zu messen und zu kontrollieren, verwenden sie die Setzwaage, das Lot und für die Konstruktion die Zwölfknotenschnur. Ein Handwerker in mittelalterlicher Kleidung erklärt einer Schulklasse die verschiedenen Funktionen der Zwölfknotenschnur. Der Bergfried neben dem Palas von außen. Hier ist der Stand der Korbflechterin. Die Hütte des Stellmachers. Pferdewagen, die die Steine, Holz und andere Materialien zur Baustelle transportieren. Stände der Ziegler und Töpfer. Hier werden die Dachziegel hergestellt und gelagert. Brennofen. Der Seiler zeigt einem Jungen wie die Seile gedrillt und gezwirnt werden. Am Rand des Geländes steht ein Wachturm aus Holz. Der Bergfried und die Baustelle des östlichen Eckturms vom mittelalterlichen Gemüsegarten aus gesehen. Informationstafel Mittelalterlicher Gemüsegarten und Kräuterkundigen. Im Mittelalter wurde ein Großteil der Nahrung in der Wildnis gesammelt. Hier werden auch verschiedene Nutztiere gehalten, wie zum Beispiel Gänse und Pferde. Direkt daneben haben die Tischler und Zimmerleute ihre Stände. Hier wird gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln einen dicken Baumstamm spalten kann. Weiter Richtung Ausgang der Anlage ist die Werkstatt des Schmieds und ein Werkzeugmacher. Nur einfach überdachte Küche. Färberei: Informationstafel. Unter dem Dach hängen die verschiedenen, mit Naturmaterialien gefärbten Stoffe. Informationstafel. Aus dem Boden von Guedelon können etwa fünfzehn Farben gewonnen werden. Aber auch Pflanzen bieten Material für Farben. Wandmalerei an dem Stand der Maler. Die gewonnenen Farben werden unter anderem für die Wandmalereien in der Burg verwendet. Details des Standes der Maler mit den verschiedenen Materialien, aus denen Farben gewonnen werden. Spatz, Haussperling auf einem blühenden Kirschbaums. Wandmalerei mit verschiedenen berühmten Persönlichkeiten Frankreichs, die einem Pierrot auf einer Schaukel zusehen.
-
Chartres: Die Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern, liegt 90 km südlich von Paris. Bereits unter den Karnuten, einem gallischen Volk, war es schon vor der Römerzeit ein wichtiger Ort und hieß „Autricum“. Dann im 4. Jahrhundert war es Bischofssitz, aber erst im 12. Jahrhundert kommt der Name Chartres vor. Im frühen Mittelalter gab es einer Grafschaft den Namen, die seit 956/960 im Besitz des Hauses Blois war. Unter Carnotensis Fulbertus, Bischof von Chartres (ca. 960-1028) entwickelte sich hier eine Domschule, ein wichtiges Zentrum der mittelalterlichen Bildung. Die Normannen belagerten 911 die Stadt und zerstörten sie 1019 fast ganz. 1286 kaufte König Philipp IV. (1268-1314) die Stadt und König Franz I. (1494-1547) machte Chartres zu einem Herzogtum und ließ sich 1594 hier krönen. Wichtigste Sehenswürdigkeit ist die seit 1979 zum UNESCO-Welterbe gehörende Kathedrale Notre-Dame. Stadtplan Denkmal für François-Séverin des Graviers Marceau (1769-1796), einem General der ersten Französischen Republik. Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges. Wandmalerei von James Cochran (1973-) genannt Jimmy C, an einer Hauswand. Die Kathedrale von weitem mit der Wandmalerei links daneben. Beet mit Blumen Gefüllte Osterglocken. Historische Häuser am Platz vor der Kathedrale. Einige Häuser sind neugotisch. Einige bauliche Details. Schaufenster mit christlichen Devotionalien. Kathedrale Notre-Dame: Die Kirche wirkt in der immer noch relativ kleinen Stadt absolut dominierend und ist in der flachen Landschaft schon von Weitem sichtbar. 876 weihte Kaiser Karl der II. (823-877) hier eine Kirche, die die Reliquie einer Tunika enthielt, die Maria bei der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel getragen haben soll. Chartres war mit dieser Reliquie ein Zentrum der Marienverehrung in ganz Europa. Als bei dem Brand der Stadt 1019 die Reliquie unversehrt blieb – einige kluge Priester hatten sie vorher in die Schatzkammer gebracht – sah man das als eine himmlische Aufforderung, eine neuen prächtigeren Kirchenbau zu finanzieren. Auch sollte natürlich der Pilgerstrom nicht abreißen, der ein wichtiger finanzieller Faktor war. Der heutige Bau entstand nach 1194 und wurde 1260 geweiht. Sie ist ein typisches Beispiel für die frühe französische Gotik. Chartres ist im Gegensatz zu zahlreichen anderen Kirchen nie zerstört worden. Sie hat den Bildersturm der Hugenotten und die Französische Revolution fast unbeschadet überstanden. Auch sind nahezu alle 176 Glasfenster erhalten und so vermittelt das Innere die Atmosphäre der Gotik auf unverfälschte Weise. Der Bau ist über 130 m lang und 64 m breit. Grundriss: dreischiffige Basilika mit Querschiff und Chor mit Umgang und Kapellenkranz. Sie ist in südwestlich-nordöstlicher Richtung angelegt, nicht wie üblich westlich-östlich. Im Winkel des nördlichen Querschiffs befindet sich die quadratische Sakristei. Am Chor angebaut ist die Sankt-Piat-Kapelle. Westfassade: Der untere Teil der Westfassade stammt aus der Zeit ab circa 1134. Damals entstand der linke Turm und das Portal. Der rechte Turm im Süden entstand 1145–1160. Er hat eine Höhe von 105 Meter. Erst 1500–1513 wurden auf dem linken Turm im Norden, die oberen Geschosse im Flamboyant-Stil aufgesetzt. Er ist mit 115 Metern etwas höher. Gesamtansicht Linke, nördliche Turmspitze und Details im spätgotischen Flamboyant-Stil. Der Helm des nördlichen Turms wurde 1513 von Jean Texier (? - 1529), genannt Jean de Beauce fertiggestellt. Zwischen den Türmen befindet sich ein Giebel mit einer Statue von Maria mit dem Kind, flankiert von zwei Engeln. Darunter die Königsgalerie mit 16 Blendarkaden mit gotischen Formen mit Statuen verschiedener Könige. Den Mittelteil der Westfassade bildet das Königsportal, die drei hohen Fenster darüber, sowie eine große Fensterrose. Fensterrose Unterhalb der Fensterrose befinden sich 2 skulptierte Tierdarstellungen. Rechts ein Löwe, der den Kopf eines Menschen hält. Gesamtansicht der 3 Portale im Westen: Sie wurden wie die beiden Türme in der Mitte des 12. Jahrhunderts errichtet und zeigen den Übergang zwischen Romanik und Gotik. Die Statuen von 1145-1150, sind die ältesten erhaltenen gotischen Statuen der Kunstgeschichte. Die älteren Statuen von Saint-Denis sind leider zerstört. Die Anlage ist das erste erhaltene Stufenportal, bei dem sowohl an den seitlichen Gewänden, auf den Türstürzen, den Tympana und an den Archivolten Skulpturen zu finden sind. Links mit der Himmelfahrt Christi, in der Mitte das Königsportal, rechts Menschwerdung Christi. Linkes Portal mit der Himmelfahrt Christi: Im linken Gewände sind von links nach rechts Statuen eines Königs, dessen Kopf später als Frauenkopf erneuert wurde, ein weiterer König mit Buch und eine Herrscherin. An den Stellen, wo sich heute Säulen befinden, gab es früher weitere Statuen. Die Kapitelle der Säulen sind zu einem einzigen, die ganze Portalanlage überziehenden Fries verbunden. Auf zwei Strängen sind circa 40 Szenen, mit fast 200 kleinen Figuren, dargestellt, die unter anderem aus den apokryphen Schriften stammen. Hier oben rechts der Kindermord von Bethlehem und die Flucht von Maria und Josef nach Ägypten. Im rechten Gewände ist nur noch Moses mit den Gesetzestafeln zu identifizieren. Zwischen den Statuen sind immer schmale Säulen mit floralen Motiven und zum Teil auch Fabelwesen, wie man es noch aus der Romanik kennt. Grundsätzlich ist die Kleidung der Statuen sehr streng, mit parallel verlaufenden Falten dargestellt. Im Tympanon wird die Himmelfahrt Christi gezeigt, flankiert von zwei Engeln und auch darunter mehrere Engel. Auf dem Türsturz die Apostel. Auf den Archivolten Darstellungen die sogenannten Monatsarbeiten, wie zum Beispiel das Schneiden von Getreide und Tierkreiszeichen. Links und rechts unten jeweils ein dicker Käfer oder Fabelwesen mit Gesicht. Außerdem rechts das Schlachten eines Schweins. Mittleres Portal, genannt das Königsportal: Das linke Gewände zeigt von außen nach innen: eine Königin von Juda, einen Patriarchen und einen Propheten. Die Statuen werden von innen nach außen hin länger, während die Köpfe in derselben Ebene bleiben. Im rechten Gewände ganz links ein Prophet oder Patriarch, dann König David, dann wahrscheinlich Batseba, Davids Gemahlin oder auch die Königin von Saba. Ganz rechts König Salomon, Davids Sohn. Im Fries über den Figuren rechts, am Übergang zum nächsten Portal der Tisch mit dem letzten Abendmahl. Im Tympanon Christus in der Mandorla, umgeben von den Evangelistensymbolen. Auf dem Türsturz wieder die Apostel. Die sitzenden Figuren der beiden oberen Archivolten zeigen die Ältesten des jüngsten Gerichts, auch als „Apokalyptische Greise“ bezeichnet. In der inneren Archivolte Engel. Rechtes Portal mit der Menschwerdung Christi: Das rechte Portal ist heute der Eingang zur Kirche. Das mittlere Portal wird nur zu besonderen Anlässen geöffnet. Die Identifizierung der Figuren im linken Gewände ist bis heute nicht möglich. In dem Figurenfries über den Köpfen, sieht man den Rest des langen Tisches vom letzten Abendmahl mit dem knienden Judas. In der Mitte der Judaskuss, weiter rechts reitet Jesus auf einem Esel in den Tempel, rechts die Grablegung Christi, ganz rechts die schlafenden Wächter bei der Auferstehung. Im rechten Gewände links ein Apostel, dann ein König und eine Königin. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass grundsätzlich bei den Portalen die einzelnen Szenen nicht mehr unbedingt der originalen Anordnung entsprechen, weil sie zum Teil bereits im Mittelalter verändert wurden. Im Tympanon sitzt Maria mit dem Kinde aus dem sogenannten „Thron der Weisheit“, flankiert von zwei Engeln. Auf dem Streifen darunter die Darbringung Christi im Tempel, wobei Christus leider der Kopf fehlt. Auf dem Türsturz von links nach rechts die Verkündigung, die Heimsuchung, in der Mitte Maria im Wochenbett und darüber, als Doppelszene, die Geburt Jesu mit Joseph, Maria, den Hirten und auf dem Wochenbett die Krippe mit dem Jesuskind. In den Archivolten links unten Aristoteles, der als älterer Mann am Schreibpult sitzt mit Tintenfass und Schreibfeder. Darüber die weibliche Personifikation der Dialektik. Über den Portalen skulptierte Konsolen mit Gesichtern, Fratzen und Tieren. Spatz, Haussperling auf dem Kopf eines Engels. Südseite: Engel mit Sonnenuhr: An der Südwestecke des Turmes steht ein Engel aus dem 12. Jahrhundert mit Sonnenuhr. Er stammt eigentlich aus der Saint-Fulbert-Kirche und wurde erst später mit Flügeln versehen und hier angebracht. Das Original steht aus konservatorischen Gründen in der Krypta. Die Sonnenuhr entstand später, sie trägt die Jahreszahl 1578. Statue eines Esels mit Leier. Daneben ein Rundbogenarkade. Reste der Statue eines Tieres. Südseite der Kirche mit ihren Türmen. Detail von zwei Rundbogenfenstern im südlichen Turm. Skulptierte Konsolen mit Gesichtern, Fratzen und Tieren. Blick auf die Südseite mit ihren Glasfenstern und Fensterrosen, den Strebepfeilern mit Statuen von Heiligen, die auf Fratzen stehen. Am südlichen Querschiff sind Baugerüste angebracht. Blick auf die Fassade des südlichen Querschiffs. Thema ist hier das Neue Testament und das jüngste Gericht. Erbaut zwischen 1220-1230. Über den drei Portalen mehrere Fenster mit Spitzbogen, Blendarkaden mit Rundbogen und oben eine große Fensterrose. Rechts und links davon mehrere offene Spitzbogen und ganz oben ein Giebel mit Maria mit dem Kind, flankiert von zwei Engeln. Vor dem Querschiff ein Fenster mit Maßwerk im Flamboyant-Stil. Es wird flankiert links von der Statue eines Engels und eines Mönchs und rechts von zwei weiblichen Statuen. Der Vorbau der südlichen Portale von der Seite gesehen. Oben eine Galerie von Statuen von Königen unter offenen Spitzbogenarkaden. An den quadratischen Pfeilern des Portalvorbaus werden Geschichten von Märtyrern, Tugenden und Sünden dargestellt. Linkes Portal mit Märtyrern: Am Bogen des Portalvorbaus kleine Statuen von Engeln. Rechts unten der Erzengel Michael der auf einem Dämonen steht. Im linken Gewände links wahrscheinlich der heilige Ritter Roland mit der französischen Lilie auf dem Schild oder der heilige Theodor als eine der vollkommenen Verkörperungen des ritterlichen Menschenideals im 13. Jahrhundert. Im Sockel sieht man einen König beim Götzendienst. Zwei Diakone und ein Papst – wohl der heilige Stephan, der heilige Laurentius und der heilige Klemens. Im rechten Gewände wieder zwei Diakone und ein Papst – zwischen dem heiligen Vincentius und dem heiligen Piatus, entweder der heilige Ignatius von Antiochien oder der heilige Denis. Ganz rechts der heilige Georg, dessen Martyrium, das Rädern im Sockel dargestellt ist. Im Gegensatz zum Königsportal an der Westfassade, hat sich ein stilistischer Wandel vollzogen. Die Statuen sind nicht mehr ganz so extrem schlank und streng. Die Körper sind lebensnacher und die Gewänder haben mehr Volumen. Im Tympanon Christus flankiert von zwei Engeln. Auf dem Türsturz die Steinigung des heiligen Stephanus. Details der Archivolten Im Bogen des Portalvorbaus links die klugen Jungfrauen und rechts die törichten Jungfrauen. An den quadratischen Pfeilern des Portalvorbaus werden Geschichten von Märtyrern, Tugenden und Sünden dargestellt. Oben im Giebelfeld des Portalvorbaus eine sitzende Figur, die ein Gefäß hält und von zwei Engeln flankiert wird. Darüber ein Kreuz. Am Übergang zum Mittelteil des Portalvorbaus wieder offene Spitzbögen mit Statuen von Königen. Mittleres Portal mit dem Jüngsten Gericht: Statue eines Apostels mit Schwert, als Zeichen seines Martyriums, kurz vor dem linken Gewände. Im linken Gewände 5 weitere Apostel, der sechste ist im Hintergrund zu sehen (vgl. Bild vorher). 3 Apostel mit Schwert, als Zeichen ihres Martyriums, dann Andreas mit Kreuz und ganz rechts Petrus mit Schlüssel und Kreuz. Die insgesamt 4 Apostel mit Schwert müssen Simon, Judas, Philippus und Thomas sein, obwohl man sie nicht einzeln identifizieren kann. In den Sockeln sind jeweils ihre Verfolger dargestellt. Im rechten Gewände 5 weitere Apostel. Links Paulus mit Stirnglatze, dann Johannes ohne Bart. In der Mitte Jakobus der Ältere mit umgehängten Muscheln, seinem Attribut und Jakobus der Jüngere mit Keule. Danach weiter rechts Bartholomäus mit abgebrochenem Messer und Matthäus, der wie Johannes ein Buch hält. Blick auf den Trumeaupfeiler und Teile des rechten Gewändes. Christus steht auf den Mächten des Bösen, einem Löwen und einem Drachen. Im Tympanon das Jüngste Gericht. Christus zeigt seine Wundmale, Maria und Johannes in gleicher Größe neben ihm, sitzend und nicht kniend. Engel halten seine Leidenswerkzeuge. Auf dem Türsturz in der Mitte der Erzengel Michael mit der Waage. Links die Seeligen, rechts die Verdammten, die auf das Höllentor zulaufen. In den Archivolten erhaben sich die Toten aus ihren Gräbern und zahlreiche Engel. Links in der Archivolte fast ganz innen, sitzt Salomon und hält die Seligen in seinem Schoß. Blick auf die Südseite der Kathedrale und den Chor, sowie die ganz hinten angebaute Saint-Piat-Kapelle. Zwischen mittlerem und rechtem Portal, auf dem Portalvorbau wieder Statuen von Königen. Rechtes Portal: Thematisch ist es denjenigen Personen gewidmet, die die christliche Lehre in Schrift und Tat am besten vertreten haben. Im linken Gewände der Lokalheilige Laudomar, Papst Silvester, der Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand und ganz rechts der heilige Nikolaus. Im rechten Gewände links der heilige Martin, der heilige Hieronymus mit seiner Bibelübersetzung, der heilige Papst Gregor mit der Taube des heiligen Geistes auf der Schulter. Ganz rechts der Lokalheilige Avitus (Alcimus Ecdicius Avitus), ehemals Bischof von Vienne. Die beiden Statuen der Lokalheiligen datieren etwas später. Auf dem Türsturz die guten Taten von Martin (links) und Nikolaus (rechts). Darüber im Tympanon weitere Szenen. Details der rechten Archivolten. An den quadratischen Pfeilern des Portalvorbaus werden Geschichten von Märtyrern, Tugenden und Sünden dargestellt. Am Ende des Portalvorbaus wieder Könige in offenen Spitzbogenarkaden. Blick auf die Südseite des Chors. Blick auf den Kapellenkranz von Südosten mit frühgotischen Fenstern. Saint-Piat-Kapelle: Auf den Kapitelsaal wurde 1332–1342 die Kapelle Saint-Piat gesetzt. Sie diente der Aufbewahrung der Reliquien des heiligen Piat. Eingewölbt wurde sie allerdings erst 1358-1365. Die Kapelle ist über eine Treppe vom Chorumgang aus zugänglich. Heute beherbergt sie Goldschmiedekunst und liturgische Geräte. Aufriss der Kapelle und des darunter liegenden ehemaligen Kapitelsaals. Grundriss der Kapelle. Informationstafel. Blick zurück auf den Chor. Ehemalige Klostergebäude an der Südseite der Kathedrale mit Gedenktafel für Johannes von Salisbury (ca. 1115-1180), ehemaliger Bischof von Chartres. Nordseite: Nordseite der Kathedrale. Blick auf das nördliche Querschiff und den auf der Nordwestseite stehenden Uhr-Pavillon. Uhr-Pavillon: der Pavillon mit der astronomischen Uhr wurde um 1520 von Jehan de Beauce gebaut. Spitzbogenfenster mit Archivolten, Kapitellen und darunter skulptierte Konsolen. Blick auf die Nordseite mit ihren Glasfenstern und Fensterrosen, den Strebepfeilern mit Statuen von Heiligen. Blick von der Seite auf das nördliche Querschiff mit seinen Portalen. Dahinter die im 13. Jahrhundert errichtete Sakristei, deren Fenster Maßwerk haben. Rechts außen am Portalvorbau zwei Statuen, links ein Bischof, rechts die heilige Modesta. Das mittlere und das rechte Portal des nördlichen Querschiffs. Thema der Portale im Norden ist das Alte Testament und das Leben Marias, daher wird in seiner Gesamtheit als Marienportal bezeichnet. Die Portale sind zwischen 1200 und 1225 entstanden. Ein niedriges Baugerüst steht davor. Das linke und das mittlere Portal des nördlichen Querschiffs. Links neben den Portalen, die im späteren 13. Jahrhundert errichtete Sakristei mit Maßwerkfenstern. Oberer Teil der Fassade des nördlichen Querschiffs. Zwei kleine Türme flankieren eine große Fensterrose und fünf spitzbogige Fenster. Rechts und links daneben 2 Etagen mit offenen Spitzbogenarkaden. Über der Fensterrose eine offene Galerie mit Arkaden, darüber im Giebel eine Statue der Maria mit dem Kind und kniende Figuren. Rechtes Portal: Gesamtansicht. Statuen links am Portalvorbau von Ahnen und Zeugen Christi. Statuen rechts am Portalvorbau von Ahnen und Zeugen Christi. Im linken Gewände Balaam auf seiner Eselin und die Königin von Saba. Sie steht auf einem Diener, der dem neben ihr stehenden König Salomon ein Geschenk bringt. Im rechten Gewände links Jesus Sirach, ein mittelalterlicher Theologe, dann Judith. Ganz rechts Joseph, einer der Söhne Jakobs. Zu seinen Füßen Pontiphars Frau, die den böswilligen Eingebungen eines Drachen lauscht. Im Tympanon eine selten dargestellte Szene. Ein Mann im Lendenschurz liegt auf einen Dunghaufen. Er steht unter der Drohung eines Ungeheuers. Es sind die Leiden des Hiob, der hier von seinen Freunden in seinem Elend besucht wird. Darunter auf dem Türsturz das Urteil des Salomon. Archivolten sind verschiedene Heilige dargestellt. An den Bögen des Portalvorbaus die Tierkreiszeichen und die Monatsarbeiten. Mittleres Portal: Oberer Teil des mittleren Portals mit Archivolten und Tympanon. Statue links vom Portal unter dem Portalvorbau. 2 Statuen am Portalvorbau, links vom Portal. Im linken Gewände links Priesterkönig Melchisedech, dann Abraham, der seine schützende, väterliche Hand unter das Kinn von seinem Sohn Isaak, den er vorhat zu opfern. Dann Moses mit den Gesetzestafeln, daneben Aaron, der ein Lamm tötet – das Symbol für die Opferung Christi. Neben der Tür König David mit Speer und Dornenkrone. Im rechten Gewände links der Prophet Isaias, der auf dem liegenden Jesse steht. Dann der Prophet der Passion Jeremias, der ein Kreuz auf dem Arm trägt. Simeon mit dem Christuskind auf dem Arm und Johannes der Täufer. Seine Füße zertreten einen Drachen und er weist auf das Lamm Gottes in seinem Arm. Ganz rechts Petrus mit Schlüssel, dessen leider zerstörter Kelch, das geopferte Fleisch und Blut Christi enthält. Vier Statuen rechts vom Portal am Portalvorbau. Im Tympanon Maria unter einem Thronbaldachin mit Christus, der sie segnet. Rechts, links und darüber Engel. Auf dem Türsturz darunter der Tod und die Himmelfahrt Mariens. In den Archivolten von innen nach außen: Engel, Propheten, 2 mal Vorfahren von Jesus in den Ranken der Wurzel Jesse, dann noch einmal Propheten. An den äußersten Bogen des Portalvorbaus hier zum Beispiel die Verfehlungen von Adam und Eva. Linkes Portal: Gesamtansicht Im linken Gewände außen mit Schriftrolle wahrscheinlich Isaias und daneben die Verkündigung.
Im rechten Gewände die Szene der Heimsuchung und ganz rechts mit Schriftrolle wahrscheinlich Daniel. Im Tympanon die Anbetung der heiligen drei Könige. Im Türsturz die Geburt Jesu und die Verkündigung an die Hirten. Zwischen den beiden Bereichen ist eine Reihe Engel dargestellt. In den Archivolten innen Engel. Danach links die törichten und rechts die klugen Jungfrauen. Im dritten Bogen die Tugenden und Laster. Links im 3. Bogen zum Beispiel die Klugheit mit einem Buch, die Gerechtigkeit mit der Waage. Rechts im 3. Bogen zum Beispiel der Glaube mit dem Kelch, die Hoffnung, die gen Himmel blickt oder die Liebe, die ihr Gewand verschenkt. Außen Könige und Königinnen. An den äußersten Bogen des Portalvorbaus weitere kleine Statuen. Blick auf das Querschiff, die Sakristei und die nördliche Seite des Chors, umgeben von einem kleinen Garten. Nördliche Seite des Chores mit seinem Kapellenkranz und links die Kapelle Saint-Piat. Im Norden schließt das Gebäude des Musée des Beaux-Arts an, welches im ehemaligen Bischofspalast untergebracht ist. Inneres der Kathedrale: Grundriss Blick vom Eingang im Westen durch das Mittelschiff, 1220 vollendet, 36,5 m hoch. Mit 16,4 m Breite besitzt die Kathedrale das breiteste Mittelschiff in Frankreich. Die Breite ergab sich aus den Grundmauern der Vorgängerkirche, denn auf diesen Grundmauern wurde die neue Kathedrale errichtet. Die Wandgestaltung des Mittelschiffs ist in drei Zonen aufgeteilt. Unten die Spitzbogenarkaden als Trennung zu den Seitenschiffen, ein Triforium und der Obergaden, der genauso hoch ist, wie die unteren Arkaden, mit großen Fenstern. Dieser dreiteilige Aufriss sollte künftig für gotische Basiliken typisch werden. Blick in das vierteilige Kreuzrippengewölbe. Chartres ist wohl die erste Kathedrale, bei der diese Gewölbeform im Mittelschiff angewendet wurde. Kreuzgratgewölbe waren schon früher in den Seitenschiffen üblich. Im Mittelschiff befindet sich die Orgel, als eine Schwalbennestorgel. Bereits im 14. Jahrhundert hat es hier eine Orgel gegeben, über die man aber außer der Auftragserteilung wenig weiß. Mehrfach wurde die Orgel erneuert und erweitert. Nach einem Brand 1836, wurde die Orgel vom Orgelbauer Gadeult restauriert. Das Orgelgehäuse stammt in seinem Kernbestand von 1475 noch von Gombault Rogerie. Das heutige Orgelwerk wurde vom Orgelbauer Georges Danion (1922-2005) in den Jahren 1969-1971 geschaffen. Blick von der Vierung in den Chor. Links im Querschiff sieht man noch dunkle, ältere Bauteile von der Vorgängerkirche, die genauso wie das Westwerk den Brand von 1194 überstanden hatten und in der neuen Kirche wieder Verwendung fanden. Chorraum mit dem Hochaltar Blick in das Gewölbe des Chorraums. Gewölbe im Abschluss des Chorraums mit Schlussstein. Chorraum Hochaltar mit einer Marmorstatue der Himmelfahrt Marias. Drei Engel heben sie auf einer Wolke empor. Blick vom Chorumgang in den Chorraum. Blick durch den Chorraum Richtung Westen zum Eingang mit der großen Fensterrose. Blick vom nördlichen Seitenschiff auf das berühmte Labyrinth im Mittelschiff und die Aufteilung in drei Zonen der Mittelschiffwand. Im Boden eingelassen ist ein um 1200 entstandenes Labyrinth. Es ist nicht nur das größte erhaltene, sondern auch eines der wenigen die im Original erhalten sind. Es hat einen Durchmesser von 12,5 m und der meditative Weg ist 261,55 m lang. In der Mitte befand sich ursprünglich eine Metallplatte mit Theseus und dem Minotaurus. Blick in ein Seitenschiff. Chorkapelle mit dem Sancta Camisia, welches Chartres 876 von König Karl dem Kahlen (823-877) gestiftet wurde. Man nahm an, dass es sich dabei um die Tunika handelt, die Maria bei der Verkündigung durch den Erzengel Gabriel getragen haben soll. Heute ist ein ca. 30 x 30 cm großes Tuch in einem modernen Reliquar mit zwei Engeln in der Kapelle zu sehen. Informationstafel Marienkapelle mit neugotischer Wand aus Holz mit kleinen Statuen von Heiligen und einer Statue der Maria davor. Detail der Statue der Maria mit besticktem Umhang aus Brokat. Farbige Glasfenster in der Marienkapelle. Gesamtansicht einer weiteren Chorkapelle. Detail des Schlusssteins in dieser Kapelle. Details der farbigen Glasfenster in dieser Kapelle. Das Fenster in der Mitte ist das Nikolaus-Fenster. Im unteren Teil Geburt und Kindheit vom heiligen Nikolaus, in der Mitte die Weihe zum Bischof von Myra und ganz oben erweckt er drei getötete Studenten wieder zum Leben. [P1310707-P1310709] Weitere farbige Glasfenster im Chor: Fenster des heiligen Martin. Unten links teilt er seinen Mantel mit einem Bettler. 3 Felder darüber rechts lässt er einen Baum auf Heiden fallen und darunter wird er vom heiligen Bischof Hilarius von Poitiers begrüßt. [P1310710] Zwei weitere Fenster im Chorumgang, 13. Jahrhundert. Fast im Chorhaupt gelegen, das Fenster Karls des Großen links, gestiftet von den Kürschnern, die links dargestellt sind. Im unteren, auf der Spitze stehenden Quadrat, besucht Karl der Große Kaiser Konstantin am Stadttor von Konstantinopel. Darüber kniet Karl am Altar des Aachener Doms. Darüber der Aufbruch zum ersten spanischen Kreuzzug. Dann darüber verschiedene Kriegsszenen und der Zweikampf auf Pferden zwischen Roland und dem Sarazenenkönig Marsilius mit grüner Krone. Anlässlich der Restaurierung dieses Fensters 1921, wurden die Reihenfolge einiger Scheiben verändert. Das Fenster rechts daneben ist dem Heiligen Jakobus dem Älteren gewidmet. Die Stifter sind die Tuchhändler. Sie sind wieder ganz unten abgebildet. Direkt darüber reicht Christus Jakobus einen Pilgerstab. Beide Fenster sind aus dem 13. Jahrhundert. [P1310712] Weitere farbige Glasfenster im Chorumgang. Fenster in der mittleren Chorkapelle aus dem 13. Jahrhundert. In der Mitte die Verkündigung und Heimsuchung, eine Stiftung der Bäcker. Links daneben Aaron und ein Engel und noch weiter links David, Ezechiel und Cherubim, eine Stiftung der Fleischer. Rechts vom mittleren Fenster Moses mit dem brennenden Busch, Isaias und ein Engel, Stiftung der Bäcker. Rechts davon Daniel, Jeremias und Cherub, Stiftung der Tuchhändler. [P1310716 + P1310717] Am Beginn des südlichen Chorumgangs das Fenster des heiligen Antonius und dem Eremiten Paulus von Theben. [P1310718] Direkt daneben das Fenster der Blauen Jungfrau. Im südlichen Chorumgang haben sich in einem Fenster aus dem frühen 13. Jahrhundert, 4 Scheiben von ca. 1150 erhalten. Sie zeigen die gekrönte Maria mit dem Christuskind. Auf beiden Seiten Engel und darunter die Hochzeit von Kanaa. Ganz unten die dreifache Versuchung Christi. [P1310719] Fenster des Marienlebens, frühes 13. Jahrhundert, 1993 restauriert. Es befindet sich neben dem Fenster der Blauen Jungfrau. Ganz unten links Weinbauern beim Schneiden von Reben, die Stifter des Fensters. Im unteren Bereich die Darstellung anhand der Texte der Apokryphen von Marias Vorfahren und ihrer Kindheit, bis zu ihrer Vermählung mit Joseph. Im oberen Bereich ihre Rolle als Mutter von Jesus. So in der Mitte die Verkündigung. Oben der Kindermord von Bethlehem und die Flucht nach Ägypten. [P1310720] Das Tierkreiszeichenfenster aus dem frühen 13. Jahrhundert, 1993 restauriert, gestiftet von den Weinbauern. Die Tierkreiszeichen befinden sich überwiegend auf der rechten Seite und links die entsprechenden monatlichen Arbeiten. [P1310721] Gewölbe im Chorumgang Lettner: die Domherren beauftragen Jean de Beauce (? - 1529), nach der Fertigstellung des nördlichen Turms 1513, mit der Errichtung einer Chorschranke. Zuerst wurden die beiden ersten Arkaden links und rechts durch den Lettner geschlossen. Dieser Lettner im spätgotischen Stil reichte nicht weiter als bis zum Hochaltar, der damals wesentlich weiter vorne, im 2. Joch des Chores stand. Einige Jahre später rückte der Altar weiter Richtung Chorhaupt und so erweiterte man den Lettner von 1520-1530. Jetzt nahm er bereits Züge der Renaissance an. Von den 40 Nischen, die das Leben Jesu und Marias zeigen sollten, waren noch mehr als die Hälfte nicht realisiert. Je nach den Einkünften wurden die Arbeiten bis zum Jahr 1714 fortgesetzt. Informationstafel Die ältesten Teile von Jean Soulas, 1519-1525 entstanden: links verdeckt empfängt Joachim die Botschaft von der Geburt Marias durch einen Engel. Daneben empfängt seine Frau Anna die gleiche Botschaft. Rechts daneben begegnen sich Joachim und Anna an der Goldenen Pforte. Lettner mit Durchgang zum Chor. Links die Geburt Marias. Ab hier weiter rechts sind 8 Darstellungen von unbekannten Meistern aus den Jahren 1525-1540. Über der Tür wird das Mädchen Maria zur Tempelschule gebracht, im Hintergrund steigt sie die Stufen zum Tempel empor. Daneben die Verlobung von Joseph und Maria vor dem Hohepriester. Verkündigung, Maria kniend unter einem Baldachin, rechts der Engel. Rechts daneben die Heimsuchung. Treppenturm im Renaissancestil. Es ist der Zugang zu einem kunstvollen Uhrwerk, welches leider in der Zeit der Revolution verschwunden ist. Astronomische Uhr, die die Stunden, Wochentage, Mondphasen und den Sonnenlauf zeigt. Joseph träumt von dem Mysterium der Menschwerdung Christi. Neben ihm sitzt Maria mit einer Näharbeit. Rechts daneben die Geburt Jesu mit Engeln. Die Beschneidung Anbetung der heiligen drei Könige. Die drei Weisen erscheinen in der Kleidung des Hofes von König Franz I. Die nächsten 2 Szenen sind 1542 von François Marchand (1500-1551) geschaffen worden. Darstellung Jesu im Tempel, wobei nur die Statue des Simeon noch original ist. Rechts daneben die Ermordung der unschuldigen Kinder in Bethlehem. Die Taufe Jesu, 1543 von Nicolas Guybert. Rechts daneben die Versuchung Jesu in der Wüste, auf dem Berge und auf der Zinne des Tempels, 1612 von Thomas Boudin (1570-1637). Auch die nächsten 2 Szenen stammen von Thomas Boudin. Das nanaäische Weib erfleht die Heilung ihrer Tochter. Die Verklärung Christi. Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Tabor, seine Erscheinung steht zwischen Moses und Elias. Die Ehebrecherin. Jesus schreibt in den Sand und beschämt die Ankläger. 1681 von Jean de Dieu (1646-1727) geschaffen. Die Heilung des Blinden, 1682 geschaffen von Pierre Le Gros (1666-1719). Danach ist eine Lücke ohne Baldachin. Sie befindet sich in der Mitte des Chorumgangs. Hier wurden ehemals die Reliquien der Heiligen Saint Piat, Saint Lubin und anderer Heiliger präsentiert. Jetzt stehen hier Statuen, die den heiligen Martin zeigen, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt. Gesamtansicht des Lettners auf der nördlichen Seite des Chores. Der Einzug von Jesus auf einem Esel in Jerusalem geht über zwei Nischen. 1702 von Jean Tuby (1665-1735) geschaffen. Detail der Arkaden und Medaillons darunter. Die nächsten Szenen in den Nischen sind von Simon Mazière, 1714 datiert. Es beginnt mit der Todesangst von Jesus am Ölberg. Der Judaskuss und Petrus schlägt Malchus das Ohr ab. Jesus vor Pilatus. Die Geißelung von Jesus. Die Dornenkrönung und daneben, über einem Durchgang zum Chor die Kreuzigung. Die Kreuzabnahme. Die nächsten 3 Szenen sind wieder aus dem Jahr 1611, also wesentlich älter und stammen von Thomas Boudin (1570-1637), dem gleichen Künstler, der auch auf der Südseite Statuen geschaffen hat. Es beginnt mit der Auferstehung. Fromme Frauen am Grab, auf dem ein Engel sitzt. Jesus und die Jünger von Emmaus. Der ungläubige Thomas. Die Szenen danach aus der Zeit um 1520, also auch wesentlich älter, stammen von einem unbekannten Meister. Als erstes erscheint Jesus seiner Mutter Maria. Christi Himmelfahrt. Die Herabkunft des Heiligen Geistes, das Pfingstwunder. Über einem weiteren Durchgang zum Chor sieht man Johannes und Maria kniend unter dem Kreuz. Rechts daneben der Tod Marias. Detail der Tür aus Holz und der sie umgebenden kleinen Statuen von Heiligen. Der Tod Marias und Maria wird zu Grabe getragen. Das Begräbnis Marias Krönung Marias Details einiger Kapitelle: Vögel die aus einem Kelch trinken, ein Kentaur mit Pfeil und Bogen, ein Löwe im Kampf mit einem Mann. Seitenaltar mit vielen Kerzen vor einem großen Schrank aus Holz mit goldfarbenen Verzierungen. Farbige Glasfenster: Fensterrose im Westen. Die 3 Fenster unter der Fensterrose, geschaffen im 12. Jahrhundert vom Atelier St. Denis. Links die Passion Christi und die Auferstehung. In der Mitte das Leben Christi bis zum Einzug nach Jerusalem, genannt das Menschwerdungsfenster. Ganz oben die thronende Maria, flankiert von 2 Engeln. Darunter der Einzug in Jerusalem in 3 Bildern. Darunter links die stürzenden Götzenbilder, die Taufe Christi und Josephs Traum. So geht das Leben Jesu bis zum unteren Rand des Fensters. In der 3. Reihe v on unten die Anbetung der Weisen bzw. der heiligen drei Könige, darunter links die Verkündigung an die Hirten. Wurzel Jesse, also die Abstammung Jesu rechts. Es entstand um 1150. Ganz unten liegt Jesse, aus ihm wächst ein Baum. Vier Könige von Juda, ganz oben Jesus, darunter Maria. Den Rahmen bilden alttestamentarische Propheten. Fenster im Mittelschiff und den Seitenschiffen: Symbolisches Kirchenfenster der Erlösung. Ganz unten sind die Hufschmiede als Stifter dargestellt. 7 Mittelfelder in der oberen Hälfte sind Kopien des 19. Jahrhunderts. Im oberen Bereich ist die Passion und Kreuzigung Christi dargestellt. [P1310767] Das Wunder unserer lieben Frau. [P1310768] Geschichte von heiligen Nikolaus im nördlichen Seitenschiff. Gestiftet für ihren Schutzheiligen von den Apothekern und Krämern. [P1310769] Geschichte des Todes, der Bestattung und der Himmelfahrt Marias, genannt das Himmelfahrtsfenster. Auch hier sind die Schuhmacher die Stifter, wie man unten sehen kann. Obwohl die Himmelfahrt Marias erst 1950 zum Dogma erklärt wurde, war die Kathedrale von Chartres beireits im 13. Jahrhundert diesem Fest geweiht. Über den Schuhmachern liegt Maria auf dem Totenbett. Im zweiten Kreis von unten wird der Sarg Marias von Aposteln getragen. Darüber wird Marias Leichnam in einem blauen Sarkophag gelegt und oben wird Maria von ihrem Sohn Jesus gekrönt. [P1310770] Die Geschichte von Joseph. Es entstand ca. 1210 und wurde von den Geldwechslern gestiftet, die man ganz unten hinter einem grünen Tisch bei der Arbeit sieht. [P1310771] Die Geschichte des heiligen Eustachius im nördlichen Seitenschiff, gestiftet von den Kürschnern. [P1310772] Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Schuhmacher sind als Stifter ganz unten dargestellt. Darüber die Geschichte des Samariters und darüber die in Bezug gesetzte der Erschaffung von Adam und Eva, sowie dem Sündenfall in der Mitte. Ganz oben die Vertreibung aus dem Paradies, die Verdammung zur Arbeit und rechts ermordet Kain seinen Bruder Abel. [P1310773] Die Geschichte des heiligen Lubin im nördlichen Seitenschiff. Er war Schutzpatron der Stifter seines Fensters, der Gastwirte und Weinhändler. [P1310774] Die Geschichte der heiligen Maria Magdalena im südlichen Seitenschiff. Datiert etwa 1210, eine Stiftung der Wasserträger, die ganz unten ihre Krüge entleeren. In dem Kreis in der Mitte zeigt ein Engel Maria Magdalena das aus dem Sarkophag hängende Leichentuch, Christus zeigt sich ihr mit einem Kreuzstab in der Hand und trägt ihr auf, die Auferstehung den Jüngern zu verkünden. Im obersten Kreis der Tod und die Beerdigung Maria Magdalenas, sowie die Überbringung ihrer Seele durch einen Engel an den segnenden Jesus. [P1310775] Die Geschichte Noahs im nördlichen Seitenschiff. Das um 1210 entstandene Fenster wurde von den Fassbindern und Zimmerleuten gestiftet, die man wieder ganz unten sehen kann. Im unteren Drittel baut Noah an der Arche und darüber sieht man paarweise Tiere, die zur Arche laufen. In der Mitte zwei Darstellungen der Arche umgeben von 4 Darstellungen der Ertrinkenden der Sintflut. Ganz oben knien Noah und seine Frau unter einem Regenbogen. [P1310776] Die Geschichte des Evangelisten Johannes im südlichen Seitenschiff. Datiert etwa 1210, eine Stiftung der Waffenschmiede, wie man unten rechts und links sehen kann. Die Flucht nach Ägypten ganz unten ist eine Ergänzung aus einem anderen Fenster, weil die originale Scheibe der Waffenschmiede bereits vor dem 18. Jahrhundert verloren ging. Oben sitzt Johannes in seinem Grab in Erwartung seiner Himmelfahrt. [P1310777] Fenster der Vendôme-Kapelle im südlichen Seitenschiff. Gestiftet etwa 1417 von Ludwig von Bourbon, Graf von Vendôme. Es ist das einzige Fenster mit Maßwerk in Flamboyant-Stil. [P1310778] Fenster im südlichen Seitenschiff aus dem 13. Jahrhundert: von links nach rechts der heilige Fides, die stillende Maria, Petrus, Jakobus der Ältere, der heilige Laudomar, Maria die Ägypterin. [P1310779] Fenster der nördlichen Querschifffassade mit Fensterrose und den Fenstern darunter stammt aus dem 13. Jahrhundert vom Atelier Notre-Dame-de-Paris. Es verherrlicht die Jungfrau, die in der Mitte zu sehen ist. In den Fenstern darunter von links nach rechts: Melchisedek mit Nebukadnezar, dann David mit Saul, in der Mitte die heilige Anna mit Maria auf dem Arm, rechts daneben Salomon und Jerobeam und ganz rechts Aaron und der Pharao. Schaufenster eines Ladens mit Andenken und Souvenirs, zum Beispiel bemalte Frösche mit Krone aus Porzellan oder winkende Queen Elisabeth II. Alte offene Markthalle. Sie ist eine Eisen-Glas-Konstruktion, entworfen von Victor Baltard (1808-1874). Tourismusinformation am Place de la Poissonnerie. Sie befindet sich im Maison du Saumon, dem Lachshaus. Es ist ein Fachwerkhaus, entstanden um 1500. Ehemals hat es sich an die Umfassungsmauer des Schlosses des Grafen angelehnt. Detail von zwei Konsolen aus Holz. Blumen Toreinfahrt des ehemaligen Rathauses, welches bis 1792 im ehemaligen Wechslerviertel lag und zwar genau gegenüber der Zugangs zur ehemaligen Burg. Heute steht auf dem Gelände der verschwundenen Burg teilweise die Markthalle. Straße mit Läden. Seniorenheim Hôtel de la Cage. Église Saint-Aignan: es ist die Kirche der ältesten Pfarrei in Chartres. Bereits um 400 wurde hier eine erste Kirche erbaut, die allerdings immer wieder Opfer von Stadtbränden wurde und immer wieder neu erbaut werden musste. Sie steht eingeschlossen zwischen der heute verschwundenen Burg der Grafen von Chartres und der Stadtmauer. Nur das Hauptportal der Westfassade konnte für die dann 1514 zuletzt fertiggestellt Kirche erhalten bleiben. Während der Französischen Revolution diente die Kirche verschiedenen anderen Zwecken, war zum Beispiel Lazarett oder gar Gefängnis. Erst seit 1822 wird sie wieder als Kirche benutzt. Die Kirche ist mit stark beschädigten Wandmalereien aus dem 19. Jahrhundert verziert. Länge 47,65 m. Die Ausrichtung der Kirche ist nicht genau in West-Ost-Richtung. Der Chor weist in Richtung Nordosten, die Fassade Richtung Südwesten. Westfassade. Über dem Eingang zwei Rundbogenfenster und eine Fensterrose aus dem 17. Jahrhundert. Das kleine runde Türmchen an der linken Seite der Fassade stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Etwas weiter hinten der Glockenturm. Im Erdgeschoss befindet sich die Sakristei. Am Glockenturm führen Treppen zu tiefer gelegenem Gelände. Von hier sieht man, dass die Kirche auf einer Terrasse über einem tiefer liegenden Stadtteil liegt, der Richtung Fluss L'Eure liegt. Blick auf den Chor und den Glockenturm. Der Eingang zum nördlichen Seitenschiff zeigt die Jahreszahl 1541. Für die Renaisssance typisch sind auch die kleinen Säulen im antiken Stil. Inneres: Grundriss mit der Westfassade oben. Weiterer Grundriss Erläuterungen zu den Nummern auf dem Grundriss. Blick durch nördliche Seitenschiff. Es ist mit Kreuzrippengewölben gedeckt. Blick durch das Mittelschiff Richtung Chor. 1869 wurde die Innenausmalung mit Fresken im romantischen Stil, wurden von Émile Boeswillwald (1815-1896), einem Mitarbeiter von Eugène Viollet-le-Duc angefertigt. Blick durch das südliche Seitenschiff. Es ist mit Kreuzrippengewölbe gedeckt. Aufteilung der Wände des Mittelschiffs in drei Zonen. Obergaden mit Fenstern, Triforium und Untergaden bzw. Arkaden mit Spitzbogen zu den Seitenschiffen. Der Chor mit dem Chorumgang dahinter. Blick in das Gewölbe des Chores. Tonnengewölbe aus bemaltem Holz im Mittelschiff. Blick durch das Mittelschiff Richtung Eingang und Orgel. Orgel aus dem 19. Jahrhundert auf Orgelempore aus Holz mit Blendarkaden. Die Orgel wurde von Joseph Merklin (1819-1905) geschaffen und 1969 von Georges Danion (1922-2005) elektrifiziert und umgebaut. An der Wand Fresken aus dem 19. Jahrhundert. Kanzel aus Holz, 19. Jahrhundert. Am Kanzelfuß die 4 Evangelisten, am Kanzelkorb Heilige und Engel. Farbige Glasfenster aus dem 16. und 19. Jahrhundert:: Fenster mit einer Szene aus der Passion Christi, geschaffen vom Atelier Lorin, 19. Jahrhundert. [P1310821] Fenster unten rechts mit Petrus und einem Engel an der Seelenwaage. Oben links evt. Christi Geburt. [P1310822] Fenster mit dem Leben von Christus, Fußwaschung, Einzug nach Jerusalem, Passion und Himmelfahrt, Atelier Lorin, 19. Jahrhundert. [P1310823] Fenster mit dem Leben von Christus, Geburt, Taufe, Vertreibung der Händler aus dem Tempel, Bergpredigt, Erweckung des Lazarus, Atelier Lorin, 19. Jahrhundert. [P1310824] Fenster mit Szenen aus dem alten Testament, Vertreibung aus dem Paradies, Moses und die 10 Gebote, Abraham kurz vor der Opferung seines Sohnes Isaak, Atelier Lorin, 1887. (P1310825] Fenster mit Szenen aus dem alten Testament, David kämpft gegen Goliath, Daniel in der Löwengrube, König David und die Bundeslade, Jonas und der Wal, Judith mit dem Kopf des Holofernes, König Salomon beim Bau des Tempels, Atelier Lorin, 1888. [P1310826] Vier heilige Bischöfe: heilige Martin, heiliger Denis, heiliger Nikolaus, heiliger Aignan, 16. Jahrhundert. [P1310829] Einige Fenster aus dem 16. Jahrhundert sind erhalten, aber aus Bruchstücken zusammengesetzt. Enge Straßen mit Laternen an den Hauswänden. Alte Tordurchfahrt mit Rundbogen aus Quadersteinen in einen Hof. Fachwerkhaus mit Turm. Mittelalterlicher Turm. Église Saint Pierre: Das ursprünglich hier vorhandene Kloster, wurde mehrfach zerstört. Nur der Westturm hat sich hier wie ein Bergfried erhalten. Man entdeckte dann im Chor der zerstörten Kirche das Grab des Heiligen Gulduin, was zu einem Pilgerstrom und damit Einnahmen führte. Der Wiederaufbau begann Ende des 12. Jahrhundert und der restliche Wiederaufbau erfolgte im 13. Jahrhundert. 1320 war die Kirche fertiggestellt. Sie ist eine dreischiffige Basilika mit Kapellen und Chorumgang. Auch das Kloster wurde wieder aufgebaut. Während der Revolution wurden große Teile des Klosters abgerissen. Blick auf das hohe Mittelschiff mit den auffälligen doppelten Strebebögen. Blick auf den Chor mit dem Chorumgang. Grundriss Inneres: Nördliches Seitenschiff, gedeckt durch ein Kreuzrippengewölbe. Blick in das Mittelschiff Richtung Chor. Auch hier vierteilige Kreuzrippengewölbe und ein Aufteilung der Wände in 3 Zonen. Spitzbogenarkaden als Grenze zu den Seitenschiffen, Triforium und Obergaden mit farbigen Glasfenstern. Blick in das südliche Seitenschiff. Blick vom südlichen Seitenschiff in das Mittelschiff und die Wandaufteilung mit einigen farbigen Glasfenstern. Hier haben sich zahlreiche Glasfenster aus dem 13. und frühen 14. Jahrhundert erhalten. Die Orgel ist ein Werk von Antoine Tronchet aus dem Jahr 1912. Blick in den Chorumgang mit relativ niedrigen Kreuzrippengewölben. Blick vom Chor durch das Mittelschiff zurück zum Eingang, Hinten rechts kann man die dicken Mauern des erhaltenen Westturmes erahnen. Blick in das Gewölbe und auf die oberen Glasfenster im Chor. Detail der linken 3 Glasfenster im Chor. Detail der mittleren 2 Glasfenster im Chor. Detail der rechten 2 Glasfenster im Chor. Informationstafel zu 2 Glasfenstern. Mittelalterliches Glasfenster von der Informationstafel mit der Kreuzigung links und Christus als Weltenrichter rechts. Mittelalterliches Glasfenster. Links unten der Apostel Petrus mit dem Schlüssel. Rechts oben die Kreuzigung von Petrus mit dem auf dem Kopf stehenden lateinischen Kreuz. Mittelalterliches Glasfenster. Links Verkündigung, Geburt Jesu mit der Anbetung der heiligen drei Könige, Präsentation im Tempel, oben Tod Marias. Rechts die Verkündigung durch einen Engel an die Hirten. Mittelalterliches Glasfenster. Mittelalterliches Glasfenster. Links und rechts der Märtyrertod mehrerer Heiliger in den Flammen. Alte Häuser bei der Pont Saint Hilaire, die über den Fluss L'Eure führt. Der Fluss L'Eure bildet im Zentrum von Chartres eine Insel. Blick von der Pont Saint Hilaire über den Fluss, die alten Häuser direkt am Fluss, im Hintergrund die Türme der Kathedrale von Chartres. Blick auf die Brücke Saint-Hilaire. Richtung Kathedrale liegt links das Fachwerkgebäude der alten Wäscherei. Dahinter der Bogen der alten Pont Taillard. Alter Abwasserkanal zwischen den Häusern. Historische Fachwerkhäuser bei der Pont Boujou, in der Nähe der Kathedrale. Blick von der Brücke Richtung Kathedrale. Mit Musikgruppe und Tänzern bemalter Eingang zu einem Kunststudio. Informationstafeln zur mittelalterlichen Stadtbefestigung bei der ehemaligen Porte Guillaume. Auf der Insel im Fluss lag ehemals die Barbacane, ein dem Stadttor vorgelagertes Verteidigungswerk. Historisches Foto der ehemaligen Porte Guillaume. Mosaik mit dem Motiv der Porte Guillaume und der dahinter sichtbaren Kathedrale. Heutiger Zustand der Porte Guillaume. Das Stadttor wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im 15. Jahrhundert verstärkt. Der Name Porte Guillaume geht auf den Erbauer Viscount von Chartres, Guillaume Ferrières zurück. In der Nacht vom 15. auf den 16. August 1944 wird die Anlage von der sich zurückziehenden deutschen Armee fast vollständig zerstört. Blick zurück zur Altstadt und der Kathedrale. Auf der Pont Boujou, Blick auf die Kathedrale und alte Häuser. Geschnitzte Ständer an einem alten Fachwerkhaus. Geschnitzte Figuren an den Ständern eines alten, halbrund abschließenden Fachwerkgebäudes. Altes Fachwerkgebäude. Das modernere Chartres mit Hochhäusern. Windmühle Landschaft in der Champagne mit blühenden Rapsfeldern an der Autobahn A 4 Richtung Reims. Kleiner Ort mit romanischer Kirche in der Champagne.
-
Châtillon-sur-Marne: kleiner mit mit ca. 800 Einwohnern in der Champagne, 35 km südwestlich von Reims. Église Notre-Dame: romanische Kirche mit Mittelschiff und niedrigeren Seitenschiffen, Basilika. Doppeltes Rundbogenportal mit einer vorgestellten Säule. Blick in die Landschaft mit Weinbergen. Strasse zum Berg mit der Ruine der Burg und der Statue von Papst Urban II. Informationstafel. Ruine der Burg auf dem Hügel, der heute ein Weinberg ist. Direkt daneben die Statue von Papst Urban II. (ca. 1035-1099), vormals Odo de Châtillon. Er war der erste Papst, der zu einem Kreuzzug aufrief. Die 33 m hohe Statue vom Bildhauer Élie Le Goff (1858-1938) wurde 1887 eingeweiht. Rückseite der Statue Blick in die Weinberge der Champagne.
-
Epernay: die Stadt mit ca. 23.000 Einwohnern. Hier befindet sich das Weinbaugebiet Vallée de la Marne. Es ist neben Reims eines der Zentren der Champagner-Produktion. Bereits im 6. Jahrhundert unter den merowingischen Könige, war dieser Ort mit dem damaligen Namen Sparnacum von Bedeutung. Erst ab dem 13. Jahrhundert änderte sich der Name in Epernay. 1229 brannte der Ort ab. Église Notre-Dame: Auf dem Geländes eines Ursulinenklosters, wurde von 1897-1917 diese Kirche im Stil der Neugotik erbaut. 1918 wurde sie teilweise durch Bomdardierungen zerstört und bis 1924 wieder aufgebaut und restauriert. Westfassade mit 4 Stufenportalen und großer Fensterrose. Auf der Vierung ein Turm. Basilika. Südliche Fassade des Querschiffs. Blick auf die Vierung mit Turm und den Chor mit Kapellen. Wasserspeier am Dach einer Kapelle. Gesamtansicht von Südosten. Tour de Castellane: der Aussichtsturm wurde 1903-1905 erbaut. Er liegt oberhalb des Flusses Marne.
-
Reims: etwa 130 km östlich von Paris ist Reims die bedeutendste Stadt der Champagne. Ca. 220.000 Einwohner. Bereits in der Bronzezeit war das Gebiet des Pariser Beckens besiedelt. Gemäß der Legende, wurde Reims von Remus, dem Bruder von Romulus gegründet. Die tatsächliche Gründung erfolgte ca. 80 v. Chr. durch die Kelten und später wurde es eine römische Stadt. Bereits in spätrömischer Zeit wurde die Gegend christianisiert und zum Bischofssitz erklärt. Immer wieder stand die Stadt im Zentrum von geschichtlichen Ereignissen, zum Beispiel die Eroberung der Stadt durch die Hunnen unter Attila 451. Bereits um 401 wurde hier eine erste Kirche erbaut und der Ort wurde entscheidend für den Aufbau des Frankenreichs. 816 fand hier die erste Krönung statt. Der Sohn von Karl dem Großen, Ludwig der Fromme (778-840) wurde hier von Papst Stephan IV. zum Kaiser gekrönt. Stadtrechte sind seit 1139 dokumentiert. Vom 12. bis 19. Jahrhundert war Reims die Stadt, in der die meisten französischen Könige gesalbt und gekrönt wurden. Während des Hundertjährigen Krieges gelang es den Franzosen unter Jeanne d'Arc (ca. 1412-1431) die Engländer, die den Norden des Landes besetzt hatte, zu vertreiben. So konnte Karl VII. (1403-1461) im Jahre 1429 in Reims gekrönt werden. Kathedrale Notre-Dame: einer der bedeutendsten gotischen Kirchenbauten Frankreichs. Seit 1991 zum UNESCO-Welterbe gehörend. Hier findet man das erste voll entwickelte Maßwerk der Geschichte. Die Kathedrale hat mich ihren Skulpturen und der Architektur einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der französischen Gotik gehabt. Bereits im frühen 5. Jahrhundert entstand ein erster Kirchenbau auf den Ruinen gallo-römischer Thermen. Nach der Legende von Erzbischof Hinkmar von Reims, soll hier Ende des 5. Jahrhunderts der Frankenkönig Chlodwig I. (466-511), vom heiligen Remigius getauft worden sein. Seit karolingischer Zeit gab es hier auch eine berühmte Domschule. Im Ersten Weltkrieg wurde die Kathedrale schwer beschädigt. Nach der Marneschlacht vom 5.-12. September 1914, hatten sich die deutschen Truppen nördlich von Reims bis 1918 zurückgezogen. Da die Stadt von französischen Truppen besetzt war, wurde das historische Stadtzentrum fast völlig zerstört. Geschosse schlugen auch in die Kathedrale ein und beim Einsturz des Gerüstes am Nordturm, wurden Skulpturen an der Westfassade beschädigt. Der Dachstuhl brannte völlig aus und ein großer Teil der mittelalterlichen Glasfenster wurde ebenfalls zerstört. Ab 1915 hatte man die Fassade mit Sandsäcken geschützt. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde ab 1919 die Kathedrale unter Leitung von Henri Deneux (1874-1969) wieder aufgebaut und der abgebrannte Dachstuhl durch Betonelemente ersetzt. Vor dem Hintergrund der Zerstörungen im Ersten Weltkrieg, wurde es der Ort, an dem 1962 die deutsch-französische Freundschaft durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer bei einer Messe begründeten. Die Bauzeit während des 13. Jahrhunderts, führte zu einigen Veränderungen im Bauplan. Trotzdem erscheint die heutige Kathedrale stilistisch sehr einheitlich. Die wie üblich ist in Ost-West-Richtung, auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes, als Basilika gestaltete Kathedrale, hat ein dreischiffiges Langhaus und ein dreischiffiges Querschiff. Im Osten einen Kapellenkranz mit fünf Chorkapellen und einem Chorumgang. Informationstafeln, unter anderem mit den Grundrissen aus den verschiedenen Jahrhunderten. Modell der Westfassade mit Informationstafel. Informationstafel zur Westfassade. Gesamtansicht der Westfassade. Sie wurde Mitte des 13. Jahrhunderts 1252–1275 errichtet. Im Mittelalter war die Kathedrale von Bebauung umgeben, die heute überwiegend verloren ist. Nur im Süden gibt es noch das Palais du Tau und im Norden standen einst ein Kloster und die Wohngebäude der Domherren. Die zwei, nicht ganz vollendeten, Türme der Westfassade mit der Königsgalerie und Chlodwigs Taufe darunter. In der Mitte die Taufe von Frankenkönig Chlodwig I. (466-511) durch den heiligen Remigius. Symbolisch wird hier auf die Königsfolge des Frankenreichs Bezug genommen. Königsgalerie unter dem linken Turm, 14. Jahrhundert, also erst nach der Fertigstellung der Portale an der Westfassade. Ursprünglich waren die Figuren vergoldet. Königsgalerie unter dem rechten Turm, 14. Jahrhundert. Mittlerer Bereich der Westfassade mit der Fensterrose. Darüber links David und Goliath, rechts David und Salomon. Neben der Fensterrose offene gotische Arkaden mit Maßwerk und Nischen mit Statuen. Die vier Statuen von links nach rechts: heilige Johannes, Christus gekleidet als Emmauspilger, heilige Magdalena und der heilige Petrus. Rechts und links der Fensterrose unten Statuen von Emmauspilgern. Detail der Fensterrose mit den sie umgebenden Statuen und der Giebel, Wimperg, über dem mittleren Portal mit der Krönung Marias, umgeben von Engeln. Detail der Statuen über der Fensterrose. Die drei Portale der Westfassade. Die Dekorationen der Portale mit ihrem Gewände und den Wimpergen, Giebeln, ist weit vorgezogen und reicht in der Höhe über das erste Geschoss hinaus. Ganz links ein Relief mit der Auffindung des Kreuzes. Detail des Flachreliefs Detail des Wasserspeiers Linkes Portal: Gesamtansicht Linkes Gewände: Neben den beiden zerstörten Statuen (um 1235), die heilige Helena (1240-1250 Werkstätten von Reims), ein lächelnder Engel (um 1225, antikisierende Werkstatt), der heilige Dionysius (um 1235, Werkstätten von Amiens) und noch ein lächelnder Engel (1240-1250 Werkstätten von Reims). Detail der Podeste mit darunter knienden Atlanten. Rechtes Gewände von links nach rechts: evt. der heilige Florian (1240-1250 Werkstätten von Reims), ein Apostel, heilige Balsamia oder Eutropia, heiliger Johannes, an der Ecke heiliger Rigobert oder Maurilius. Alle Statuen 1240-1250 aus den Reimser Werkstätten. Detail der Podeste mit darunter knienden Atlanten. Türsturz Archivolten links. Unten die Versuchung Christi und darüber Szenen aus der Passion. Archivolten rechts. Sie sind erneuert. Der Bereich des Tympanon befindet sich ein Fenster. Oben im Giebel, Wimperg die Kreuzigung. Wasserspeier zwischen dem linken und mittleren Portal. Darunter ein Antlant, darüber König David mit Harfe. Statuen zwischen linken und mittlerem Portal. Links heiliger Rigobert oder Maurilius, Königin von Saba (ca. 1235, Werkstätten von Amiens), rechts evt. Melchisedek (um 1225, antikisierende Werkstatt). Detail von Tieren mit dem Kopf eines Menschen unter einer der Statuen. Mittleres Portal: Es ist das Marienportal. Die Statuen im Gewände sind wegen eines Bauzauns nur als Abbildung zu sehen. Im linken Gewände die Darstellung im Tempel und im rechten Gewände Verkündigung und Heimsuchung. Im Trumeau, dem mittleren Pfeiler, Maria als neue Eva. Archivolten links Archivolten rechts. Wegen der Verglasung des Tympanonfeldes, wurde die Marienkrönung in den Giebel, den Wimperg verlegt. Die Szene wird flankiert von mehreren Engeln. Direkt dahinter ist die große Fensterrose. Statuen zwischen dem mittleren und rechten Portal. Salomon (um 1235, Werkstätten von Amiens) und rechts evt. der heilige Remigius (1240-1250 Werkstätten von Reims). Details von Tieren und einem Atlanten unter den Statuen. Rechtes Portal: Gesamtansicht Linkes Gewände: An der Ecke evt. der heilige Remigius, ein Apostel, heiliger Calixt, und zwei Apostel. Alle Statuen entstanden 1240-1250 in den Werkstätten von Reims. Detail der Podeste mit Atlanten darunter. Statue eines Apostels direkt neben der Tür und kleine Reliefs am Türpfosten. Rechtes Gewände von links nach rechts: Simeon, Johannes der Täufer, Jakob, Moses, Abraham, Aaron. Diese sehr bewegten Statuen sind ca. 1220 entstanden in der Werkstatt von Chartres. Details der kleinen Statuen und Landschaften unter den Füßen. Die Statue von Simeon und die kleinen Reliefs direkt am Türpfosten. Türsturz. Linke Archivolten. Rechte Archivolten. Im Giebel, Wimperg die Darstellung des jüngsten Tages mit Christus in der Mitte. Ganz rechts ein Relief mit der Darstellung der Apokalypse. Wasserspeier links über dem Relief mit einem Atlanten und einem darüber sitzenden Mann. Wasserspeier rechts über dem Relief mit einem musizierenden Mann. Südseite der Kathedrale: An der Südseite des südlichen Turms befindet sich ein stark beschädigtes Flachrelief mit mehreren biblischen Szenen und einigen Engeln. Wasserspeier und links der musizierende Mann. Blick auf den südlichen Turm. Südseite der Kathedrale mit dem südlichen Querhaus und der Mauer zum Palais du Tau, dem ehemaligen erzbischöflichen Sitz in Reims. Heute befindet sich hier ein Museum. Nordseite der Kathedrale: Blick auf den nördlichen Turm der Kathedrale. Auf der Nordseite des nördlichen Turms befindet sich ein stark beschädigtes Flachrelief mit mehreren Szenen. Darüber Wasserspeier. Die umlaufende Königsgalerie am nördlichen Turm. Die Nordseite des Langhauses mit den doppelten Strebepfeilern und das nördliche Querschiff. Detail der doppelten Strebepfeiler mit Nischen, in denen Statuen von Engel mit ausgebreiteten Flügeln stehen. Darunter zahlreiche Wasserspeier in Form von Tieren, Widder, Pferde, Stiere. Detail der Wasserspeier. Fassade des nördlichen Querschiffs: Informationstafel. Beide Arme des Querschiffs sind unvollendet. Die sie flankierenden Türme sollten eigentlich wesentlich höher sein. Sie enden nur in einem pyramidenförmigen Dach. Über den drei sehr unterschiedlichen Portalen ist eine große Fensterrose, die von kleinen Figuren im Spitzbogen umgeben ist. Darüber stehen Statuen von 7 Propheten. Neben der Fensterrose offene Spitzbögen und Statuen von Königen in Nischen. Detail des Giebelfeldes ganz oben. Gesamtansicht an der drei Portale. Rechts die Porte romane, in der Mitte das Heiligenportal und links das Gerichtsportal. Porte romane, rechts: Dieses sehr alte Portal, stammt wahrscheinlich von einem zerstörten Vorgängerbau. Ca. 1180 entstanden, könnte es sich um Reste eine Nischengrabmals handeln, die hier Anfang des 13. Jahrhunderts wieder verwendet wurden. Unter einem Rundbogen mit Engeln sitzt vor einem glatten Tympanon Maria mit dem Jesuskind. An der Statue sind noch Farbreste zu erkennen. Früher führte dieses Portal direkt zu einem Flügel des Klosters und war daher von außen nicht zu sehen. Heiligenportal, Mitte: Gesamtansicht des auch Calixtus- oder Sixtusportal genannten, um 1225-1230 entstandenen Portals. Linkes Gewände von links nach rechts: ein Engel, der heilige Nicasius, ehemals Bischof von Reims, den die Vandalen vor der Kathedrale enthaupteten und daneben seine Schwester die heilige Eutropia. Rechtes Gewände von links nach rechts: Chlodwig, dessen Krone während der Revolution entfernt wurde, der heilige Remigius und ein Engel. Am Mittelpfeiler, dem Trumeaupfeiler Papst Calixtus I. Im Tympanon unten links Szenen aus der Legende um den heiligen Nicasius, rechts die Taufe Chlodwigs. In der zweiten und dritten Reihe die Wunder des heiligen Remigius. In den Bögen links und rechts hohe kirchliche Würdenträger, Päpste, Bischöfe und Patriarchen. Gerichtsportal, links: Das Portal ist sehr schmal und fügt sich zwischen zwei Strebepfeilern in die Fassade ein. Statt Türen befinden sich hier nur vier Fenster. Es ist thematisch dem Jüngsten Gericht gewidmet. Es entstand Anfang des 13. Jahrhunderts. Linkes Gewänder mit 2,30 m hohen Statuen der Apostel. Rechtes Gewände mit 2,30 m hohen Statuen der Apostel. In der Mitte eine 2,70 m hohe Statue von Christus. Bedingt durch die Größe vermutet man, dass diese Stauten ursprünglich für einen anderen Ort vorgesehen waren. Im Tympanon oben Christus als Richter, umgeben Maria, Johannes und Engeln mit den Instrumenten der Passion. Darunter in zwei Reihen die Toten, die aus ihren Gräbern steigen. Auf dem Türsturz übergeben Engel die geretteten Seelen dem Patriarchen Abraham, der sie in seinem Schoß aufnimmt. Rechts ziehen Teufel die Verdammten Richtung Hölle. Darüber ein Erzbischof und ein Königspaar, die zu den Auserwählten gehören, die Verdammten rechts sind stark beschädigt. Detail der Verdammten und der Hölle. Im Bogen links innen die klugen Jungfrauen, dann Diakone und außen Engel. Im Bogen rechts innen die törichten Jungfrauen, dann Diakone und außen Engel. Inneres: Blick durch das nördliche Seitenschiff, gedeckt mit vierteiligem Kreuzrippengewölbe. Informationstafel über die Spitzbögen in der Kathedrale Blick vom nördlichen Seitenschiff in das Mittelschiff. Aufteilung der Seitenwand des Mittelschiffs in die drei Zonen, Untergaden mit Spitzbogenarkaden zu den Seitenschiffen, Triforium und Obergaden. Mittelschiff mit Kanzel von ca. 1770 aus Holz, Blick zum Chor und Hochaltar. Das Gewölbe im Mittelschiff hat ebenfalls ein vierteiliges Kreuzrippengewölbe. Blick durch das südliche Seitenschiff, ebenfalls mit vierteiligem Kreuzrippengewölbe. Blick von der Vierung in den Chorraum. Auf dem Hochaltar steht das Kreuz und die Leuchter, die 1825 für die Krönung Karls X. (1757-1830) angefertigt wurden. Da Reims die Krönungskirche der französischen Könige war, musste viel Raum für diese Zeremonie geschaffen werden. Das Querschiff besteht aus 3 Schiffen und der Chorraum wurde nach vorne um 2 Joche verlängert, die aus 5 Schiffen bestehen. Der Chorumgang ist dann allerdings nur einläufig, also wesentlich schmaler. An der Seite des Mittelschiffs eine kleine Orgel (Chororgel) von John Abbey von 1842 im neugotischen Stil. Daneben ein Lesepult aus dem 18. Jahrhundert, welches einst für die Partituren der Kantoren benutzt wurde. Blick in das Gewölbe vom Mittelschiff Richtung Chor. Blick von der Vierung zum Hochalter und in den Chorraum. Blick in das Gewölbe der Vierung. Blick vom nördlichen Querschiff auf die Vierung. Blick über den Hochaltar in das südliche Querschiff mit seinen farbigen Glasfenstern und der Fensterrose. Unten eine Tür, die direkt zum erzbischöflichen Palais du Tau führte. Detail der Fensterrose. Vor dem Ersten Weltkrieg besaß die Kathedrale noch zahlreiche im Original erhaltene mittelalterliche Glasfenster. Nach den Zerstörungen im Krieg wurden nach und nach die Fenster durch moderne farbige Glasfenster ersetzt. So auch diese Fensterrose im südlichen Querschiff. Sie entstand 1937 von Jacques Simon und stellt den auferstandenen Christus dar. Er ist umgeben von den Aposteln und 12 Engeln. Informationstafel zum Champagner-Fenster. Details der 3 farbigen Spitzbogenfenster. Diese 3 farbigen Glasfenster von Jacques Simon (1890-1974) aus dem Jahr 1954 wurden von der Kooperation der Weinbauern der Champagne gestiftet. Sie zeigen die Arbeiten bei der Herstellung von Wein. Im unteren Bereich die Schutzheiligen der Weinbauern und Weinhändler Vincent und Jean-Baptiste. An den Rändern der beiden äußeren Fenster werden 44 Orte des Weinanbaus in der Champagne benannt. Der obere Bereich des Chorraums und das Gewölbe des Chorraums. Detail der farbigen Glasfenster im oberen Bereich des Chorraum. Hier sieht man die bahnbrechende Neuerung des Maßwerks, welches in Reims schon ab 1211 in den Chorkapellen realisiert wurde. Man kombinierte zwei Spitzbogenfenster in Lanzettform mit einer Fensterrose. In der Mitte oben Maria mit Jesus, die Kreuzigung und rechts und links daneben die Apostel. Darunter Diözesanbischöfe. Entstanden sind die Fenster um 1230 und 1241. Es sind die ältesten erhaltenen Glasfenster in der Kathedrale. Informationstafel Vom Beginn des südlichen Chorumgangs ein Blick über den Hochalter an die Wand des Chorraums. Bis 1744 war der Domherrenchor durch einen Lettner vom übrigen Raum abgeteilt. Blick vom Chorumgang über den Hauptaltar Richtung Westen. Blick in das Gewölbe des Chorumgangs. Informationstafel zum Fenster von Chagall. Farbige Glasfenster von Marc Chagall (1887-1985) von 1974 in der mittleren Kapelle des Chores (Axialkapelle). Ausgeführt wurden seine Entwürfe von Charles Marq und seiner Frau Brigitte Simon, die eine der ältesten Werkstätten für Glasmalerei in Frankreich leiten. Dabei wurde für das Blau des Hintergrundes, genau der Blauton rekonstruiert, der den Blautönen der Reimser Kathedrale im 13. Jahrhundert entspricht. Gesamtansicht der Kapelle. Detail des mittleren Fensters mit Abraham und dem gekreuzigten Christus. Detail des linken Fensters mit der Wurzel Jesse. Detail des rechten Fensters mit der Taufe Chlodwigs, der Krönung Ludwigs XI. (des Heiligen) und der Krönung Karls VII. In Gegenwart von Johanna von Orleans. Informationstafel zu den Glasfenstern der Herz-Jesu-Kapelle und der St. Josefkapelle, zwei weiteren Chorkapellen von Imi Knoebel (1940-). Der staatliche Auftrag, finanziert von Mäzenen, war der Auftakt zum 50. Jahrestag der deutsch-französischen Freundschaft im Jahr 2013. 2011 wurden weitere Fenster in der Apsis geschaffen. Anlass war das 800-jährige Jubiläum der Weihe der Kathedrale. Informationstafel zur Kapelle der Johanna von Orléans. Kapelle der heiligen Johanna von Orléans, ebenfalls mit farbigen Glasfenstern von Imi Knoebel (1940-) von 2015 Informationstafel zu den farbigen Glasfenstern in der Kapelle der heiligen Thérèse. Kapelle der heiligen Thérèse: die farbigen Glasfenster wurden im 18. Jahrhundert zerstört. Die jetzigen Glasfenster wurden 1859 von Coffetier & Steinheil geschaffen. Dabei wurde der Stil der Glasfenster des 13. Jahrhunderts imitiert. Im linken Fenster die Wurzel Jesse mit den Königen, den Vorfahren Marias. Ganz oben in der kleinen Fesnterrose die thronende Maria mit dem Kind. Im mittleren Fenster 12 Szenen aus dem Leben Marias. Ganz oben die Krönung Marias. Im rechten Fenster wird die barmherzige Kraft Mariens hervorgerufen durch die Erinnerungen von Heiligen, Kranken, Reisenden und Soldaten, die ihre guten Taten erlebt haben. Blick vom nördlichen Ende des Chorumgangs über den Hochaltar. Blick vom Chorumgang durch das nördliche Seitenschiff Richtung Westen. Weitere farbige Glasfenster: in den Hochfenstern des Mittelschiffs zeigen sich Könige und Bischöfe, eine Verbindung zu den Zeremonien, die in der Kathedrale stattfanden. Informationstafel zur Rosenkranzkapelle Rosenkranzkapelle. Sie befindet sich im südlichen Querschiff und zeigt ganz oben ein Kreuz aus dem 15. Jahrhundert, welches von einem 1744 abgerissenen Lettner stammt. Altar im Stil der Renaissance von Pierre Jacques (1520-1596). Der Altar zeigt oben die Auferstehung Christi, umgeben von den 4 Evangelisten. Darunter eine Pietà mit den Heiligen Johannes und Magdalena. In den seitlichen Nischen der heilige Paulus und Antonius der Einsiedler, beides Schutzpatrone des Stifters, dem Domherren Grand-Raoul. Vor dem Altar ein keltisch-römisches Mosaik. Es befand sich im Innenhof des Palais du Tau und wurde 1849 in die Kirche gebracht. Neugotischer Kandelaber im Kirchenschiff. Seitenausgang mit thronender Maria im Tympanon, flankiert von Engeln. Informationstafeln zur großen Orgel. Liste der in der Kathedrale gekrönten französischen Könige. Blick durch das Mittelschiff Richtung Westen. Die Gestaltung der Innenseite der Westfassade ist für das 13. Jahrhundert ungewöhnlich. Unter der oberen großen Fensterrose ein Triforium, welches ebenfalls mit farbigen Fenstern gestaltet ist. Unten eine weitere Fensterrose, die umrahmt wird von sieben Reihen mit Nischen, in denen sich insgesamt 52 Statuen befinden, die allerdings meist mit einer Nachbarfigur korrespondieren. Informationstafel zur Innenseite der Fassadenwand. Innenseite der Fassadenwand. Details der oberen Fensterrose mit dem Triforium. Die große Fensterrose entstand Ende des 13. Jahrhunderts und ist, wie die ganze Kathedrale, der Mutter Gottes geweiht. In der Mitte der Tod Marias, umgeben von den 12 Aposteln. Dann im nächsten Rund 24 musizierende Engel und Seraphime. Außen im unteren Bereich 6 Könige aus Israel und darüber Propheten. Detail der unteren Fensterrose und der sie umgebenden Statuen. Die untere Fensterrose entstand 1936 und ist den Litaneien der Jungfrau Maria gewidmet. Sie stammt vom Glaskünstler Jacques Simon (1890-1974). Die Statuen hingegen entstanden um 1250-1260, also gleichzeitig mit den letzten Gewändestatuen der Portale außen. Unterhalb der unteren Fensterrose links und rechts Statuen mit dem Märtyrertod von Johannes dem Täufer und der Zerstörung seiner Reliquien. Johannes der Täufer ist der Schutzpatron der Steinmetze, daher kommt ihm hier eine besondere Bedeutung zu. In der Mitte die Statue des heiligen Nicasius, dem Gründungsbischof, der 407 vor der Kathedrale von den Vandalen erschlagen wurde. Statuen auf der linken Seite der unteren Fensterrose. Ganz unten drei Propheten: Johannes der Täufer, Jesaja und David. Darüber verkündet ein Engel Anna und Joachim die Geburt von Maria und darüber Anna und Joachim an der Goldenen Pforte in Jerusalem. Links oben in der vorletzten Reihe der Kindermord von Bethlehem. Darüber die Flucht nach Ägypten, der brennende Dornbusch, das Vlies des Gideon. Statuen oben rechts die Predigt des Täufers in Anwesenheit von Jesus. Darunter die Taufe von Jesus im Jordan und darunter die Verkündigung der Geburt von Johannes dem Täufer an den greisen Zacharias. Statuen rechts unten: Melchisedek in der Kleidung des 13. Jahrhunderts. Er erteilt einem Ritter die heilige Kommunion in dem er Brot und Wein reicht. Darüber mahnt Johannes der Täufer, dass dem Baum, der keine Früchte trägt, die Axt droht – bedeutet, dass der Jüngste Tag näher rückt. Innenseite der Westfassade vom südlichen Seitenschiff mit Fensterrose und stark beschädigten Statuen in Nischen. Detail der Fensterrose im südlichen Seitenschiff. Detail der Fensterrose im südlichen Querschiff. Sie wurde 1580 nach einem Wirbelsturm restauriert und 1937 von Jacques Simon (1890-1974) neu geschaffen. Sie zeigt im Zentrum den auferstandenen Christus, umgeben von den Aposteln und 12 Engeln. Oben im Zwickel die Krönung Marias. Informationstafeln zum Palais du Tau. Der ehemalige Palast der Erzbischöfe von Reims und Residenz der französischen Könige während der Krönungsfeierlichkeiten, ist heute ein Museum. Er steht im Süden der Kathedrale. Auf der letzten Informationstafel auch ein Umgebungsplan der Kathedrale. Im Norden der Kathedrale befindet sich der Palais de Justice, der Justizpalast. Hier die der Kathedrale zugewandte Fassade, vgl. auch den Umgebungsplan. Ebenfalls im Norden Le Trésor, die Ruine des alten Reliquiengebäudes, welches in eine interaktive Kulturstätte mit wechselnden Ausstellungen umgewandelt wurde. Historisches Haus mit rundem Eckturm.
-
Soldatenfriedhof Rembercourt-aux-Pots, 32 km südwestlich von Verdun. Deutscher Soldatenfriedhof mit Gefallenen des ersten Weltkrieges. Daneben ein französischer Soldatenfriedhof. Beide Friedhöfe wurden von den französischen Militärbehörden 1922 als Sammelfriedhof angelegt. Auf dem französischen Friedhof liegen 5510 Gefallene. Die meisten aus dem ersten Weltkrieg. Aus dem zweiten Weltkreig 7 gefallene Soldaten.
-
Nancy: die ehemalige Hauptstadt des Herzogtums Lothringen, hat über 100.000 Einwohner. Die Gegend war zwar ab dem 8. Jahrhundert vor Christus besiedelt, aber erst 1050 errichtete Graf Gerhard, Herzog von Lothringen hier eine erste Burg, aus der sich dann später die Stadt entwickelte. Sie gehörte bis in das 18. Jahrhundert zum Herzogtum Lothringen und damit zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Im 18. Jahrhundert tauschte dann der Kaiser aus dem Hause Habsburg Lothringen gegen die Toskana und so wurde Lothringen Bestandteil des Königreichs Frankreich. König Ludwig XV. (1710-1774) vergab das Herzogtum Lothringen im Jahre 1737 an den abgesetzten polnischen König, Stanisław I. Leszczyński (1677-1766), seinen Schwiegervater. Nach seinem Tod fiel es wieder an das Königreich Frankreich. Seit 1777 ist Nancy auch Bischofssitz. Eindrücke von einem beeindruckenden chinesischen Buffet mit Sushi, Spießen, Süßigkeiten und Schokoladen-Brunnen. Wohnhaus im Jugendstil beim Cour Léopold, aus dem Jahr 1906. Detail eines Balkons im Jugendstil. Denkmal der Nationalheiligen Frankreichs, Jeanne d' Arc. 1889 von Emmanuel Frémiet (1824-1910) geschaffen. Es handelt sich um eine leicht veränderte Kopie der vergoldeten Statue von Jeanne d' Arc in Paris. Statue eines Pferdes auf einem Dach. Blick in eine Straße und auf ein Riesenrad auf dem Cour Léopold, benannt nach Leopold I. von Lothringen. Ein Fahrrad und die Statue eines Zwerges als Dekoration an der Fassade eines Hauses. Fenster eines Bistros mit dem naiv gestalteten Gesicht einer Frau. Blick in eine kleine, als Fußgängerzone gestaltete Straße, Rue des Maréchaux. Place de Vaudemont: am Ende der Rue de Maréchaux ein quadratischer Platz. 1877 wurde Prosper Morey (1805-1886) mit der Dekoration des Platzes beauftragt. An der Westwand des Héré-Tores schuf er 1881 diese neoklassizistische Fassade mit einem Brunnen und Feuertöpfen. In der Mitte eine von Eugène Laurent (1832-1898) geschaffene Statue des Kupferstechers Jacques Callot. Rechts und links Büsten der Graveure Israel Silvester und Ferdinand de Saint-Urbain, geschaffen von Charles Pêtre (1828-1907). Die Lokomotive eines Dotto trains für Rundfahrten für Touristen, fährt gerade auf den Platz. Historisches Haus beim Place de Vaudemont, Rue Gustave Simon. Historisches Haus am Place de Vaudemont mit Balkongittern aus Metall. Detail der Fassade mit Balkongittern aus Metall. Place de la Carrière: dieser 159 Hektar große Platz im Zentrum der Stadt, gehört zusammen mit dem Place Stanislas und der Place d'Alliance zum UNESCO-Welterbe. Der lang gestreckte Platz verbindet die Altstadt mit der Neustadt des 18. Jahrhunderts. Erbaut wurde der Platz im 16. Jahrhundert, als die Festungsanlagen der Stadt verändert wurden. Adelsfamilien bauten hier ihre Paläste und Turniere und Reiterspiele fanden hier statt. Ende des 17. Jahrhunderts, wurde dann eine Bresche in die Festungswälle geschlagen, um einen Durchgang zwischen Altstadt und der entstehenden Neustadt zu schaffen. Die Neustadt wurde von Herzog Stanisław (1677-1766), dem ehemaligen König von Polen und Schwiegervater vom französischen König Ludwig XV. gegründet. Mit der Gestaltung des Platzes beauftragte er seinen Architekten Emmanuel Héré (1705-1763). Zwei Reihen Platanen, Bäume begrenzen, den von einer niedrigen Mauer eingefassten Platz an seiner Ost- und Westseite. An den Ecken befinden sich Brunnen mit Kinderfiguren. Am südlichen und nördlichen Ende steht ein hoher Zaun aus Schmiedeeisen. Alle Fassaden der Häuser sind einheitlich durch Emmanuel Héré gestaltet worden. Schmiedeeisernes Gitter. Der Gouverneurspalast, auch „Petit Louvre“ genannt und Sitz des Intendanten von Frankreich, wurde an diesem Platz von 1751-1753 errichtet. Die steinernen Dekorationen an den Fassaden stammen von den Bildhauern Barthélemy Guibal (1699-1757), Vallier, Lenoir, Walneffer und Johann Joseph Söntgen (1719-1788). Fassade zum Garten mit einer Statue aus Metall von Hubert Lyautey (1854-1934), Marschall von Frankreich. Plan des Gartens Fassade des Palastes vom Garten aus gesehen. Fassade des Palastes mit Säulengang. Blühender japanischer Kirschbaum und Blutbuche. Straßenlaterne an der Vorderseite des Palastes. Details des schmiedeeisernen Gitters An beiden Seiten des Gouverneurspalastes schließen Balustraden im Halbkreis den Place de la Carrière ab. Sie sind mit Statuen von Kriegstrophäen und Büsten dekoriert. Auf der linken Seite des Palastes sieht man im Hintergrund den 87 m hohen Turm der Basilika Saint-Epvre. Blick über den Place de la Carrière Richtung Arc Héré: 1757 von Emmanuel Héré mitten in die Stadtmauer, die Alt- und Neustadt trennte, errichtet. Auftraggeber war Herzog Stanisław, der ehemalige polnische König, der ihn zu Ehren seines Schwiegersohnes König Ludwig XV. in Auftrag gab. Er trennt den Place de la Carrière vom Place Stanislas, die beide zum UNESCO-Welterbe gehören. Stilistisch erinnert er an die Triumphbögen, die die römischen Herrscher zu ihrer eigenen Ehre errichten ließen. Neben dem zentralen Durchgang stehen Säulen und auf beiden Seiten sind runde Flachreliefs zu sehen. Vom mittleren Durchgang schaut man auf den Place Stanislas mit der dort stehenden Statue von Stanisław Leszczyński. Arc Héré vom Place Stanislas aus gesehen. Oben steht die vergoldete Statue der Göttin des Ruhmes Fama. Engel halten ein Medaillon mit dem Porträt von König Ludwig XV. Blick in die Grande Rue. Palais des Ducs de Lorraine: 1848 wurde das Gebäude der ehemaligen Residenz der Herzöge von Lothringen, zum Musée Lorrain d'Art et d'Histoire umfunktioniert. Der alte mittelalterliche Palast wurde während des Krieges gegen den Herzog von Burgund, Karl den Kühnen (1433-1477), im Jahre 1477 schwer beschädigt. Während der Herrschaft des Herzogs von Lothringen Renée II. (1451-1508) wurde er wieder aufgebaut. Als er starb, war sein Sohn Anton II. (1489-1544) verantwortliche für die Fortführung der Arbeiten und die Modernisierung des Palastes. Während seiner Herrschaft ließ er 1511–1512 die Fassade umbauen, die Hirschgalerie schmücken und das Torhaus des Palastes verschönern. Torhaus oder Porterie: ein Werk des Bildhauers Mansuy Gauvin (gest. 1542). Es ist dem Eingen des des königlichen Schlosses von Blois nachempfunden. Über dem Tor eine Reiterstatue des Herzogs Anton II. Die wurde während der Revolution zerstört und 1851 von Giorné Viard (1823-1885) wieder aufgebaut. Das Torhaus kombiniert den gotischen Stil mit Elementen der italienischen Renaissance. Nach der Herrschaft Karls III. (1543-1608) wurde der herzogliche Palast schnell aufgegeben. Unter Herzog Leopold Joseph (1679-1729) wurden große Teile der Gebäude abgerissen, um Platz für den „Petit Louvre“ des Architekten Germain Bouffrand zu machen und dann für den von Emmanuel Héré erbauten Regierungspalast. Blick durch die Grande Rue Richtung Porte de la Craffe, ein altes Stadttor, im Hintergrund. Rechts die lange Fassade des Palais des Ducs de Lorraine, mit zahlreichen Wasserspeiern und Balkonen. Architektonische Details wie Dachgauben, Konsolen unter den Balkonen mit Figuren und Tieren, Wasserspeier. Statue der Madonna mit Kind an der Ecke des Palastes. Darunter das Wappen der Herzöge von Lothringen. Historische Häuser in der Grande Rue Historische Häuser in der Rue de Guise Schaufenster mit Tassen aus Porzellan und Statuen aus Porzellan. Tor des Hôtel De Chastenoy aus dem 16. Jahrhundert. Fassade des Collège de la Craffe, ehemaliges Institut für Mathematik und Physik. Porte de la Craffe: Informationsschild Das ehemalige Stadttor wurde von 1336-1390 von Herzog Johann I. von Lothringen (1346-1390) im Norden der Stadt, am Ende der Grande Rue, erbaut. Auf der Seite der Stadt eine große Spitzbogenblende mit dem Lothringer Kreuz, welches zwei Querbalken hat. Darüber aufwendig gearbeitete Maschikulis, die der Senkrechtverteidigung gegen Angreifer am Boden diente. Es stellte das wichtigste Verteidigungselement der Festungsanlage dar, die die Stadt im Norden umgab. 1463 wurden zwei Rundtürme angefügt, die als Gefängnis dienten. Im Zuge der Anlage von Bastionen im 16. Jahrhundert wurde ein zweites Tor, die Porte Notre-Dame, errichtet und mit der Porte de la Craffe durch einen überwölbten Gang verbunden. Der königliche Festungsbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) baute um 1680 die mittelalterliche Stadtbefestigung um und hat dieses Tor unverändert in die neuen Verteidigungsanlagen einbezogen. Das Tor erhielt ein Dach mit Laterne und eine barocke Vorhalle, die im 19. Jahrhundert neugotisch restauriert wurde. Schematischer Plan von Nancy aus dem Jahr 1611, welches die Verteidigungsanlagen der im Norden liegen Altstadt und der südlichen Neustadt mit barockem, schachbrettartigem Grundriss zeigt. Ganz oben die Porte da la Craffe und die Porte Notre-Dame (Nr. 1 und 2). Hund vor einem Geschäft mit Blumen. Gullideckel mit Werbung für das Musée des Beaux-Arts. Place Saint-Epvre mit einem Reiterstandbild von Herzog René II. von Lothringen, darunter ein Brunnen. Basilika Saint Epvre: sie ist dem heiligen Aper, Bischof von Toul geweiht. Seine Reliquien befinden sich auf dem Hochaltar der Kirche. Bereits 1080 wurde hier eine Kirche erbaut und im 15. Jahrhundert im gotischen Stil umgebaut. Der damals sehr hohe Glockenturm diente auch als Wachturm, da er der höchste Punkt der mittelalterlichen Stadt war. 1863 wurde die Kirche abgerissen. Der heutige Bau wurde nach Plänen von Prosper Morey (1805-1886) im neugotischen Stil errichtet. Zu den Stiftern der Kirche gehören Kaiser Franz Joseph, Kaiser Napoleon III., König Ludwig II. von Bayern und der Papst. Die nach Nordwesten ausgerichtete Fassade der Kirche mit 3 Portalen und einem Glockenturm. Über dem mittleren Portal eine Fensterrose und darüber Statuen der 4 Evangelisten. Vor der Kirche die geflügelten Evangelistensymbole aus Metall. Im Tympanon des mittleren Portals ein Kruzifix, welches von Gott gehalten wird, umgeben von den geflügelten Evangelistensymbolen. Detail der Statuen der Evangelisten, die auf Podesten mit ihren Evangelistensymbolen stehen. Blick auf den Chor der Kirche mit Kapellenkranzund der Fontaine Wallance. Fontaine Wallance bzw. Wallance-Brunnen: benannt nach dem Engländer Richard Wallance (1818-1890), der öffentliche Trinkwasserspender vor allem in Paris, wahrend des deutsch-französischen Kriege 1870 aufstellen ließ. Er entwarf die Brunnen selbst, engagierte aber zusätzlich den bekannten Bildhauer Charles-Auguste Lebourg. Dieser verbesserte seine bereits recht ausgefeilten Skizzen, um aus den Trinkwasserspendern echte Kunstwerke zu machen. Place de l'Arsenal nördliche der Basilika Saint Epvre, mit dem Eingang zu einer privaten Schule. Hotel in einem Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert. Gedenktafeln für Charles de Gaulle (1890-1970) und der Text der Rede bzw. des Appells vom 18. Juni 1940, anlässlich der Niederlage der französischen Armee im Mai 1940. Winston Churchill erlaubte ihm damals, sich über den Hörfunk der BBC an das französische Volk zu wenden. Place Stanislas: der Platz im Zentrum der Stadt, gehört zusammen mit dem Place de la Carrière und dem Place d'Alliance seit 1983 zum UNESCO-Welterbe. Auch er gehört zur Neustadt von Nancy und wurde von Herzog Stanisław (1677-1766), dem ehemaligen König von Polen und Schwiegervater vom französischen König Ludwig XV. in Auftrag gegeben. Architekt war wieder Emmanuel Héré (1705-1763). Die Plätze sind verbindende Elemente zwischen der im Norden liegenden Altstadt und der Neustadt. Zu Ehren des Schwiegersohnes von Stanisław, König Ludwig XV., wurde der Platz Place Royale getauft. Bauzeit 1752 bis 1755. Kunstvolle Schmiedearbeiten des königlichen Kunstschlossern Jean Lamour (1698-1771) umgeben den Platz an den Ecken. In der Mitte des Platzes befand sich eine gusseiserne Statue von Ludwig XV., die allerdings während der Revolution entfernt wurde. Heute steht hier eine Statue von Stanisław Leszczyński von 1831. Seitdem heißt der Platz auch Place Stanislas. Informationstafel zu Stanisław Leszczyński. Auf der Luftaufnahme sind alle 3 Plätze farblich gekennzeichnet. Porträt von Stanisław Leszczyński. Einer der Zugänge zum Platz ist der Arc Héré. Kunstvoll gestaltete gusseiserne Straßenlaterne, die zum Teil vergoldet ist. Blick vom Arc Héré auf den Platz. Rechts und links barocke flache Bauten mit Cafés und Läden. Direkt gegenüber, hinter der Statue von Stanisław Leszczyński liegt das Rathaus, Hotel de Ville, von Nancy. Detail der Statue von Stanisław Leszczyński. Fast 100 m breite Fassade des Rathauses mit Kriegstrophäen auf dem Dach und dem Wappen von Nancy. Im Giebel das Wappen von Stanisław Leszczyński, gehalten von 2 Adlern. Der große Balkon hat ein Gitter verziert mit vergoldeten Wappen und Kriegstrophäen. Straßenlaterne Blick zurück zum Arc Héré. Zwischen dem Café und dem Opernhaus ein Brunnen mit zum Teil vergoldeten schmiedeeisernen Gittern und Bögen von Jean Lamour (1698-1771). Auf dem Brunnen Statuen von Nymphen und Tritonen. Detail des Bogens aus Metall mit der französischen Lilie ganz oben. Opernhaus von Nancy. Zwischen einem anderen Café und dem Gebäude dem Musée des Beaux-Arts ein weiterer Brunnen mit einer Statue von Neptun oder Poseidon, umgeben von einem schmiedeeisernen Bogen aus Metall von Jean Lamour (1698-1771) mit der französischen Lilie ganz oben. Begleitet von Hippokampen und Personifikationen von Flüssen. Fassade des Musée des Beaux-Arts. Die südwestliche Ecke des Platzes, neben dem Rathaus, mit Gittern und Bögen aus Schmiedeeisen, bekrönt von Vasen und Kronen, von Jean Lamour. Blick durch die Gitter auf den Platz. Detail des Gitters mit Laterne und Vase. Porte Stanislas: ehemaliges Stadttor von Nancy. 1761 von Herzog Herzog Stanisław (1677-1766) zu Ehren seines Namenspatrons, dem Heiligen Stanislaus in Auftrag gegeben. Nach dem Vorbild des Konstantinsbogens in Rom, wurde er vom Architekten Richard Mique (1728-1794) gestaltet. Er steht am westlichen Ende der Rue Stanislas. Dorische Säulen, Flachreliefs mit der Göttin Athene und Apollon mit der Leier, sowie Statuen mit Personifikationen der Künste verzieren das Tor. Haus im Jugendstil in der Rue Saint-Jean. Detail eines Balkons mit Gitter aus Metall, Jugendstil. Fassade der ehemalige Kirche der Prämonstratenser Saint Joseph des Prémontrés aus dem 18. Jahrhundert. 1807 wurde es in eine protestantische Kirche umgewandelt. In Frankreich heißen sie dann „Temple protestant“. Blick in einen Laden mit ortsüblichen Spezialitäten, Delikatessen, Weinen und Schnäpsen. Nancy ist die Geburtsstadt des französischen Jugendstils – Art nouveau. Seit dem Ende des deutsch-französischen Krieges 1871 siedelten sich zahlreiche Unternehmer, wohlhabendes Bürgertum und Kaufleute in Nancy an. Die Einwohnerzahl stieg von 45.000 auf 100.000 Einwohner. So entstanden in der Zeit zwischen 1890 und 1914 moderne Villen im Stil der Schule von Nancy. Die École de Nancy gründete sich 1901 durch den Zusammenschluss führender Vertreter des Art Nouveau und der Stadt Nancy. Inspiriert durch die Formen der Natur, sind vor allem die Abbildung von Disteln, Libellen oder Blättern des Ginkgobaumes typisch. Die Verbindung zwischen Künstlern und Kunstindustrie sollte Kunsthandwerker, wie Kunstschmiede, Kunsttischler, Fayencekünstler und Glasbläser fördern und qualifizierte Arbeitskräfte schaffen. Führender Kopf der Bewegung war Émile Gallé (1846-1904). Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und das Aufkommen des Art déco führten zum Ende des Art Nouveau in Frankreich und der École de Nancy. Bis in die 1980er Jahre hinein wurden die zahlreichen architektonischen Spuren der Art Nouveau nicht geschätzt, in den 1970er Jahren zum Teil sogar abgerissen. Trotzdem haben sich heute über 50 Gebäude dieses Kunststils in der Stadt erhalten. Farbiges Glasfenster in einem Wohnhaus, umrankt von blühendem Blauregen, Glyzine. Haus im Jugendstil bzw. Art Nouveau in der Avenue Foch von Emile André (1871-1933). Haus von General Antoine Drouot (1774-1847) in der Rue Saint-Léon. Er wohnte hier von 1820-1847. Architekt war E. Thiery, An der Fassade eine Büste aus Metall von Antoine Drouot, geschaffen von P. Wolff. Details der Fassade Fassaden von historischen Häusern. Detail von Dachgauben. Haus von Dr. Paul Jacques, 1905. Architekt Paul Charbonnier (1865-1955). Die schmiedeeisernen Gitter sind von Louis Majorelle (1859-1926). Die Steinmetzarbeiten von Léopold Wolff. Details der Fassade und der schmiedeeisernen Tore und Gitter. Haus von Ferdinant Loppinet, 1902. Architekt Charles-Désiré Bourgon (1855-1915). Steinmetzarbeiten von Auguste Vautrin (1868-1921). Details der Fassade, des Daches und der Tür. Weitere Häuser im Stil des Art Nouveau Detail von Dachgauben, Balkonen Haus von Jules Lombard, 1902/03. Architekt Émile André (1871-1933). Es steht am Ende der Avenue Foch, am Place de la Commanderie. Details der Balkone, Fenster und der Tür. Place de la Commanderie: Hier befand sich einst die berühmte Kommandantur Saint-Jean, die 1177 von Herzog Matthäus I. gegründet wurde. 1476 richtete hier Herzog Renée II. seinen Hauptsitz ein und ganz in der Nähe fand Karl der Kühne, Herzog von Burgund in der Schlacht von Nancy 1477 den Tod. Haus direkt neben der Turm der alten Kommandantur. Haus am Place de la Commanderie. Glasfenster mit farbigen Motiven des Jugenstils. Église Saint-Leon IX.: etwas nördlich der Avenue Foch steht diese neugotische Kirche. Als 1852 die Bahnstrecke Paris-Nancy eröffnet wurde, entstand westlich der Bahngleise ein neues Stadtviertel, in dem sich sowohl die meisten Gebäude im Stil des Art Nouveau befinden, als auch diese Kirche. Bauleiter war der Architekt Léon Vautrin (1820-1888). Baubeginn 1860, 1864 wurde der Turm im Norden fertiggestellt. Die Arbeiten verzögerten sich durch den deutsch-französischen Krieg. 1877 folgte der Turm im Süden. Die Kirche ist dem heiligen Papst Leo IX. (1002-1054) geweiht. Erst 1902 wurden die Hauptportale von Victor Huel (1844-1923) und 1927 die Seitenportale von Auguste Vallin (1881-1967) gestaltet. Die Fassadengestaltung ist inspiriert vom Stefansdom in Toul. Grundriss Westfassade Giebel mit Fensterrose und einer, von Engeln gehaltenen Uhr, zwischen den Türmen. Die beiden Turmspitzen. Linkes Portal. Neben dem Tympanon 2 Nischen mit Statuen, links Johannes der Täufer, rechts der heilige Joseph. Mittleres Portal. Im Tympanon Christus, der seinen Geist ausschüttet über den vier Evangelisten mit ihren Evangelistensymbolen. Rechtes Portal. Neben dem Tympanon 2 Nischen mit Statuen, links Maria mit dem Jesuskind, rechts der heilige Stanislaus von Krakau, der Namenspatron des letzten lothringischen Herzogs, Stanisław Leszczyński. Inneres: Blick vom Eingang durch das Langhaus. Blick durch das Langhaus mit zwei Seitenschiffen. Kanzel aus Holz mit den vier Evangelisten, kurz vor der Vierung. Blick auf den Chor mit dem neugotischen Hauptaltar und den Chorumgang. Sowohl der Hauptaltar, als auch die neugotischen Nebenaltäre, sind aus Marmor. Blick in die Kuppel der Vierung. Altar des Heiligen Alfons von Liguori, links neben dem Hauptaltar. Altar des heiligen Joseph, rechts neben dem Hauptaltar. Nebenaltar und Beichtstuhl aus Holz vor einem farbigen Glasfenster. Altar der Muttergottes, Maria, vor einem farbigen Glasfenster. Detail des farbigen Glasfensters mit der Darstellung des Pfingstwunders. Nebenaltar vor einem modernen, farbigen Glasfenster. Detail des modernen, farbigen Glasfensters. Farbiges Glasfenster mit dem heiligen Augustinus von Hippo und dem heiligen Franz von Sales. Blick vom Querschiff Richtung Langhaus. Blick vom Hauptaltar Richtung Westen zur Orgel. Orgel von Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) und Orgelempore aus dunklem Holz, verziert mit zahlreichen Statuen in Nischen mit Spitzbögen, geschaffen 1889 von Eugène Vallin (1856-1922). Wand eines Hauses mit 3 Bären, bemalt und plastisch gestaltet. Wand eines Hauses, bemalt mit einem riesigen Gesicht, Graffito. Östlich des Bahnhofs die Fassade des Salles Poirel, dem Konzert- und Opernhaus von Nancy. Detail der Fenster und Balkone. Gebäude in der Rue Gambetta im Stil des Art Nouveau. Rue Stanislas mit dem Gebäude des „Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe et Moselle“ im Stil des Art Nourveau. Schmiedeeisernes Vordach und Tür mit floralen Motiven. Detail der Fenster und Dachgauben. Historisches Gebäude einer Bank. Blick in kleine Straßen bzw. Gassen. Laden mit Musikinstrumenten. Kneipe mit über 100 Sorten Bier. Inneres mit Zapfanlagen, an der Decke verschiedene Bierdeckel, Gemälde mit Bier tringenden Mönchen an der Wand, Auszug aus der Getränkekarte. Laden mit lustig designten Lampen bzw. Leuchten. Türen und Hauseingänge, zum Teil imStil des Art Nouveau. Weitere historische Häuser im Stil des Art Nouveau, Jugendstil. Blüte einer Pfingsrose. Haus in der Rue de la Republique im Stil des Art Nouveau, Jugendstil. Weitere Häuser im Stil des Art Nouveau, Jugendstil. Église des Cordeliers bzw. St.-François-des-Cordeliers: die Franziskanerkirche ist die Grablege der Herzöge von Lothringen. Sie steht direkt neben dem Palast der Herzöge. Die angrenzenden Gebäude des ehemaligen Klosters sind heute Bestandteil des Musée Lorrain. Erbaut nach 1477 unter Herzog René II. (1451-1508), nach der Schlacht von Nancy. Informationstafel Fassade der sehr schlicht gehaltenen Kirche. Sie ist 73 m lang und nur 9 m breit. Schmiedeeisernes Gitter vor dem ehemaligen Innenhof des Klosters. Innenhof des Klosters mit Resten des ehemaligen Kreuzgangs. Inneres: Blick in das Langhaus der ehemaligen Klosterkirche mit Sterngewölbe. Zahlreiche Exponate stehen hier. Blick in das Sterngewölbe. Informationstafel Grabmal mit Liegefiguren von Antoine de Vaudémont und Marie d'Harcourt, 2. Hälfte 15. Jahrhundert. Informationstafeln Grabmal mit Liegefiguren von Henri III. de Vaudémont und Isabella von Lothringen. Mitte 14. Jahrhundert. Informationstafel Statuen von Christus im Olivenhain, 3. Viertel 16. Jahrhundert. Zu seiner Rechten Petrus, links Johannes, die ihn stützen. Ursprünglich standen diese Statuen im Garten des ehemaligen Grand Seminaire und wurden 1915 in das Museum verbracht. Ihre Herkunft ist ansonsten unbekann. Der niedrige Bogen, vor dem die Statuen stehen, beherbergte ursprünglich wohl eine Grablegung, wie sie im 16. Jahrhundert in vielen lothringischen Kirchen zu finden war. Informationstafel Grabmal von Heinrich I. Herr von Blâmont und Kunigunde von Liningen, um 1330. Die Liegefiguren ruhen über jeweils 10 Nischen mit Spitzbögen, in denen Statuen von Heiligen stehen. Informationstafel Grabmal geschaffen vom Bildhauer Ligier Richie (1500-1567). Liegefiguren von René II. de Beauvau und Claude Baudoche, um 1549. Grabmal für die Herzogin von Lothringen. Philippa von Geldern wurde ganz einfach auf dem Friedhof des Klarissenklosters beigesetzt. Ihr Grab war durch ein Kreuz gekennzeichnet, dessen Sockel im Museum erhalten geblieben ist und ein Skelett zeigt. 1548 errichteten ihre Nachkommen ein, für ihren Stand, würdigeres Grabmal. Der Bildhauer Ligier Richier (1500-1567/68) fertigte eine Liegefigur der Verstorbenen in ihrem Ordenstracht. Zu ihren Fußen hält eine kleine Statue einer Klarissin die königliche Krone, die daran erinnern soll, dass Philippa von Geldern auch Königin von Sizilien und Jerusalem war. Informationstafel Grabstein von Jean-Blaise de Mauléon. Informationstafel Farbige Flachreliefs aus einer flämischen Werkstatt vom 2. Viertel des 16. Jahrhunderts. Christus im Olivenhain, der Kuss des Judas, Jesus vor Herodes und Jesus mit dem Kreuz auf dem Weg nach Golgatha mit Veronika und dem Schweißtuch. Informationstafel Statuen vom Grabmal des Bischofs Jean de Porcelets de Maillane (1582-1624). Als der Bischof starb, beauftragten seine Verwandten den Bildhauer César Bagard (1620-1707) mit der Schaffung eines Grabdenkmals für die inzwischen verschwundene Jesuitenkirche Saint Roch in Nancy. Ursprünglich gab es einen großen Sockel, der den Sarkophag trug. Darauf diese 3 Statuen: ein Engel, der das Porträt des Bischofs hält und links die Personifikation der Hoffnung mit dem Anker und rechts der Glaube mit Kreuz und Buch. Blick in den Chor und zum Altar der ehemaligen Kirche. Informationstafel zur Geschichte der Kirche. Blick zurück zum Eingang des Langhauses mit der Fensterrose aus der Zeit des Klassizismus über dem Eingang. In der Mitte das Wappen Lothringens. Informationstafel Das Abendmahl als farbiges Flachrelief aus dem 2. Viertel des 16. Jahrhunderts. Informationstafel Das Abendmahl als Flachrelief von Florent Drouin (1540-1612) von 1582. Informationstafeln Das Grabmal von Herzog René II. von Lothringen. Der Gründer der Église des Cordeliers starb 1508. Er war der erste Herzog von Lothringen, der in dieser neuen dynastischen Nekropole begraben wurde, die an die Stelle der Stiftskirche Saint-Georges trat. Gemäß seinem Testament sollte über seinem Grab eine einfache, ihn darstellende Kupfertafel angebracht werden. Seine Frau Philippa von Geldern, fand dieses Grabmal zu einfach und ließ ein prächtiges Ensemble errichten, zu dem auch ein in die Wand eingelassener Kamin gehörte. In diesem Hohlraum befanden sich ursprünglich zwei Statuen, die den betenden Herzog vor der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind darstellten. Ganz oben Gottvater und die Wappen der Königreiche Ungarn, Sizilien, Jerusalem und Aragonien, die der Herzog für sich beanspruchte. Darunter in 6 Nischen, die Statuen des Heiligen Georg, des Heiligen Nikolaus, des Engels Gabriel und der Jungfrau Maria in der Szene der Verkündigung, der Heilige Hieronymus und der Heilige Franziskus. Altar aus Flachreliefs von 1522 mit Gott, der das Kruzifx mit Jesus hält. Darunter in Nischen 6 Heilige und in der Mitte die Verkündigung. Informationstafel Reliquienschrein in Form eines Sarges mit den Gebeinen des Heiligen Sigibert III. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde er Schutzpatron von Nancy. 1793 entweihten Revolutionäre das Reliquiar und rissen die kostbaren Verzierungen ab. Die Reliquien des Heiligen wurden größtenteils verbrannt und befinden sich heute zusammen mit den Gebeinen anderer Heiliger in dem Reliquar, welches seit 1965 in der Église des Cordeliers steht. Informationstafel Chorgestühl von 1691. Es wurde im 19. Jahrhundert aus der ehemaligen Prämonstratenserabtei Salival in Morville-lès-Vic hier her gebracht. Details des Chorgestühls aus Holz mit musizierenden Jungen. Sitz des Bischofs mit Wappen an der Rückwand. Detail eines Lesepults aus Metall von 1762. Gemälde im Chor von Jacques Durand, 1765. Der Heilige Epvre befreit Gefangene. Blick in das Gewölbe im Joch vor dem Chor. Hier haben sich noch Fresken mit Engeln erhalten, die ursprünglich die ganzen Gewölbe bedeckten. Unterhalb dieses Gewölbes das Grabmal aus Marmor von Kardinal Vaudémont. Geschaffen 1588 von Florent Drouin. Informationstafel Die Rückkehr des Kreuzfahrers Hugo de Vaudémont, der von seiner Frau umarmt wird. Diese Skulptur stammt aus dem Kloster des Priorats von Belval in den Vogesen. Es stammt wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. An den Chor schließt sich die Herzogskapelle oder Rundkapelle an. Sie wurde im Stil des italienischen Barock 1608-1612 errichtet. Auftraggeber war der Herzog von Lothringen Karl III. (1545-1608), der den Bau einer Kapelle als Grablege für die herzogliche Familie in der Nähe des Palastes haben wollte. Errichtet wurde sie nach dem Tod des Herzogs unter Herzog Heinrich II. Die Kapelle besitzt eine Kuppel mit einem Trompe-l'oeil – illusionistischer Malerei. Sie ist der Notre-Dame de Lorette gewidmet. Der Bau wurde Jean-Baptiste Stabili und Jean Richier (1581-1625) anvertraut, die sich angeblich von der ebenfalls achteckigen Medici-Kapelle in Florenz inspirieren ließen. 1632 wurde sie von Siméon Drouin (1591-1651) fertiggestellt. Ein Großteil der Dekoration und Architektur wurde während der Revolution zerstört. Aus dem 17. Jahrhundert ist nur noch die Trompe-l'oeil-Kuppel übrig. Die Kapelle enthält die Gräber der letzten Herzöge von Lothringen aus der Familie Habsburg-Lothringen. Straßen rund um die Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation. Auch hier Häuser im Stil des Art Nouveau. Details der Fassaden in der Rue Saint-Julien. Balkone mit Gittern aus Metall. Baujahr und Architekt steht häufig eingraviert an der Fassade. Hier Emile André (1871-1933), 1904. Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation: Sitz des Bischofs von Nancy. Sie wurde unter Leopold I. von Lothringen (1679-1729) zwischen 1703 und 1742 errichtet. Architekt war unter anderem Jean Betto der Jüngere, auch Giovanni Betto genannt (1642- 1722), der sich von der römischen Kirche Sant'Andrea della Valle inspirieren ließ. Die nachfolgenden Architekten Jules Hardouin Mansart (1646-1708) und Germain Boffrand (1667-1754) änderten die Pläne wieder. Der Abstand zwischen den Türmen und die Länge des Kirchenschiffs war für eine große zentrale Kuppel ausgelegt. Letztendlich wurde eine einfache Kuppel realisiert und zwischen den Türmen ein Giebel mit einer Uhr. Die barocke Kirche hat zahlreiche korinthische Stilelemente. Erst 1777 wurde die Kirche zur Kathedrale, als der erste Bischof von Nancy ernannt wurde und Lothringen, nach dem Tod von Stanisław Leszczyński, an Frankreich angeschlossen wurde. Details des Giebelfeldes, in dem 2 Adler eine Rüstung halten. Detail der Uhr. Einer der beiden Kirchtürme, mit einem offenen Pavillon und einer Laterne ganz oben. Blick von der Rue de la Primatiale auf den Chorabschluss der Kirche. Inneres: Grundriss. Die im wesentlichen rechteckigen Außenmauern zeigen im Inneren die Form eines lateinischen Kreuzes, 3 Kirchenschiffe mit jeweils 3 Kapellen und ein Querschiff. Blick in das 60 m lange und 13,5 m breite Kirchenschiff. Die mächtigen Pfeiler haben korinthische Pilaster. Über den Rundbögen zu den Seitenschiffen Flachreliefs mit Engeln. Blick in die Vierung mit der Kuppel. Informationstafel Blick in die Kuppel, die keine Laterne hat, die Licht in die Kuppel bringt. So ist das 200 qm große Deckengemälde relativ dunkel. Die Kuppel hat einen Durchmesser von 15,6 m und ist 7,80 m hoch. Das Gemälde verdanken wir Claude Jacquart (1686-1736). Es entstand von 1723-1725 und zeigt die „Himmlische Herrlichkeit mit der Heiligen Dreifaltigkeit“. Es ist inspiriert von dem Fresko von Giovanni Lanfranco (1582-1647) in der Kuppel der Kirche Sant'Andrea della Valle. Dort ist die Himmelfahrt Marias dargestellt. Informationstafel Blick von der Vierung in den Chor mit dem Hauptaltar und dem Chorgestühl. Gemälde von Claude Charles (1661-1747) aus dem Jahr 1747. Sie erzählen die Geschichte des Heiligen Sigisberg, Schutzpatrons der Kirche und der Stadt Nancy. Das Chorgestühl wurde 1725 von Germain Boffrand (1667-1754) geschaffen. Der Hauptaltar von 1763 ist aus Marmor. Vorne links der Sitz des Bischofs. Blick von der Vierung in das nördliche Querschiff. Barocker Nebenaltar aus Marmor im nördlichen Querschiff. Barocker Nebenaltar aus Marmor im südlichen Querschiff. Nebenaltar rechts neben dem Hauptaltar mit Wandpaneelen aus Holz. Sakristei mit Wandpaneelen aus Holz und einem Altar aus Marmor. Behälter für Hostien aus Marmor. Zwei Beispiele für Kreuzwegstationen in der Kirche. Vielarmiger Leuchter an der Wand. Blick durch das Mittelschiff auf eine Seitenkapelle im südlichen Seitenschiff. Detail des barocken schmiedeeisernen Gitters, welches die Kapelle abtrennt. Detail des Altars aus Marmor mit 3 silbernen Gefäßen. Blick Richtung Westen zum Ausgang und der wegen Restaurierung leider kaum sichtbaren großen Orgel. Sie geht zurück auf ein vom Orgelbauer Nicolas Dupont (1714-1781) 1763 erbautes Instrument. Sie wurde mehrfach restauriert, so auch jetzt 2023. Blick auf die ehemalige Residenz der Primaten und Prälaten von Nancy, direkt neben der Kathedrale. 1609 erbaut und im 18. Jahrhundert entsprechend dem Zeitgeschmack umgebaut. Heute ein Hotel. Villa Majorelle: westlich des Bahnhofs gelegen, ist dieses ehemalige Wohnhaus ein 1901/02 erbautes, herausragendes Beispiel für die Art Nouveau und den Stil der École de Nancy. Der berühmte Möbeldesigner und Unternehmer Louis Majorelle (1859-1926), beauftrage 1898 die Architekten Henri Sauvage (1873-1932) und Lucien Weissenburger (1860-1929) mit dem Bau des Hauses. Nach seinem Tod kaufte es die Stadt und nutzte es als Bürogebäude. Die Villa hat 3 Etagen und große Bogenfenster. Majorelle selbst fertigte die Schmiedearbeiten sowie die Inneneinrichtung, die Täfelung und die breite Treppe im Inneren. Zwei Zwerchhäuser dominieren einer der Fassaden. Dem größeren ist ein Balkon mit Gitter aus Metall vorgelagert. Alle schmiedeeisernen Arbeiten, incl. der Fallrohre für die Regenrinne, dem Gartenzaun und dem Eingangstor, sind von floralen Motiven dominiert, wie es typisch ist für die Art Nouveau bzw. den Jugendstil. Zahlreiche Details der Balkone, Fenster, des Eingangs mit Glasdach und Halterungen aus Metall. Historisches Foto mit Louis Majorelle links. Mit Fayencen verzierte Fassade eines anderen Hauses. Basilika Sacré-Cœur: Die Kirche unweit der Villa Majorelle, wurde 1905 fertiggestellt. Sie ist im neuromanisch-byzantinischen Stil erbaut und dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht. Architekt war Antony Rougieux (1854–1906), einem Schüler von Julien Guadet. Die eklektizische Gestaltung ist inspiriert von der Sacré-Coeur auf dem Montmartre in Paris. Die Fassade mit zwei Türmen ist nach Norden ausgerichtet. Die dreischiffige Basilika hat eine 45 m hohe Vierungskuppel. Fassade mit 3 Rundbogenportalen. Über dem mittleren Portal kleine Rundbogenarkaden und darüber eine Fensterrose. Im Tympanon der thronende Christus, flankiert von zwei Heiligen und knieend links wohl der Bauherr Bischof Charles-François Turinaz (1838–1918) und rechts ein Bauer. Tympanon des linken Portals. Inneres: Blick durch das Langhaus der dreischiffigen Basilika Richtung Chor und Hauptaltar. Im Mittelschiff Tonnengewölbe. Die Gurtbögen sind zweifarbig gestaltet. Blick durch das westliche Seitenschiff, welches Kreuzgratgewölbe hat. Blick durch das Mittelschiff auf das östliche Seitenschiff. Blick vom Mittelschiff auf den Chor und den Hauptaltar. Links die Kanzel. Detail der Kanzel aus Holz. Mittelschiff kurz vor der Vierung mit der Kuppel. Blick von der Vierung in die Kuppel. Chor mit dem Hauptaltar Hauptaltar aus Stein und goldfarbenen Flachreliefs. Nebenaltar am Ende des westlichen Seitenschiffs. Gemälde mit der Himmelfahrt Christi. Blick zurück durch das Langhaus Richtung Eingang und Orgel. Die Orgel von Charles Didier-Van-Caster (1852–1906) wurde 1907 fertiggestellt und der berühmte Komponist und Organist Charles-Marie Widor (1844-1937)weihte sie im gleichen Jahr ein. Details der Orgelempore aus Stein mit musizierenden Engeln. Details der Kapitelle der Säulen, die mit skulptierten Engeln verziert sind. Taufbecken aus weißem Stein. Einrichtungsgegenstände, Tisch und Schrank aus Holz mit Schnitzereien und teilweise eingearbeiteten Bildern von Heiligen. Zwei Nebenaltäre aus Marmor mit Statuen einer Heiligen und Maria mit dem Jesuskind. Statuen mit der Darstellung des Kreuzweges aus weißem Marmor an den Wänden der Seitenschiffe. Liturgisches Gerät einer Glocke an einem Stab mit der kleinen Statue von Christus. Zahlreiche farbige Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert erzählen das Leben von Jesus.
-
Pont-à-Mousson: Die Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern, liegt auf beiden Seiten der Mosel, nördlich von Nancy Richtung Metz. Aufgrund ihrer strategischen Lage wurde die Stadt während beider Weltkriege mehrfach bombardiert. Place Duroc: Der Platz ist benannt nach dem General und Vertrauten Napoleon, Géraud Christophe Michel Duroc (1772-1813). Im Zentrum ein Brunnen, der an den Einsatz der amerikanischen freiwilligen Krankenwagenfahrer in Ostfrankreich von 1915 bis 1917 erinnert. Mehrere historische Gebäude haben sich hier erhalten, so auch die größte in Lothringen existierende Gruppe von Arkaden aus der Renaissance. Blick über den dreieckigen Platz Osterdekoration Blick auf die Arkaden Rathaus. Blick über die Mosel mit einem einem Lastkahn. Am anderen Ufer das ehemalige Kloster der Prämonstratenser. Seit 1964 ist der große Klosterkomplex ein Kulturzentrum und Sitz des Europäischen Zentrums für sakrale Kunst. Église Saint-Martin: Das Gotteshaus an gegenüer liegenden Ufer der Mosel, wurde ursprünglich als Klosterkirche des Ordens der Antoniter, des Antoniusordens, errichtet und ist Antonius dem Großen geweiht. Die Basilika mit 3 Schiffen, wurde im gotischen Stil errichtet und 1335 geweiht. Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche um die repräsentative Doppelturmfassade im Westen mit Portal und Fensterrose im Flamboyantstil erweitert. Im Zuge des Niedergangs des Antoniusordens, wurde die Kirche 1572 durch Papst Gregor XIII. an den Jesuitenorden übergeben. Seit 1784 ist sie Pfarrkirche und dem heiligen Martin von Tours geweiht. Details des Portals im Westen. Im Tympanon in der Mitte wohl der heilige Martin von Tours, flankiert von den Aposteln Petrus und Paulus unter gotischen Filialen. Links und rechts neben der Tür weitere Statuen von Heiligen unter gotischen Filialen. Südseite der Kirche mit einem neugotischen Anbau. Aus dem Kirchenschiff außen herausragender kleiner Anbau, ggf. ein Kapelle, mit zwei Wasserspeiern und einer teils verglasten Laterne auf dem Dach. Wasserspeier Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges vor der Kirche. Zurück über die Mosel mit Blick auf die Markthalle und den Turm der Kirche Saint-Laurent. Blick durch das Fenster in die Markthalle mit ihren tragenden Stahlkonstruktionen. Église Saint-Laurent: 1230 gegründet, aber vom originalen, sehr flachen, gotischen Kirchenschiff hat sich nichts erhalten. Die heutige Kirche entstand im 15. und 16. Jahrhundert. Ab 1822 wurde Teile der Kirche umgebaut. Das mittlere Portal und die beiden ersten Stockwerke des Turms stammen aus dem 18. Jahrhundert. Im Jahr 1900 wurde die Fassade verbreitert und der Turm mit der Laterne abgeschlossen. Die reich dekorierte Turmspitze zeigt auch 4 Statuen von Heiligen. Inneres: Blick vom Eingang der dreischiffigen Kirche mit Sternengewölbe zum Altar. Blick durch Kirche zur Orgel. Informationstafel zum gotischen Flügelaltar. Details des Flügelaltars. Der Altar ist in der Mitte geschnitzt und vergoldet. Die Flügel sind bemalt. Auf der Gesamtansicht sieht man die als Fotos neben dem Altar stehenden Tafeln mit den Bildern, die man nur bei geschlossenem Altar sehen würde. In der untersten Reihe, die links bei den bemalten Flügeln beginnt, wird der Marienzyklus gezeigt. Im oberen Bereich, sowohl die gemalten, wie die geschnitzten Bereiche umfassend, die Passion Christi. Das Zentrum des geschnitzten Teils. Unten von links: Geburt Christi mit der Anbetung der Hirten, Präsentation im Tempel und rechts die Anbetung der heiligen drei Könige. Darüber Szenen aus der Passion Christi mit der Kreuzigung in der Mitte. Der linke bemalte Flügel zeigt unten von links die Hochzeit von Maria und Joseph und die Verkündigung. Darüber der Judaskuss und die Verhaftung von Jesus, sowie Jesus vor Pilatus. Der rechte bemalte Flügel zeigt unten von links den Kindermord von Bethlehem und die Flucht nach Ägypten. Darüber die Grablegung und Auferstehung von Jesus Christus. Die Malerei der linken Außenseite: Taufe von Jesus und die Wiedererweckung des Lazarus. Die Malerei der rechten Außenseite: die Heilung des Blinden und die Auferstehung. Prächtige liturgische Gewänder Informationstafel Lebensgroße Statue aus Holz Von Jesus, der sein Kreuz trägt auf dem Weg zum Kalvarienberg. Ursprünglich handelte es sich um eine Gruppe von Statuen, zu der noch Maria und Johannes gehörten. Sie Stammt vom berühmten Bildhauer Ligier Richier (1500-1566/67). Es befand sich im Mont d'Olivet-Oratorium, welches Herzogin Philippa von Geldern im Klarissenkloster Pont-a-Mousson erbauen ließ. Gegenüber der Kirche in der Rue Saint-Laurent zwei historische Häuser mit dekorierten Fassaden und Hauseingängen.
-
Saint-Mihiel American Cemetery: Auf dem Weg Richtung Verdun befindet sich dieser, 16,4 Hektar große, amerikanische Kriegsgräberfriedhof mit 4.153 Gräbern mit Gefallenen amerikanischen Soldaten des ersten Weltkrieges. Die Grabstätte ist durch von Linden gesäumte Wege in vier gleiche Quadranten unterteilt. In der Mitte eine große Sonnenuhr und ein amerikanischer Adler.
-
Verdun: Die alte Bistums- und Festungsstadt, war mit ihrer Umgebung 1916 Schauplatz einer der blutigsten Schlachten des ersten Weltkrieges. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurde Verdun zu einer Festungsstadt umgebaut. Durch die Stadt fließt die Maas. Zolltor aus dem 16. Jahrhundert. Informationstafel mit historischen Fotos und Informationen zur Schlacht von Verdun. Mémorial de Verdun: 6 km nordöstlich von Verdun in Fleury-devant-Douaumont . Es ist ein Museum und eine Gedenkstätte zu den Schlachtfeldern von Verdun. 1951 gründet sich das Nationale Komitee zur Erinnerung an Verdun. Ihr Präsident und Schriftsteller Maurice Genevoix (1890-1980), gab 1960 den Anstoß zum Bau der Gedenkstätte. 1967 wurde sie eingeweiht. 2013-2016 wurde das Museum renoviert. Zum 100. Jahrestag des Beginns der Schlacht um Verdun, am 22. Februar 2016 wurde es wieder eröffnet. Eingang Kanone Beeindruckende Gestaltung der Fassade, die den den Blick aus einem Bunker zeigt. Karte von Verdun und Umgebung mit den Frontlinien im September 1914. Informationstafeln mit Erläuterungen zum Verlauf der Schlacht in französisch, englisch und deutsch. Karte von Verdun und Umgebung mit den Frontlinien 1917 und1918. Zwei mal die Karte von Europa mit den Staaten im Jahr 1914. Farblich gekennzeichnet die beiden Blöcke der Kriegsgegner. Der Verlauf der Frontlinie zwischen Deutschem Reich und Frankreich und Belgien 1914. 1915 mit mehreren Frontlinien im Osten, Süden und Westen des Deutschen Reichs. 1916 mit der Frontlinie rund um Verdun. Der Verlauf der Frontlinie bei Belgien im Jahr 1918. Blick auf den mit Munition übersäten Boden eines Schlachtfeldes. Politisches Plakat mit Soldaten, die auch aus den afrikanischen Kolonien Frankreichs kamen. Die Tapferkeit der Kolonialtruppen wird hier gerühmt. Vitrinen mit verschiedenen Uniformen und Helmen. Schild eines Soldaten aus Indochina. Titelblätter von Zeitschriften. Verschiedene Helme. Bierkrüge und gerahmte Gedenkblätter mit Motiven des ersten Weltkrieges. Kanone Munition und Gasmasken. Historische Filmaufnahmen und Fotos werden auf eine Leinwand hinter aufgestellten Kanonen und Waffen projiziert. Trompeten als Signalgeber während der Kampfhandlungen. Handgranaten Funkgerät und ein historisches Foto der Funker aus dem Unterstand. Auch Tauben, Brieftauben, wurden zur Übermittlung von Nachrichten eingesetzt. Man sieht die kleine Hülse aus Metall mit der Nachricht an ihrem Fuß. Informationstafel zum Thema Verwundung und medizinische Versorgung im ersten Weltkrieg. Verschiedene Utensilien eines Militärarztes, Injektionsspritzen, chirurgische Instrumente, abgepackter Verbandsstoff. Während des Krieges wurden 3,5 Millionen französische Soldaten verletzt und 4,2 Millionen deutsche Soldaten. Karren für den Transport von Verletzten. Instrumente und Utensilien eines Operationssaales. Uniform einer Sanitäterin vom Roten Kreuz. Prothesen für verschieden Körperteile. Historische Fotografien von schwer verletzten ehemaligen Soldaten, die aber mit schweren Verstümmelungen überlebt haben, zum Beispiel ein Geiger mit einer Handprothese. Verschiedene Gewehre. Historische Fotos von Soldaten. Historisches Foto der Generalstäbe während des Krieges. Von links nach rechts: Paul von Hindenburg, Kaiser Wilhelm II., General Erich von Falkenhayn. Journalistische Porträts verschiedener Kriegsteilnehmer, jeweils mit historischem Foto: Friedrich-Wilhelm von Hohenzollern, Kronprinz von Preußen (1882-1951). Erich Ludendorff (1865-1937) Paul von Hindenburg (1847-1934) Joseph Joffre (1852-1931) Philippe Pétain (1856-1951) Robert Nivelle (1856-1924) Charles Mangin (1866-1925) Édouard de Castelnau (1851-1944) Uniform, Säbel und Gehstock. Vitrine mit militärischen Orden. Teller, Tassen, Gedenkblätter, Spielzeug mit Motiven des ersten Weltkrieges. Informationstafel zum Thema Tiere im Krieg, hier vor allem Pferde, aber auch Brieftauben. Flugzeuge Vitrine mit Modellflugzeugen und original großen Propellern von Flugzeugen, Thema Luftkrieg. Fotos von berühmten Piloten und der Anzahl der abgeschossenen feindlichen Flugzeuge, u. a. Manfred von Richthofen. Uniform und Helme von Piloten. Der Weltkrieg als Motiv für Spielzeug mit Figuren aus Papier und Holz, sowie einem Bilderbuch mit militärischen Bildern. Ehrenurkunde für einen gefallenen Soldaten mit der Unterschrift von Kaiser Wilhelm II. Weitere Ehrenurkunde. Privates Fotoalbum mit historischen Fotografien. Gemälde zeigt den Besuch bei den Eltern eines gefallenen Kameraden aus dem Buch „Trente Mille Jours“ von Maurice Genevoix, dem Begründer dieser Gedenkstätte. Modell und Plakat vom Beinhaus von Douaumont, bzw. Ossuaire de Douaumont. Hier liegen 130.000 nicht identifizierte französische und deutsch Soldaten. Soldatenfriedhof mit französischen gefallenen Soldaten. Im Hintergrund Kanonen. Blick in das Tal der Mosel.
Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.