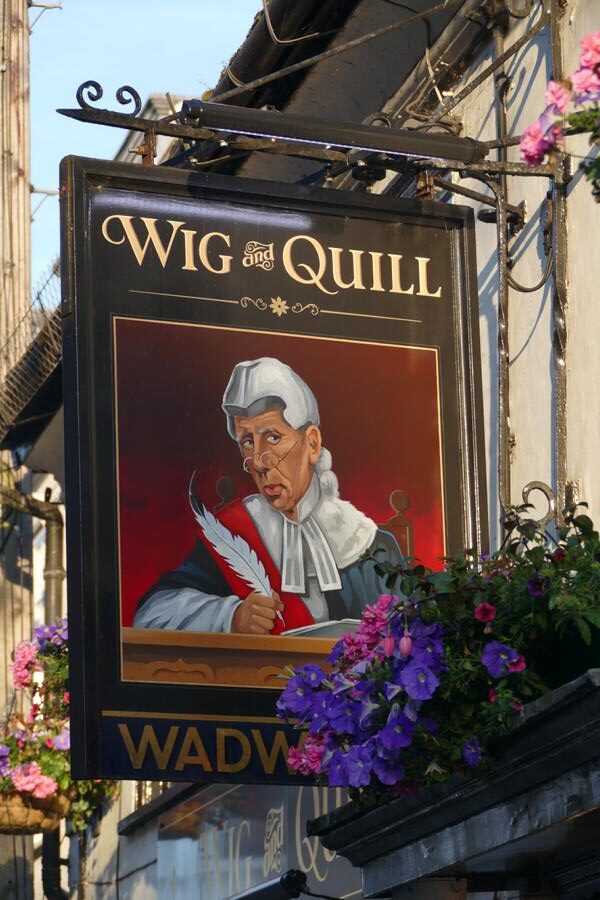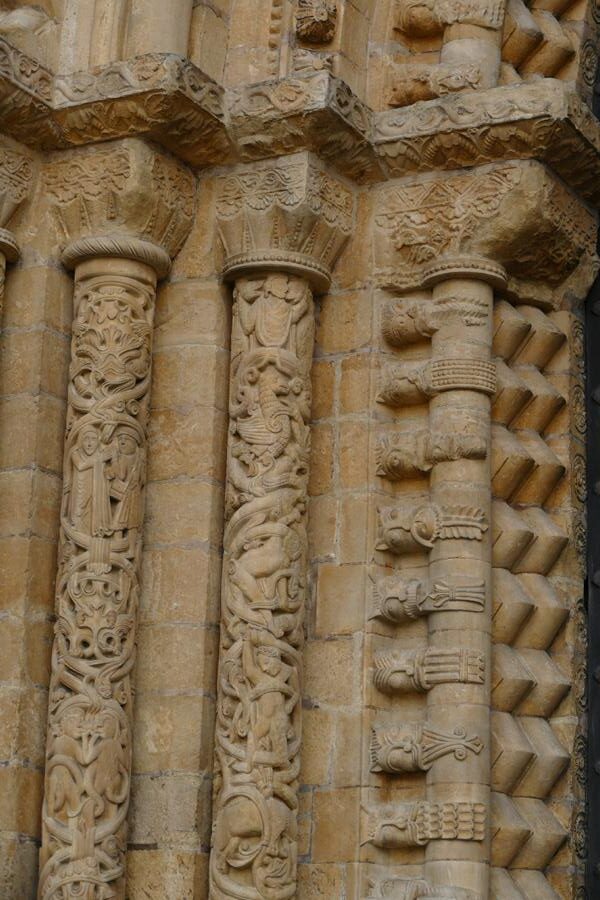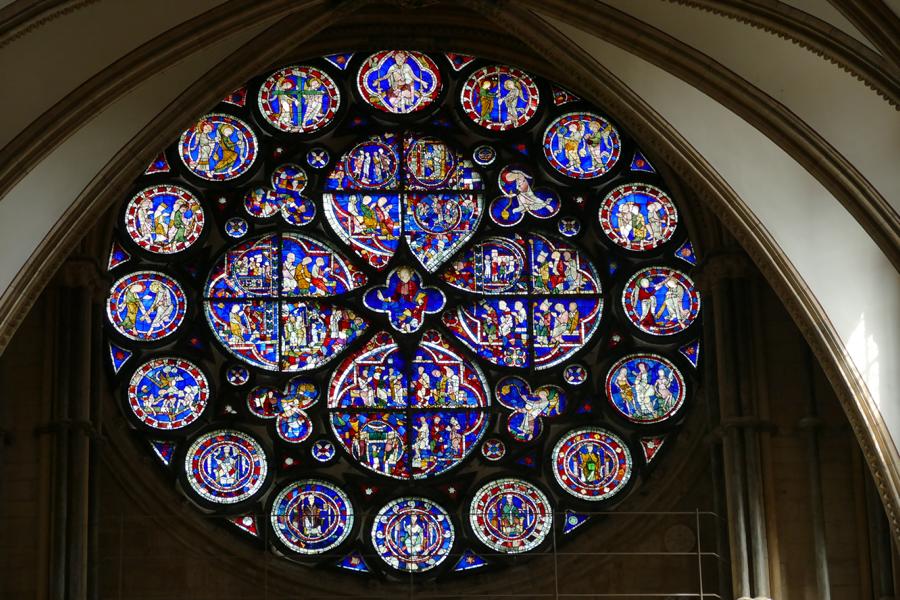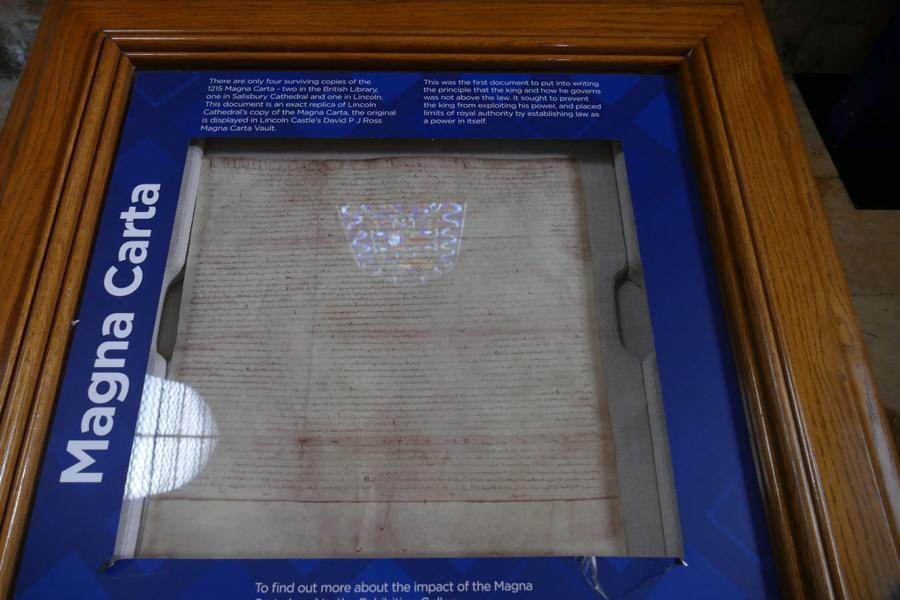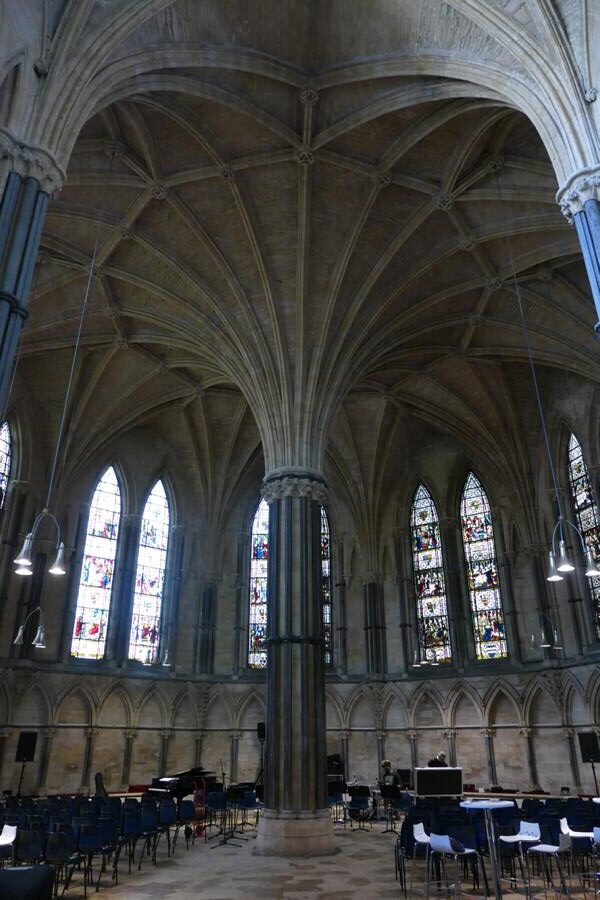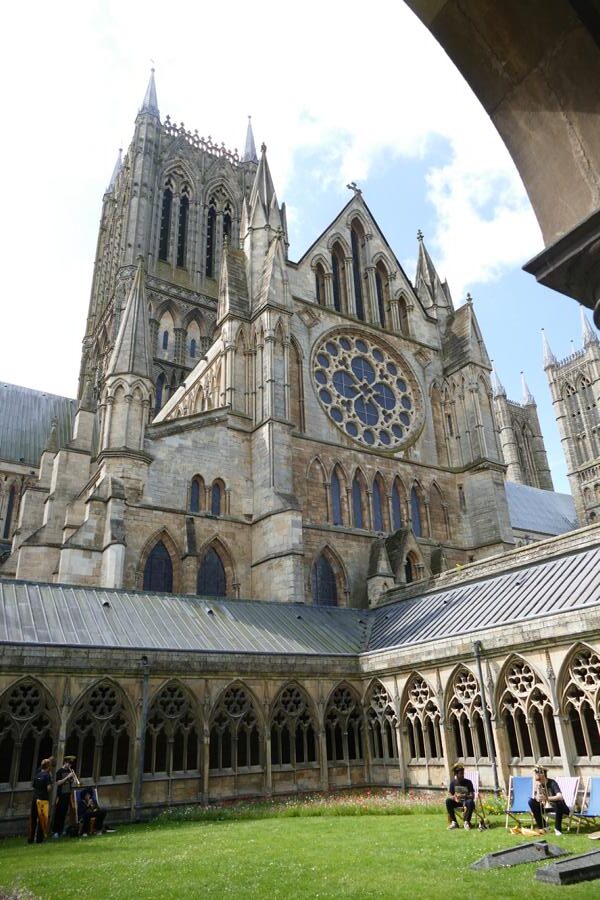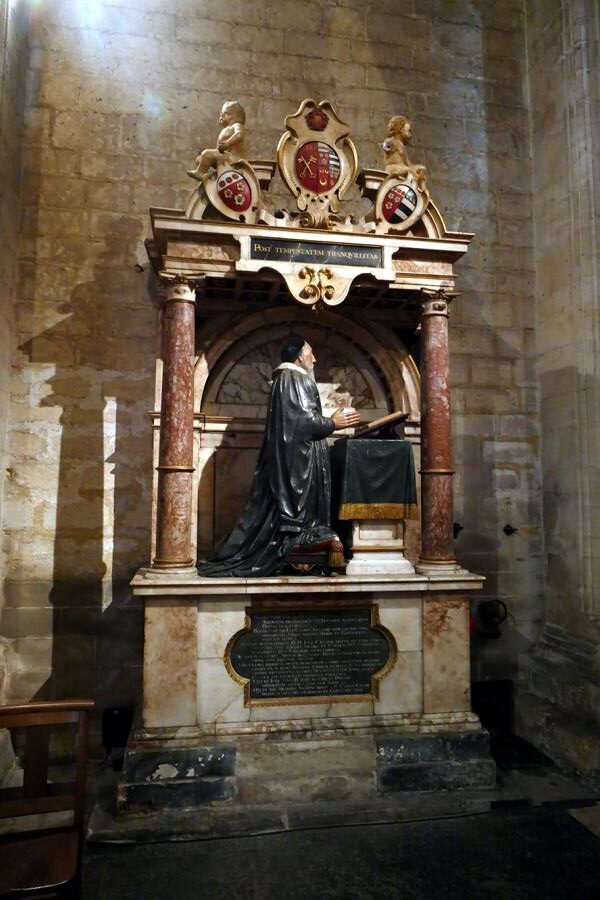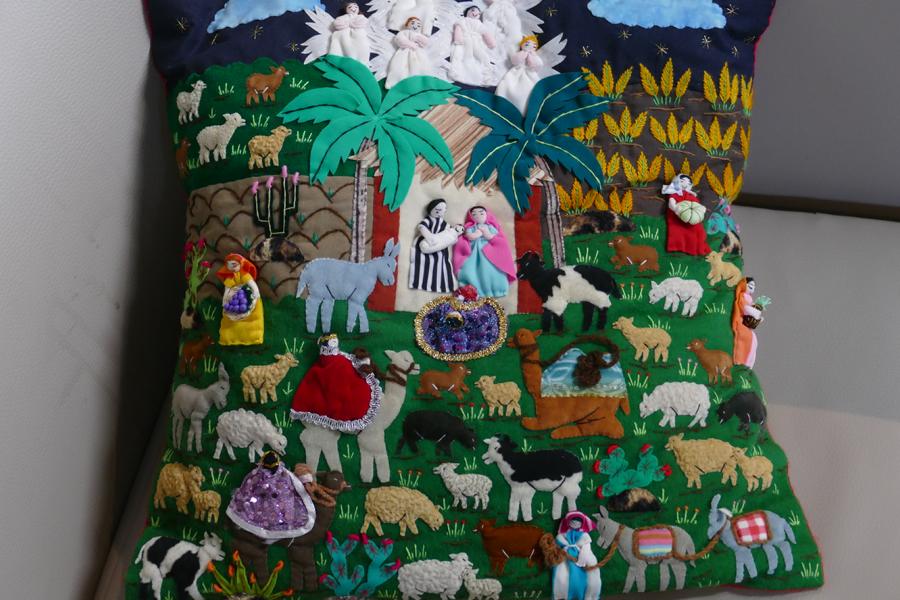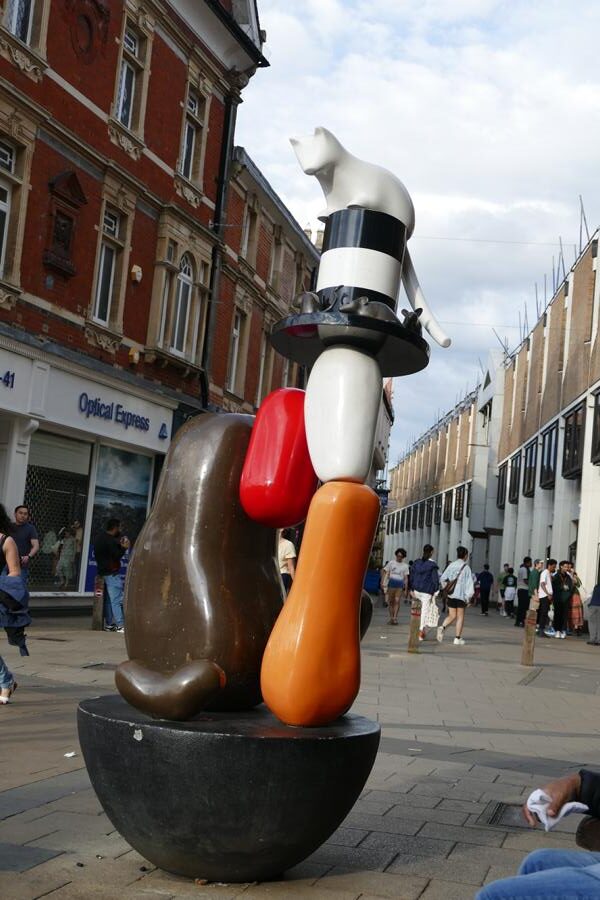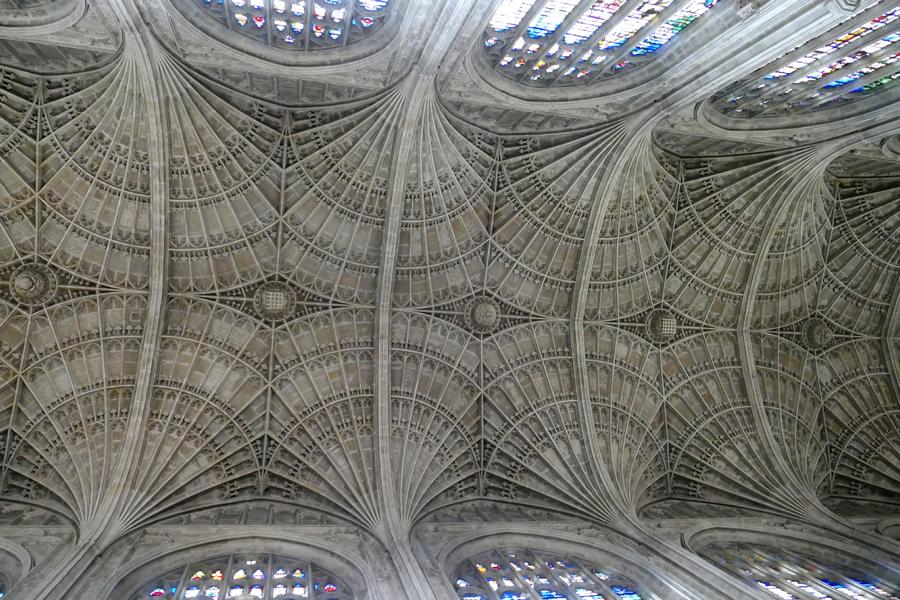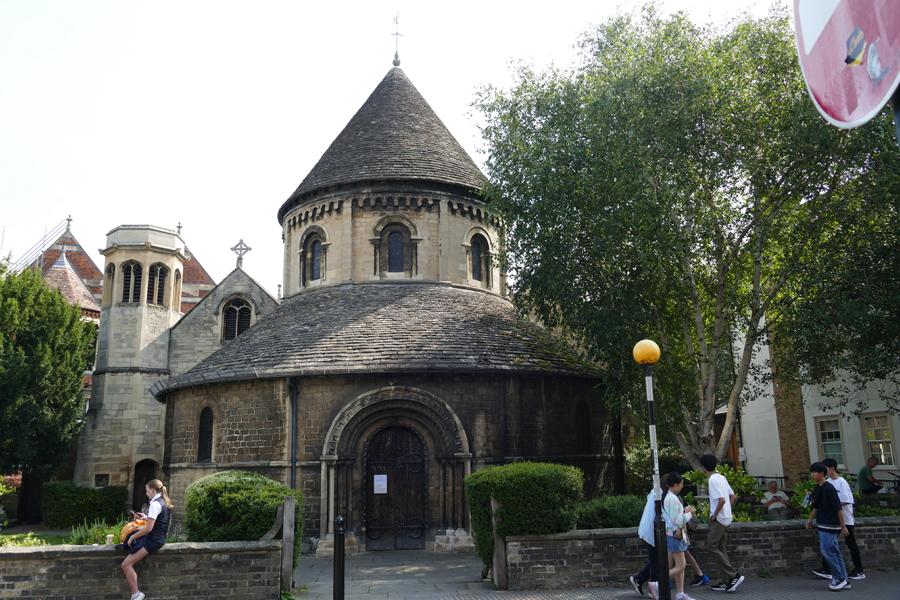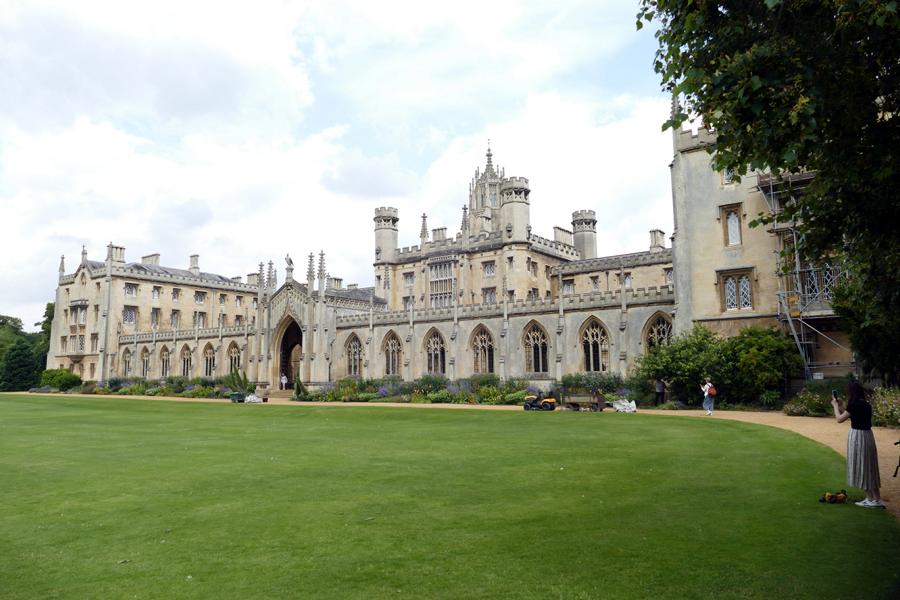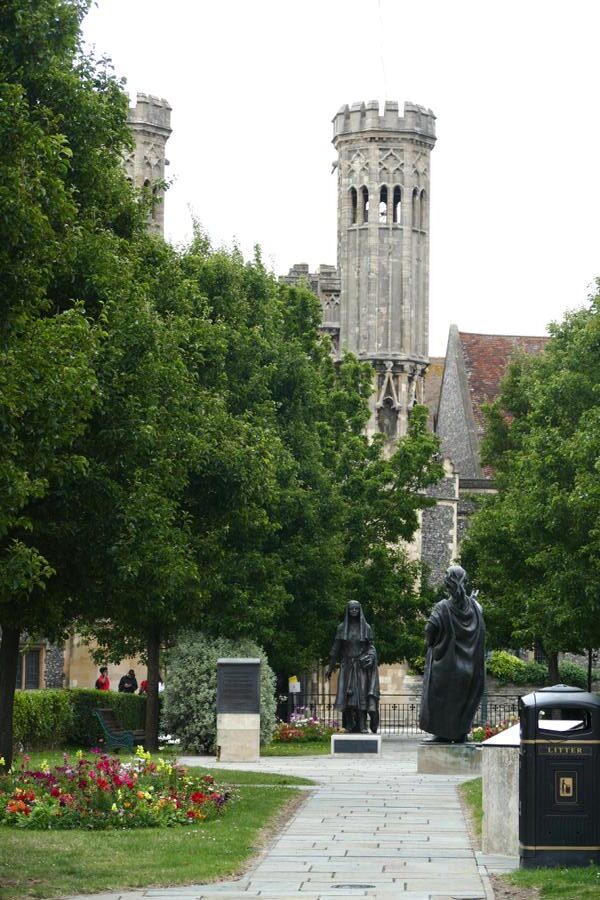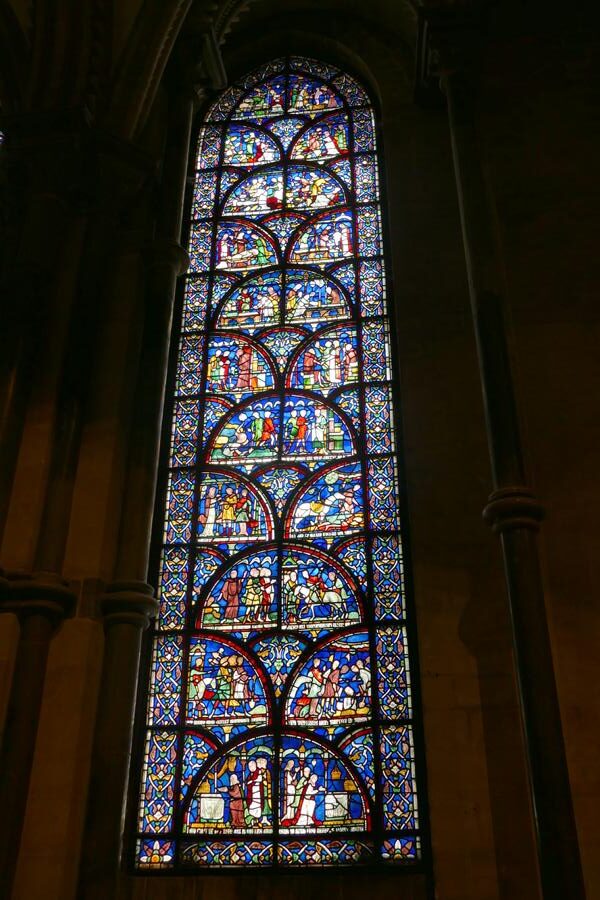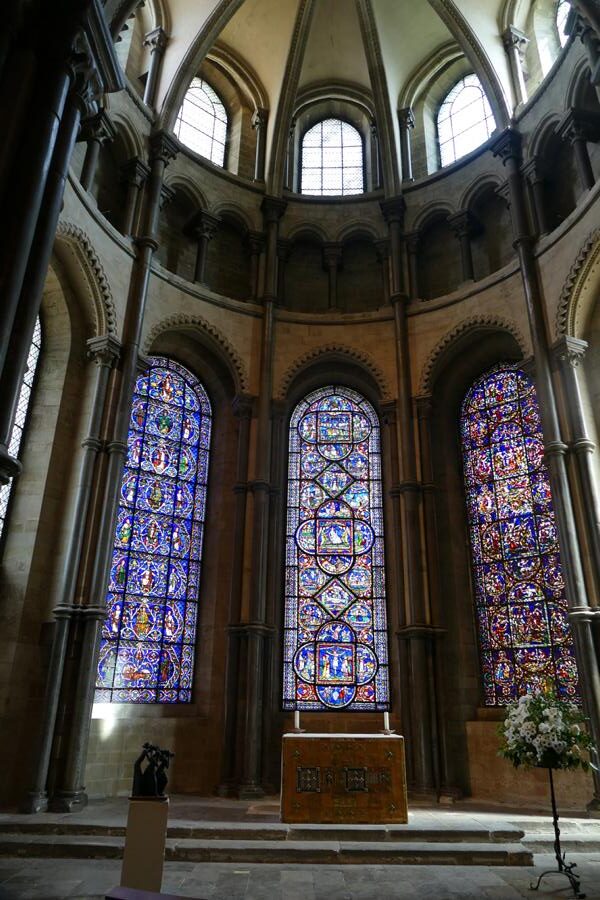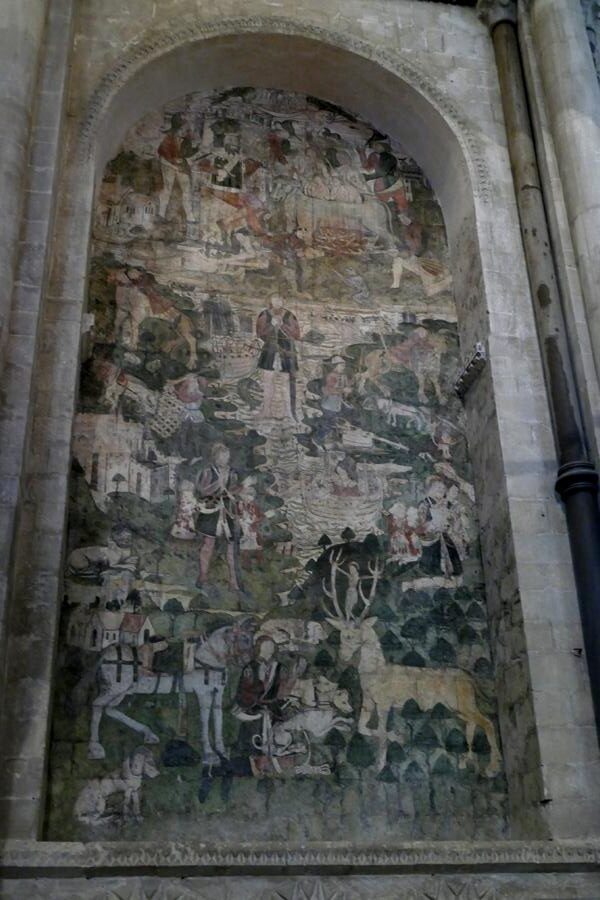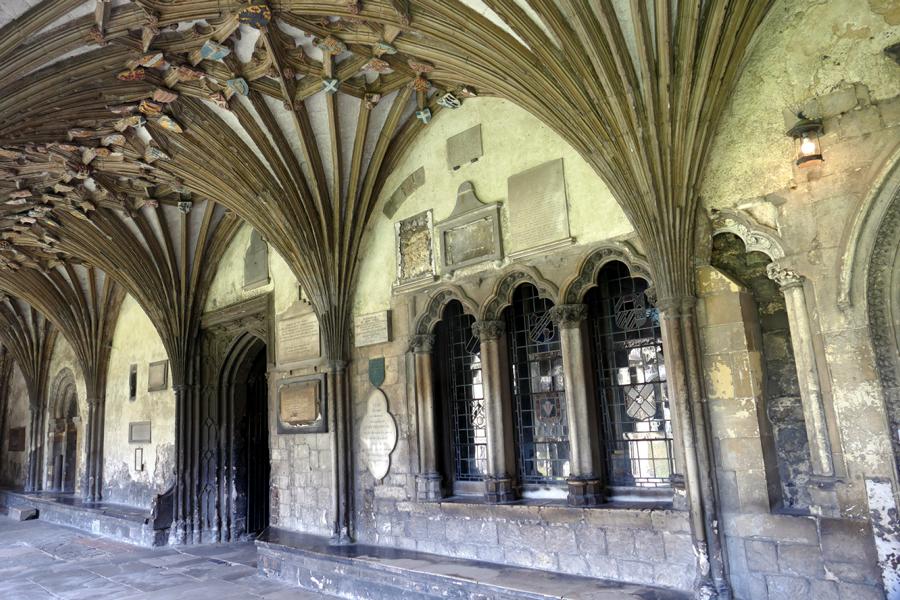Ausführlicher Reisebericht mit allen Bildern.
Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular
England 15. – 28.07.2024
-
Abfahrt mit der Autofähre von DFDS von Dünkirchen bzw. Dunkerque in Frankreich nach Dover in England. Verladung der Autos und Lastkraftwagen.
Blick auf des Terminal und den Hafen.
Segelschiff und Containerschiffe auf dem Ärmelkanal.
Landkarte mit unserer geplanten Rundreise: Dover, Folkestone, Salisbury, Wells, Bath, Lincoln, Ely, Cambridge, Canterbury. -
Dover: weiße Kreidefelsen von Dover. Die bis zu 106 Meter hohe Front der Klippen verdankt ihr Erscheinungsbild ihrer Zusammensetzung aus Kalk, durchsetzt mit schwarzem Feuerstein. Die Klippen verlaufen östlich und westlich der Stadt Dover in der Grafschaft Kent, einem alten und noch immer bedeutsamen englischen Hafen.
Fährhafen von Dover
Typischer gotischer Kirchturm auf dem Weg nach Folkestone. -
Folkestone: Die Stadt mit ca. 55.000 Einwohnern liegt direkt am Ärmelkanal, dicht an der Hafenstadt Dover.
Hotel direkt an der Grünanlage, die an die Klippen grenzt.
Blick auf den Strand unterhalb der Klippen. Ein Weg führt durch Kiefern und andere Pflanzen runter zum Strand.
Leas Cliff Hall: ein Veranstaltungsort mit 900 Sitzplätzen, direkt in der Grünanlage am Rand der Klippen.
Blick auf den Strand und dort liegende Hotelanlagen.
Rastplatz auf der Klippe mit Silbermöwe.
Hotel Best Western mit einem Denkmal für William Harvey.
Blumenbeet als Denkmal für den 80. Jahrestag des D-Day – 06.06.- 25.08.1944.
Informationstafel zum D-Day.
Musikpavillon von 1895. Folkstone war seit der viktorianischen Zeit ein Ferienort für die Reichen. Prächtige Villen und Hotels entstanden und ein Musikpavillon gehörte dazu.
Informationstafel.
Aussichtsterrasse und Bar in einem historischen Gebäude mit Blick auf das Meer. -
Salisbury: früherer Namen waren New Sarum und Sorviodunum. Die heutige Stadt mit nahezu 50.000 Einwohnern, ganz in der Nähe des Steinkreises von Stonehenge, ist berühmt wegen ihrer Kathedrale. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde der eisenzeitliche Burgwall Old Sarum erbaut. Die Römer, die Angelsachsen und seit dem 11. Jahrhundert nutzten auch die Normannen diesen Ort als Festung. Unter normannischer Herrschaft wurde die Stadt Bischofssitz. Der wegen seiner Textilherstellung bekannte Ort, verlor seine Bedeutung während des Bürgerkrieges im 17. Jahrhundert.
Stadtplan, ganz unten die Kathedrale
Häuser in der Innenstadt von Salisbury. Es gibt viele sehr alte Fachwerkhäuser.
„The Old House“ ein Guesthouse, eingerichtet wie ein kleines Museum, mit wunderbarem englischen Frühstück.
Teil des Gartens und eine Skulptur von Kath Hudson, die das Innere der Kathedrale von Salisbury zeigt.
St. Ann’s Gate: Um 1331 erbaut ist es einer der Eingänge zum Innenhof der Kathedrale – der größte Innenhof in ganz England. Die Mauern des Innenhofs wurden aus Steinen gebaut, die aus der verlassenen Kathedrale in Old Sarum geborgen wurden. St. Anne’s Gate wurde ebenfalls aus diesen Steinen gebaut. Es ist zwei Stockwerke hoch und hat einen zentralen Steinbogen. Im Obergeschoss über dem Torbogen befindet sich eine kleine Kapelle, die durch spitzbogige Dreiflügelfenster an der Ost- und Westseite beleuchtet wird. Sie war der heiligen Anna under der Jungfrau Maria geweiht. Nach der Reformation wurde sie zum Musikzimmer. Georg Friedrich Händel gab hier sein erstes Konzert in England.
Eingangstor zum Malmesbury House. König Karl II. hielt sich hier 1665 auf. Er war auf der Flucht vor der Pest in London. Er hielt gern Reden aus seinem Fenster.
Direkt daneben die Kirche des Sarum College. Es ist ein Zentrum theologischer Ausbildung in Salisbury. Es wurde 1995 gegründet und befindet sich an der Nordseite der Kathedrale.
Kathedrale oder Marienkathedrale: Der Vorgänger dieser Kathedrale stand auf einem Hügel bei Old Sarum, an der Stelle einer ehemaligen eisenzeitlichen Siedlung. Der Standort erwies sich aus verschiedenen Gründen als nicht günstig. So erhielt Richardus Poore (gest. 1237), als er Bischof geworden war, vom Papst die Genehmigung eine Kathedrale an einem günstigeren Ort zu bauen. 1220 Baubeginn auf einer Schotterterrasse, auf unbebautem Gelände. Die Schotterterrasse liegt 1,2 m unterhalb des Bodenniveaus, was vereinzelt zu Problemen mit Wasser geführt hat. Baumeister war Nicholas von Ely (gest. 1280). Für die gotische Architektur war wahrscheinlich der Chorherr Elias of Dereham (1167-1246) verantwortlich. Der östliche Bereich der Kathedrale machte schnelle Fortschritte und bis 1258 waren die Arbeiten am Chorraum, dem Querschiff und dem Langhaus abgeschlossen. Unterstützt wurde der Bau durch große finanzielle Spenden und Baumaterial von König Heinrich III. (1207-1272).
Aufgrund der kurzen Bauzeit der Kathedrale entspricht der Baustil weitestgehend der frühen englischen Gotik. Der im frühen 14. Jahrhundert ergänzte Vierungsturm ist seit 1561 mit 123 Metern der höchste Kirchturm Großbritanniens, da in diesem Jahr der höhere Vierungsturm der alten St. Paul’s Kathedrale in London eingestürzt war. Während der Reformation und dem englischen Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert wurde die Kathedrale kaum beschädigt. Allerdings litt das Bauwerk unter Vernachlässigung und so wurde im späten 18. und im 19. Jahrhundert eine Restaurierung dringend notwendig. Besonders drastisch waren die Eingriffe, die James Wyatt 1789-1792 durchführte. Wyatt riss den freistehenden Glockenturm, der in der Zwischenzeit als Bierschänke fungierte, ab und ebnete das Gelände vor der Kathedrale zu einer Grasfläche. Daher besitzt die Kathedrale von Salisbury neben den Kathedralen von Ely und Norwich keinen Glockensatz zum Wechselläuten.
Grundriss, Norden ist unten. Der Grundriss der Kathedrale von Salisbury zeigt eine für die Early English Period typische dreischiffige Basilika mit zwei Querhäusern. Der für französische Kathedralen typische Kapellenkranz im Chor fehlt ganz, dafür wurden Kapellen in den Seitenschiffen der Querhäuser eingebaut.
Gesamtansicht von Nordosten. Links der Chor mit seinem geraden, gestuften Abschluss, dann die wie ein kleines Querschiff vorspringende Morgenkapelle und das zweite Querschiff.
Blick auf den gestuften Chor und die nördliche Fassade der Morgenkapelle.
Blick auf das nördliche Querschiff mit dem Turm auf der Vierung.
Turm auf der Vierung im frühen Decorated Style. In 30 m Höhe kann man noch die originalen Zinnen des schlichten Turms aus dem 13. Jahrhundert entdecken. Erst 1310-1333 erhielt der Turm weitere Zusätze, zuletzt die achteckige Turmspitze. Da die Baumeister kaum baustatische Kenntnisse besaßen und die gotische Baukunst im Wesentlichen auf Erfahrung und dem Prinzip von Versuch und Irrtum basierte, war der Turm mit 6500 Tonnen für die tragende Konstruktion zu schwer geraten. Damit er nicht einstürzt, hat Christopher Wren 1668 bei einer Inspektion die nachträglich Stabilisierung durch Strebepfeiler in der Vierung und die Armierung mit Stahlbändern angeordnet.Blick von Norden auf die Vierung und einen kleinen Anbau mit dem Nordportal. .
Blick in den Vorraum zum Nordportal.
Details des Gitters aus Metall vor dem Vorraum.
Blick von Nordwesten auf die Kathedrale. Davor einige moderne Kunstwerke, unter anderem die „Wandernde Madonna“, eine Plastik aus Bronze von Elisabeth Frink (1930-1993) von 1981.
Unterbau mit Statuen vom Nordturm der Westfassade. Von links nach rechts: Heilige Birinus, Heilige Edeltraud, Heinrich VI.
1265 fertiggestelle Westfassade. Rechts die Westwand des Kreuzganges. Hier befindet sich heute der Eingang. In Gegensatz zu gotischen Kathedralen in Frankreich überwiegt die Horizontale. Die Fassade ist einschließlich ihrer Strebepfeiler durchsetzt von Reihen übergiebelter Nischen, in denen Figuren stehen. Die meisten davon wurden erst im 19. Jahrhundert angebracht. Zwischen den Figurenreihen wurden Zickzackbänder und ausgestanzten Vierpässen eingesetzt. Der waagerechte Abschluss der Fassade wird nur vom Giebel des Mittelschiffs und seitlich aufgesetzten Turmhelmen unterbrochen. Die Portale sind klein und befinden sich in den Sockeln.
Linke Seite der Westfassade. Links unten Statuen von 2 Bischöfen und König Heinrich III. An dem Vorsprung weitere Bischöfe. Darüber v.l.n.r.: Heilige Ambrosius, Heilige Hieronymus, Heilige Gregor der Große mit Taube, Heilige Augustinus von Hippo. Am Vorsprung der Heilige Aldhelm, ein Werk von Jason Battles von 2001. Darüber v.l.n.r.: Heilige Judas Thaddäus, Heilige Simon Zelotes, Heilige Andreas mit Kreuz, Heilige Thomas.
Mittlerer und rechter Teil der Westfassade.
Im rechten Teil links unten Bischof Brithwold. Rechts neben der Tür v.l.n.r.: Heilige Alban, Heilige Alphege mit Steinen, Heilige Edmung der Märtyrer mit Dolch, Heilige Thomas von Canterbury. Darüber v.l.n.r.: Johannes der Täufer, neben dem Fenster Heilige Stefan mit Steinen, Heilige Lucia, Heilige Agathe mit Folterzange, Heilige Agnes, Heilige Cecilia. Darüber v.l.n.r.: ganz links neben dem Vorsprung der Heilige Lukas, darüber Apostel Johannes. Beim Vorsprung der Heilige Paulus mit Schwert. Neben dem Fenster v.l.n.r.: Heilige Jakobus der Jüngere, Heilige Jakobus der Ältere mit Pilgerstab, Heilige Bartholomäus, Heilige Matthias.
Unterer Bereich des Westportals mit Portalen. Über dem mittleren Portal v.l.n.r.: am Vorsprung Apostel Johannes, dann Heilige Barbara mit Buch, Palmzweig und Turm, Heilige Katharina mit Rad und Schwert, Heilige Rochus, Heilige Nikolaus, Heilige Georg mit Drachen, Heilige Christophorus mit Jesuskind, Heilige Sebastian, Heilige Kosmas, Heilige Damian, Heilige Margaret mit Drachen, Heilige Ursula, auf dem Vorsprung Johannes der Täufer. An den Vorsprüngen neben dem Hauptportal links Heilige Osmund Bischof von Salisbury, rechts Bischof Brithwold.
Blick auf den oberen Teil der Westfassade. Ganz oben im Giebel der Adler des heiligen Johannes, darunter der thronende Christus. In den obersten Blendarkaden Engel. In den oberen Vorsprüngen jeweils ein Engelsthron. Werke von Jason Battles von 1999-2000. Darunter in Nischen links Abraham mit Opfermesser und rechts Noah mit der Arche.
Tympanon des Hauptportals im Westen. Madonna mit Kind, flankiert von Weihrauch schwenkenden Engeln.
Details von Wasserspeiern im unteren Bereich der Westfassade.
Inneres:
Gleich hinter den Portalen im Westen das Grabmal aus Marmor von Thomas Lord Wyndham (1681-1745).
Modell der Kathedrale von Salisbury während der Bauarbeiten.
Blick in das Kirchenschiff Richtung Osten mit seinen drei Ebenen: über den Säulen das Triforium, welches mit einem hinter der Bogengalerie liegenden Gang typisch englische Architektur ist. Darüber der Obergaden mit seinen hohen Fenstern. Das Langhaus mit seinen 3 Schiffen ist genauso hoch wie breit. Seine sehr klare, gegliederte Wirkung ergibt sich auch aus dem farblichen Kontrast, den die schwarz polierten Säulenschäfte aus Purbeck-Marmor zum hellen, einheimischen Kalkstein bilden. Im Mittelalter war in der Höhe des Querhauses der für den Klerus reservierte östliche Teil des Kirchengebäudes durch einen Lettner abgetrennt. Das Langhaus ist innen 134,7 m lang und 13,4 m breit. Das Gewölbe ist 25,5 m hoch. Es gibt 1900 Sitzplätze. Es gibt 8760 Säulenschäfte, was der Anzahl an Stunden im Jahr entspricht. Es gibt 365 Fenster, so viel wie Tage im Jahr. Heute sind die meisten Fenster einfarbig verglast, das die früheren bunten Glasfenster während der Reformation entfernt wurden.
Blick in das Gewölbe des Langhauses.Das nördliche Seitenschiff mit Flaggen von britischen Regimentern des 2. Weltkrieges.
Das südliche Seitenschiff.
Grabmal eines unbekannten Ritters. Früher ging man davon aus, dass die Rüstung von William Longespee dem Jüngeren stammt, der 1250 im Siebten Kreuzzug starb, doch neuere Forschungen bestätigen, dass die Rüstung aus dem 14. Jahrhundert stammt.
Sarkophag in der Mitte des Langhauses.
In der Mitte des Langhauses befindet sich das Taufbecken mit stetig fließendem Wasser. Es wurde im Jahr 2008 vom Designer William Pye (1938-) neu geschaffen.Informationstafel zur mechanischen Uhr.
Dies ist die älteste funktionierende mechanische Uhr der Welt, hergestellt im Jahr 1386 oder früher, im Auftrag von Bischof Erghum (gest. 1400), von drei Uhrmachern aus Delft. Im Gegensatz zu modernen Uhren verfügt sie weder über ein Zifferblatt noch über Zeiger, sondern zeigt die Zeit durch stündliches Schlagen einer Glocke an. Die Uhr befand sich ursprünglich zusammen mit den Glocken der Kathedrale in einem separaten Turm. Als der Glockenturm 1790 abgerissen wurde, wurde die Uhr in die Kathedrale verlegt. 1884 wurde eine neue Uhr installiert. 1919 wurde die ausrangierte Uhr wiederentdeckt und schließlich 1956 repariert und in Stand gesetzt.
Farbiges Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert.
Epitaph für Edward Wyndham, gestorben mit 19 Jahren im 1. Weltkrieg.
Detail des unter dem Epitaph liegenden Kranzes aus Remembrance Poppies, künstlichen Mohnblüten, die vor allem im englischsprachigen Raum als Symbol des Gedenkens an die Opfer, der vor allem in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten gelten.
Grabmal von Sir John de Montacute. Er kämpfte 1346 in Crécy und 1356 in Poitiers und war später Verwalter von König Richard II. Er starb 1389.Blick vom Mittelschiff im Langhaus in das 1479 netzförmige Gewölbe der Vierung. Das westliche Querhaus ist 62 m breit.
Grabmal von John Lord Cheney. Er war Bruder des Dekans von Salisbury, Leibwächter und oberster Handlanger der Könige Edward IV., Richard III. und Heinrich VII. und wurde von allen dreien zum Ritter geschlagen. In der Schlacht von Bosworth wurde er von einem Schlag von Richard III. abgesetzt, blieb jedoch unverletzt und rettete das Lancastrian-Banner, als der Träger getötet wurde. Er war Friedensrichter für Dorset, Abgeordneter für Wiltshire und Geheimrat. Nach einer herausragenden Militärkarriere starb er 1499. Sein Grab befand sich ursprünglich in der Bischofskirche von Beauchamp.
Die westliche Vierung mit achteckigem Altar und Blick in das südliche Querschiff.
Blick in das Gewölbe der westlichen Vierung.
Das nördliche Querschiff mit den abgeteilten Seitenkapellen und zahlreichen Epitaphen und Grabmälern.
Farbiges Glasfenster im nördlichen Querschiff – Motive Moses mit den Gesetzestafeln, Bergpredigt
Grabmal von James, 1. Earl of Malmesbury (1746-1820) und Epitap für Richard Jefferies (1848-1887).
Grabmal eines Bischofs und weitere Grabmäler.
Informationstafel.
Blick von der westlichen Vierung, über die Kanzel, Richtung Chorraum mit Chorgestühl und bemalter Decke vom Kreuzrippengewölbe.
Blick in das Gewölbe von der westlichen Vierung durch den Chorraum mit bemaltem Kreuzrippengewölbe und der dahinter liegenden östlichen Vierung mit Scherenbögen.
Kanzel aus Sandstein und Marmor.
Blick in den Chorraum mit Chorgestühl. Der mittelalterliche Lettner, der den Chorraum vom Langhaus trennte, wurde 1789-1792 während der Sanierung unter Wyat entfernt. Über dem Chorgestühl sieht man Teile der neuen, von Georg III. gespendeten Orgel. Das Chorgestühl ist das umfangreichste, komplette Gestühl in ganz Großbritannien. Das hintere Gestühl zu beiden Seiten, war ein Geschenk von Heinrich III. von 1236 und gilt als das früheste. Die Baldachine darüber sind aus dem frühen 20. Jahrhundert und enthalten Statuen der Bischöfe von Salisbury.
Östliche Vierung: Da sich schon während der Konstruktion, der Vierungsturm Richtung Südwesten begann zu neigen, wurden bei Sicherungsarbeiten Anfang des 14. Jahrhunderts in der östlichen Vierung weite Arkaden eingezogen, um sie in Ost-West-Richtung zu stützen. Ihre Form aus einem oberen Bogen, der mit der Spitze nach unten auf einem unteren gesetzt wurde, war ein Novum und wurde später auch in der Kathedrale von Wells eingebaut. Wegen der Form einer Schere, werden sie Scherenbögen genannt.
Östliche Vierung mit dem Thron des Bischofs aus Holz und Blick in das südöstliche Querschiff.
Blick auf den Hochaltar, umgeben von Grabmälern und die dahinter liegende Dreieinigkeitskapelle, die den geraden, gestuften Chorabschluss bildet.
Blick vom Hochaltar in den Chorraum mit Chorgestühl und Sitz des Bischofs, sowie das Langhaus Richtung Westen.
Südliches Seitenschiff in der Höhe des Chorraumes, kurz vor der östlichen Vierung.
Farbiges Glasfenster mit Engeln und Jesus und seinen Jüngern.
Blick in das nordöstliche Querschiff (Morgenkapelle) und Detail des dortigen farbigen Glasfensters.
Reste des mittelalterlichen Lettners sind in der Morgenkapelle zu sehen.
Grabmal von Thomas Bennett. Er war Sekretär von Kardinal Wolsey. Er fungierte als Stellvertreter des Bischofs, Kardinal Campeggio. Kanoniker und Präzentor dieser Kathedrale 1542-1558. Es ist eines der Momento-Mori-Grabmäler in der Kathedrale.
Teil des Chorgestühls oder Betstuhl aus Holz.
Farbiges Glasfenster und neugotischer Altar, evt. Sankt-Martins-Kapelle.
Prachtvoll geschnitzte Stühle aus Holz. Die Rückenlehnen mit Bildnissen, die Armlehnen teilweise mit geschnitzten Köpfen.
Farbiges Glasfenster, darunter ein leeres gotischen Grabmal mit einem modernen Kerzenleuchter davor.
Grabmal und verschließbare Truhen aus Holz im nördlichen Chorumgang.
Grabmal mit Darstellung von Bischof Robert Bingham (gest. 1246).
Audley-Chapel: Die Kapelle von Bischof Edmund Audley wurde 1524 errichtet. Sie war mit leuchtentenden Farben und zahlreichen Statuen dekoriert. In den 1540ger Jahren wurden die Statuen im Rahmen der englischen Reformation zerstört. Die kleine Kapelle von außen und von innen.
Blick in das spätgotische Gewölbe der Kapelle, ein Fächergewölbe.
Nördlicher Chorabschluss der Dreifaltigkeitskapelle. Daneben der mittlere, etwas weiter nach Osten herausragende Chorabschluss.
Grabmal von Sir Thomas and Lady Gorges. Helena Snachenberg kam 1565 im Alter von 15 Jahren aus Schweden, um Königin Elisabeth I. als Ehrendame zu dienen. Sie heiratete zunächst den Marquess of Northampton und nach seinem Tod Sir Thomas Gorges. Als sie im Alter von 86 Jahren starb, hinterließ sie 98 Nachkommen. Das Grab wurde 1635 errichtet
Informationstafel zum Glasfenster.
Details eines Glasfensters mit der Darstellung der Grundsteinlegung der Kathedrale im Jahr 1220, in Anwesenheit von William and Ela Longespée, Graf und Gräfin von Salisbury, die neben den Priestern stehen. Laut einem Augenzeugen, wird die Szene von einer großen Menschenmenge beobachet. Chefglaser Sam Kelly entwarf und fertigte das Fenster 1989. Trevor Whiffen bemalte es.
Grabmal von John Wordsworth. Bischof von 1885-1911. Gelehrter und Theologe. Historiker der lutherischen Kirche Schwedens und der Vereinigten Staaten. Der Gründer der Bishop-Wordworth-Schule im angrenzenden Wohnviertel der Chorherren.
Farbige Glasfenster im südlichen Chorabschluss der Dreifaltigkeitskapelle.
Informationstafel zum Fenster der politischen Gefangenen
Fenster der politischen Gefangenen: hergestellt von Jacques und Gabriel Loire (1904-1996) im französischen Chartres. Es wurde 1980 durch Yehudi Menuhin 1980 enthüllt. Es besteht aus 5 Lanzettbögen. Als Sydney Evans 1977 zum Dekan der Kathedrale ernannt wurde, wollte er ein Zeichen setzen gegen Gewalt und Ungerechtigkeit in der Welt. Dies sollte mittels eines farbigen Glasfensters gezeigt werden. Im mittleren Lanzettbogen ist Christus am Kreuz dargestellt und rechts und links die Gesichter von Gefangenen.
Altartuch mit aufwändigen Stickereien und der Darstellung der Verkündigung.
Neugotisches Grabmal von Bischof George Moberly (1803-1885), entworfen von Arthur Blomfield. Die 4 Medaillons über seiner liegenden Statue, zeigen ihn als Rektor des Winchester College, wie er an der Universität Oxford predigte, Jungen auf dem Schulschiff HMS Boscawen konfirmierte und der von ihm gegründeten Diözesansynode von Salisbury vorstand.
Hertford Grabmal aus Marmor: enthält das Grab von Edward Seymour, Earl of Hertford und seiner Frau Lady Catherine Grey, die jüngere Schwester von Lady Jane Grey, der Neuntagekönigin von England. Aufgrund ihres Familienstandes wurde seine Frau ungewöhnlicherweise höher platziert als ihr Ehemann.
Grabmal eines Bischofs aus Marmor.
Dieses eiserne Gitter umrahmte die Kapelle von Walter, Lord Hungerford, der 1449 starb. Sie wurde 1778 vom Earl of Rednor restauriert und aus dem Kirchenschiff an diese Stelle versetzt, um als Bank der Familie Radnor zu dienen.
Gotisches Grabmal von Giles de Bridport, Bischof von 1257-1262. Es ist eines der ersten Grabmäler aus dem 13. Jahrundert in Großbritannien. Während seines Episkopats wurde die Kathedrale 1238 durch Bonifatius, Erzbischof von Canterbury, geweiht. Er gründete das College St. Nicolas de Vaux.
Geschnitzte Tür aus Holze, Zugang zur Sakristei, die auf der Südseite der Kathedrale liegt.
Blick in das Kreuzrippengewölbe des südöstlichen Querschiffs. An den Verfärbungen kann man ehemalige Malereien erahnen.
Südliche Seitenwand des Chorraumes mit bemalten Statuen von Heiligen und Bischöfen. Blick in das nördöstliche Querschiff.
Grabmal von Sir Richard Mompesson und seiner Frau Katharine, Sie lebten im 17. Jahrhundert . 1964 wurden die Originalfarben aufgefrischt.
Grabmal von Richard Mitford, Bischof von 1395-1407 und Freund und Sekretär von König Richard II.
Südwestliches Querschiff mit Seitenkapellen.
Epitaph aus dem 16. Jahrhundert
Kreuzgang: Der Kreuzgang wurde 1266 fertiggestellt. Er ist der größte in England. In ihm wurden Prozessionen abgehalten, daher auch die Breite der Gänge von 5,5 Metern. Östlicher Kreuzgang.
Im Hof des Kreuzgangs sind anlässlich der Thronbesteigung Königin Viktorias 1837 zwei Libanon-Zedern gepflanzt worden.
Vom östlichen Kreuzgang führt ein Gang in das oktogonale Kapitelhaus. Es wurde Mitte des 13. Jahrhunderts nach dem Vorbild von Westminster Abbey in London erbaut. Das Domkapitel saß auf steinernen Bänken entlang der Wände.
Gegenüber dem Eingang war der Sitz des Bischofs.
Über den Sitzen ein gemeißelter Fries mit Darstellungen aus den beiden ersten Büchern der Bibel. Die Köpfe an den Bögen sollen angeblich ein Porträt der Personen sein, die damals im Kapitelhaus anwesend waren.
Der Boden des Kapitelsaals war schon immer mit Fliesen ausgelegt. Die ursprünglichen Fliesen wurden im 12. Jahrhundert hergestellt, waren unglasiert und mit Ton in verschiedenen Farben verziert. Dieser Stil dekorativer Fliesen wird als Intarsienfliesen oder Enkaustikfliesen bezeichnet. In den 1850er Jahren waren viele der mittelalterlichen Kacheln zerbrochen oder fehlten, sodass von der Töpferei Minton neue angefertigt wurden, die den Mustern und dem Design des Originals entsprachen. Die Fliesen sind in geometrischen Mustern angeordnet und fügen sich so in die achteckige Form des Raumes ein.
Magna Carta: nur vier Exemplare der Magna Carta von 1215 haben sich erhalten. Zweck der Magna Carta war es, das Verhältnis zwischen König und seinen Lehnsleuten zu regeln und dafür zu sorgen, daß die Krone nur nach anerkannten Rechtsverfahren vorgehen darf. Die Magna Carta überdauerte die anfängliche Aufhebung durch den Papst, Bürgerkrieg und viele Umformulierungen. Die Fassung von 1225, die bis 1297 mehrfach ergänzt und umformuliert wurde, ist noch heute die Grundlage des englischen Rechts. 575 Jahre nach ihrer Unterzeichnung, wurde sie auch in die Bill of Rights der USA aufgenommen.
Königliches Siegel: Im Mittelalter wurde die Echtheit von Dokumenten nicht durch eine Unterschrift, sondern durch ein unten angebrachtes Wachssiegel bestätigt. Das Siegel des Monarchen wird als großes Siegel bezeichnet. Im Jahr 1215 wurde das große Siegel von König John der Magna Carta von Salisbury beigefügt, das jedoch seitdem verloren gegangen ist. Diese beiden Siegel sind Kopien. Auf der einen Seite ist König Johann zu Pferd zu sehen, um sein Können im Kampf zu symbolisieren, auf der anderen Seite sitzt er als Herrscher des Landes auf einem Thron.
Blick zum Eingang des Kapitelsaals.
Blick auf die Südseite der Kathedrale vom Kreuzgang aus.
Moderne Skulptur aus Metall im Garten des Kreuzganges.
Blick von Süden auf die Kathedrale und den Vierungsturm.
Teil der originalen, zentralen Säule des Kapitelhauses, entfernt während der Restaurierung 1856.
Blick vom westlichen Kreuzgang auf den Garten mit den Zedern und das achteckige Kapitelhaus.
Bewachsenes Gerüst für die Restaurierungsarbeiten am nördlichen Kreuzgang.
Restaurant und Café „The Bell Tower“ auf der Nordseite der Kathedrale.
Kathedralbezirk Close: Die Kathedrale steht in einem für englische Kathedralen typischen eigenen Stadtbezirk, dem „Close“. Er ist größtenteils von einer Mauer umgeben und war im Mittelalter der Wohnort des Domkapitels und aller Kleriker der Kathedrale. Drei noch erhaltene Tore führen ins Innere. Er ist der größte seiner Art in Großbritannien. Im Bereich des Bezirks befinden sich verschiedene Baudenkmäler, so das College of Matrons von 1685, in dem Witwen von Geistlichen untergebracht waren
Fassade des College of Matrons mit Flachrelief und farbigem Wappen im Giebel über dem Eingang.
High-Street-Gate: Das zwischen 1327 und 1342 erbaute High-Street-Tor ist der Haupteingangspunkt zum Cathedral Close. Es beherbergte das kleine Gefängnis für diejenigen, die wegen Verbrechen im Liberty of the Close verurteilt wurden. Neben dem Tor steht die Porters Lodge. Der Posten des Pförtners war im Mittelalter eine sehr begehrte Pfründe für die Bediensteten von Königen und Adligen.
Das Tor von innen und von außen.
Fachwerkhaus in der High-Street 52.
Häuser und Läden in der High-Street. Im Hintergrund der Kirchturm der St. Thomas Church.
Historisches Gebäude in der Crane Street 101.
Weitere Häuser und Läden in der High-Street.
Kurz vor der St. Thomas Church. Das Haus mit dem doppelten Giebel davor entstand von 1471 bis 1473. Zur Silver Street hin wird das Gebäude von drei Giebeln dominiert. Die Fassade ist mit Schindeln verkleidet. Das zweite Obergeschoss kragt deutlich über die unteren Geschosse vor.
St. Thomas Church: Die Pfarrkirche von New Sarum (einer der historischen Namen von Salisbury) wurde vermutlich um 1220 gegründet und war ursprünglich wohl zunächst aus Holz gebaut. Thomas Becket oder auch Thomas von Canterbury ist der Namensheilige der Kirche. Warscheinlich wurde die Kirche überwiegend von den Arbeitern und Handwerkern genutzt, die am Bau der Kathedrale beteiligt waren. Im 14. und 15. Jahrhundert erfolgten Erweiterungen. Die heutige Bausubstanz stammt überwiegend aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche aus Stein ist zum Teil verputzt. Der um 1400 errichtete Turm steht südlich direkt vor der Kirche. Im Turm befinden sich Glocken, die sich zuvor im Kirchturm der Kathedrale von Salisbury befanden.
Im Inneren der Kirche befindet sich oberhalb des Chorbogens eine aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammende Wandmalerei. Dargestellt ist das Jüngste Gericht. Es gehört zu den wenigen seiner Art, die im Vereinigten Königreich erhalten geblieben sind. Während der Reformation 1593 wurde es übermalt, 1881 wieder freigelegt und restauriert. 2019 erfolgte eine erneute Restaurierung.
Schaufenster eines Ladens mit geschnitzten Masken aus Holz und Holzscheiben mit geschnitzten Pilzen darauf.
Poultry Cross: beim Marktplatz steht dieses Poultry Cross oder Geflügelkreuz aus dem 14. Jahrhundert. Es war eines von vier Marktkreuzen in Salisbury, die jeweils den Standort von verschiedenen Märkten kennzeichneten. Eine erste urkundliche Erwähnung ist aus dem Jahr 1307 überliefert, wobei die Bezeichnung als Geflügelkreuz erst aus der Zeit etwa 100 Jahre später bekannt ist. Der heutige Baukörper geht auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück. Errichtete Strebepfeiler wurden 1711 jedoch entfernt. Es entstanden stattdessen um die in der Mitte befindliche Basis Steinsitze und eine Sonnenuhr. Der heutige Überbau entstand im mittelalterlichen Stil zwischen 1852 und 1854 durch W. Osmond und geht auf einen Entwurf des Architekten Owen Browne Carter (1806-1859) zurück.
Direkt gegenüber in der Minster Street, weitere Fachwerkbauten.
Historisches Gebäude mit Ziermauerwerk in der New Street 51. Ehemaliger Sitz des Literary and Scientific Institure.
Historische Fachwerkbauten in der New Street.
Aushängeschild und Werbeschild vom Restaurant „Wig and Quill“.
Auf der Fahrt nach Wells ein Haus aus Backsteinen und Feuersteinen in Streifen.
Landstraße Richtung Wells mit den typischen Hecken bis an den Straßenrand und die rechteckig ausgeschnittenen Bäume.
Typische Mauern aus Natursteinen am Rand der Straße, dahinter ältere Häuser mit den typisch englischen Schornsteinen.
Historisches Gebäude der Salvation Army, der Heilsarmee.
Shepton Mallet, kurz vor Wells. Hier steht das historische Gebäude der 1864 gegründeten Anglo-Bavarian Brewery. Sie war die erste Lagerbierbrauerei in Vereinigten Königreich. 1920 geschlossen ist sie heute der Sitz der Anglo Trading Estage.
Landschaft kurz vor Wells mit Feldern und kleinen Orten.
Blick auf den Glastonbury Tor. „Tor“ ist ein keltisches Wort für „konischen Hügel“. Er befindet sich in der Nähe des Ortes Glastonbury. Hier siedelten zeitweise Kelten. Aufgrund seiner strategischen Lage besetzten auch die römer den Hügel. Auf der Spitze steht der restaurierte Turm der Kirche St. Michael’s aus dem 14. Jahrhundert.
-
Wells: Seit römischer Zeit gab es hier eine Siedlung, da es hier viele Quellen gab. Während der angelsächsischen Zeit wurde hier 704 ein Gotteshaus begründet. Wells wurde eine bedeutendere Stadt im Königreich Wessex. 909 wurde Wells Sitz eines neuen Bistums, was aber in der Zukunft durch Verlegung des Bischofssitzes nach Bath zu Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Mönchen nach sich zog. 1245 erhielt der Kirchenbezirk den Namen Bistum Bath und Wells. Im Laufe der Geschichte räumten Bischöfe den Bürgern Befreiung von gewissen Zollabgaben ein oder gaben ihnen das Recht auf eine eigene Justiz. Diese Privilegien wurden von verschiedenen Königen bestätigt. Schließlich erhielt Wells von Königin Elisabeth I. eine Inkorporationsurkunde, welche die Stadt von der bischöflichen Kontrolle befreite. Wells ist mit rund 10.000 Einwohnern nach der City of London die zweitkleinste Kathedralstadt Englands.
Stadtplan: Im Norden der Stadt das große Gelände der Kathedrale mit Kreuzgang und Chapter House. Über die St. Andrews Street führt das Chain Gate mit dem Durchgang zum Vicar’s Close, mit den zwei parallel verlaufenden Häuserzeilen. Südlich und östlich der Kathedrale der Bischofspalast mit seinem großen Garten.
Informationstafel zur Geschichte der Stadt.Historische Häuser in der St. Thomas Street, die zur Kathedrale führt, deren Türme im Hintergrund zu sehen sind.
Giebel eines Hauses mit einer Krone zum diamantenen Thron-Jubiläum von Königin Elisabeth II. 2012.
Türklopfer
Blick in den Innenraum eines Restaurants bzw. Pubs.Kathedrale oder St. Andrews Cathedral:
Die St. Andrew Street führt von Norden auf das Chain Gate zu. Links liegt das achteckige, zweigeschossige Kapitelhaus bzw. Chapter House. Anders als in Salisbury hat es keinen Zugang zum Kreuzgang, der auf der Südseite der Kathedrale liegt. Sein Zugang geht direkt in der östlichen Chor der Kathedrale, den man im Hintergrund sehen kann.
Das Chain Gate wurde 1460 unter Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut, um die Kathedrale mit dem Vicar’s Close zu verbinden. So konnten die Chorherren und Chorsänger das Kapitelhaus betreten, ohne sich schlechtem Wetter auszusetzen oder sich der Öffentlichkeitz zu zeigen. Die untere Ebene besteht aus einem Wagentor, das auf beiden Seiten von Fußgängertoren flankiert wird. Oben eine zinnenbekrönte Brüstung.
Haus mit gotischem Erker, direkt vor dem Chain Gate.
Torhaus mit Durchgang zum Vicar’s Close.
Informationstafel.
Das Vicar’s Close wurde vor über 650 Jahren erbaut, um die professionellen, erwachsenen Sänger des Domchors zu beherbergen. Es ist das vollständigste Beispiel einer mittelalterlichen Straße im Vereinigten Königreich und verkörpert ein international bekanntes musikalisches Erbe. Damals wie heute bildete die Musik einen wichtigen Teil des Gottesdienstes, und vielbeschäftigte Kanoniker ernannten Stellvertreter oder Vikare, die in ihrem Namen Gesangsaufgaben übernahmen. Im Jahr 1348 formte Bischof Ralph von Shrewsbury die Pfarrer zu einem Kollegium, baute einen Saal, in dem sie ihre Geschäfte erledigen und gemeinsam essen konnten, und stellte jedem von ihnen ein Haus zur Verfügung. Ursprünglich gab es 42 kleine Häuser, die ein Viereck bildeten, mit einer Kapelle für die Pfarrer am anderen Ende. Im 15. Jahrhundert wurde das Chain Gate gebaut, um die Pfarrhalle mit der Kathedrale zu verbinden, und gleichzeitig wurden Gärten angelegt. Nach den religiösen Umwälzungen im 16. Jahrhundert wurde die Zahl der Kanoniker und Sänger reduziert und sie durften heiraten, so dass die Häuser zu größeren Wohnhäusern zusammengelegt wurden und Vicars Clos sein heutiges Aussehen erhielt.
Blick in die verschiedenen Gewölbe des Chain Gate.
Treppe zum im 1. Stock liegenden Speisesaal.
Blick in den Hof mit ursprünglich 42 kleinen Häusern. Vor den Häusern kleine Gärten.
Das Chain Gate vom Vicar’s Close aus gesehen, mit dem im Obergeschoss liegenden, über die ganze Breite gehenden Speisesaal.
Blick auf die westliche Reihe aus Häusern mit ihren vorgelagerten Gärten.
Details einiger Häuser.
Wappen als Relief am Schornstein.Bank aus Holz, Tisch und Blumen in einem Garten.
Die östliche Seite von Vicar’s Close.
Torbogen aus Stein vor einem der Häuser.
An Ende von Vicar’s Close die kleine gotische Kapelle.
Eingang zur Kapelle. Die Tür aus Holz zeigt mehrere geschnitzte Wappen.
Das Haus neben der Kapelle mit Wappen als Flachreliefs an der Fassade.
Blick zurück Richtung Kathedrale und dem Chain Gate.Braunstieliger Streifenfarn (Asplenium trichomanes) im Mauerwerk und eine grüne Stinkwanze auf einem der Streifenfarne.
Wells Cathedral Music School auf der Nordseite der Kathedrale, gleich neben dem Chain Gate und Vicar’s Close.
Fassade des Dombüros, der Cathedral Offices am Cathedral Green 7 A.
Am Ende des Cathedral Green eines der Tore zur Stadt. Über den Dächern der Turm der St. Cuthbert’s Kirche.Kathedrale oder St. Andrews Cathedral:
Die in den Jahren 1182-1260 erbaute Kathedrale, ist die Bischofskirche der Diözese Bath und Wells. Die Kathedrale verleiht Wells das Stadtrecht, da sich in England jede Siedlung, die eine Kathedrale besitzt, automatisch Stadt nennen darf.
Gotische Baukunst begann mit dem Chorabschluss im Osten der Kathedrale von Canterbury (1175). Die spezifische englische Gotik setzt allerdings erst mit dem Neubau der Kathedrale von Wells 1180 ein, gefolgt von der in Lincoln 1192. Die Kathedrale von Wells wird erstmals vollständig mit Spitzbögen konstruiert und gilt als Hauptwerk der englischen Frühgotik. Es gab zwar einen romanischen Vorgängerbau, dessen Standort aber unbekannt ist.
Begonnen wurde beim Bau mit den drei Westjochen des dreischiffigen Chores, dann dem dreischiffigen Querhaus, der Vierung und dem östlichsten Joch des Langhauses. Unter Bischof Jocelin of Wells (-1242) wurde das Langhaus vollendet . Den Rang einer „Kathedrale“ erhielt Wells erst 1245. Der erste namentlich bekannte Architekt in Wells war Adam Lock (-1229). Sein Nachfolger wurde Thomas Norrey.
Grundriss: oben ist Osten mit dem Chor (Nr. 6) und dem Chapel House (Nr. 4). Querschiff (Nr. 3), unten Westen mit der Fassade (Nr. 1) und rechts davon der Kreuzgang.
Nordseite der Kathedrale.
Uhr: In Wells wurde, wie auch in anderen Kathedralen, eine Uhr installiert, deren erste Erwähnung aus dem Jahr 1392 stammt. Im Gegensatz zu den anderen Uhren ist sie jedoch immer noch vorhanden. Alles, was man heute sehen kann, sei es innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, ist mittelalterlich. An der Außenwand des nördlichen Querschiffs, befinden sich ein Zifferblatt und zwei Ritter, die mit dem gleichen Mechanismus wie das Zifferblatt und die Figuren im Inneren funktionieren. Die Ritter schlagen mit ihren Hellebardenalle Viertelstünden auf zwei Glocken. In den Ecken des Zifferblattes sind die Evangelistensymbole angebracht.
Blick von Nordosten auf den nördlichen Turm der Westfassade.
Blick auf die Nordseite der Kathedrale mit dem nördlichen Portal.
Detail des Giebels vom Nordportal mit einigen wenigen Flachreliefs.
Blick auf die Vierung mit dem Turm und dem nörlichen Querschiff.
Vierungsturm. Ursprünglich war für die Kathedrale von Wells kein Vierungsturm vorgesehen. Dieser wurde erst zwischen 1315 und 1322 unter Bischof John Drokensford vom Baumeister Thomas of Witney (1292-1342) errichtet. Nach dem Vorbild von Salisbury hatte er ursprünglich einen hohen Helm, der jedoch 1439 einem Brand zum Opfer fiel und nicht erneuert wurde. Bald musste man feststellen, dass die Masse des Turms zu einer Senkung des Bodens führte, und daher stabilisierende Maßnahmen notwendig wurden. Dies führte um 1338 zur Konstruktion der berühmten, innen liegenden Scherenbögen.
Der nördliche Turm der Westfassade, gesehen von Norden. Der Turm im Norden wurde unter Bischof Stafford erst 1407-1427 erbaut, also später als der südliche Turm, aber ebenfalls nach Plänen von William of Wynford (-1407).
Westfassade: Links im Hintergrund das Chain Gate, recht der Kreuzgang.
Die Westfassade aus grauem Sandstein wurde als letzter Teil des frühgotischen Neubaus zwischen 1220 und 1240 in ihren unteren Teilen errichtet. Sie ist 49 m breit und betont, ähnlich die die Kathedrale in Salisbury, die Waagerechte. Sie hat zwei niedrige, wie abgeschnitten wirkende Türme und sehr kleine Portale in einem sehr hohen Gebäudesockel. Die Strebepfeiler zeigen in zwei übereinander liegenden Geschossen mit Nischen zahlreiche Plastiken. Dieses Hauptgeschoss wirkt wie ein Altarretabel und präsentiert, wie auch in Salisbury, die englische Vorliebe für solche mit Plastiken geschmückte Fassaden. Hier werden insgesamt 176 Figuren gezeigt. Im Original erhalten sind 127 Plastiken, allerdings fehlen die Bemalungen und die Vergoldungen. In der Literatur wird teilweise auch von 400 Plastiken gesprochen, je nachdem ab welcher Größe man sie mitgezählt hat. Aus der Zeit des Bildersturms in der Reformationszeit, sind noch Spuren von Kugeln erhalten. Insgesamt wurde an der Vollendung der Fassade mit ihrem Skulpturenprogramm bis weit in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein gearbeitet. Danach entschloss sich das Kapitel, es den Vorbildern von Westminster in London, Salisbury und Lincoln gleichzutun und ein Kapitelhaus zu errichten. Anders als auf dem Festland, stehen die Türme seitlich neben dem Langhaus und nicht vor den Seitenschiffen. Man vermutet, daß sie unvollendet blieben und man sich im Laufe der Bau8arbeiten für den Vierungsturm entschlossen hat.
Bereich über dem kleinen Hauptportal.
Ganz oben im stufenförmigen Giebel über dem Hauptportal, zwischen 3 Seraphimen (Engel mit 6 Flügeln), der thronende Christus über stark beschädigten Plastiken der 12 Apostel.
Der untere Bereich des Turms im Norden, 1407-1427 erbaut. Weitere Details bis zur Spitze des Turmes.
Der untere Bereich des Turms im Süden. Weitere Details bis zur Spitze des Turms. Das Obergeschoss des Südturms wurde zwischen 1367 und 1386 unter Leitung des Architekten William of Wynford (-1405) gebaut. Dieser war einer der führenden Architekten seiner Zeit und hat auch in Windsor, an der Kathedrale in Winchester und am New College in Oxford mitgewirkt.
Die Kathedrale von Südwesten. Im Süden schließt sich der Kreuzgang an.
In der Nähe des südlichen Endes des Kreuzganges ein Turm mit Durchgang in die Stadt.
Kreuzgang: Man betritt heute die Kathedrale durch den Kreuzgang. Errichtet in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der Hof ist 55 x 38 m groß. Die Flügel des Kreuzganges sind sehr einheitlich gestaltet, sowohl an den Gewölben, als auch an den Arkaden.
Westlicher Flügel des Kreuzganges und Detail des Gewölbes.
Südlicher Flügel des Kreuzganges mit einer Kunstausstellung.
Detail des Gewölbes.
Blick über den Hof des Kreuzganges, mit einigen Gräbern, auf die Vierung mit Vierungsturm.
Östlicher Flügel des Kreuzganges. Am Ende die Tür zur Bibliothek.
Detail der Kapitelle neben der Tür.Der Hof des Kreuzganges mit Gräbern. Blick auf das Langhaus, das südliche Querschiff und die Vierung mit ihrem Turm.
Blick über die Gräber zu einem alten Baum in der Mitte des Hofes und zwei Flügel des Kreuzganges.
Der östliche Flügel des Kreuzganges mit der darüber liegenden Bibliothek und einige Grabsteine von hinten.
Blick vom Hof auf den südlichen Turm der Kathedrale. Hier sieht man gut, daß die Türme neben dem Langhaus stehen.
Detail des Turmes von Südosten. Hier haben sich keine Plastiken erhalten.Blick auf den Vierungsturm.
Einige eingezäunte Gräber vor dem östlichen Arm des Kreuzganges.
Bibliothek der Kathedrale bzw. Klosterbibliothek. Blick in die Bibliothek, die über dem östlichen Flügel des Kreuzganges liegt. Sie wurde kurz nach 1424 erbaut. Bevor es die Bibliothek gab, bewahrten die Kanoniker ihre Bücher in einem Lager im nörlichen Querschiff auf. Ab 1400 wurden die Bücher in der Schatzkammer bzw. in der Krypta unter dem Kapitelsaal aufbewahrt.
Informationsblätter zu der Bibliothek.
Hinter einem Gitter aus Metall, befindet sich der ältere Teil der Bibliothek. Zahlreiche Bücher sind mit Ketten am Regal befestigt.
Historische Drucke:
Brain Walton: Biblia Sacra Polyglotta, 1657. Titelblatt und eine weitere Seite. Brian Walton war ein Bischof aus Chester. Es ist die polyglotte Bibel mit den meisten Sprachen (insgesamt 9). Sie enthält neben Hebräisch, Griechisch, Latein, die Sprache der Chaldäer, Syrisch, Persisch und Äthiopisch.
Informationsblatt zu dem Druck.
Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Therrarum, 1616. Der erste moderne Atlas der Welt. Es wurde ursprünglich im Jahr 1570 veröffentlicht und enthielt 53 Kartenblätter. Es wird oft als das erste Buch bezeichnet, das mit Kupferstichen hergestellt wurde. Bei unserem Exemplar handelt es sich um die englische Übersetzung von 1606, die auf der größeren lateinischen Ausgabe von 1603 basiert, die 161 Karten enthielt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es das höchste jemals in Großbritannien produzierte Buch. Sein Verfasser Abraham Oetel (1527-1598), bekannt als Ortelius, wurde in Antwerpen als Sohn einer flämischen Unternehmerfamilie geboren. Aus geschäftlichen Gründen reiste er ziemlich viel durch Europa. Es war das Reisen mit Mercator, das ihn dazu veranlasste, wissenschaftlicher Geograph zu werden und sich mit der Arbeit an einem Atlas zu befassen. 1575 wurde er zum Königlichen Kosmographen Philipps II. ernannt. von Spanien.
Bildnis des Autoren auf der Rückseite des Titelblatts.
Weltkarte
Westlicher Flügel des Kreuzganges mit der Tür zur Kirche.
Inneres der Kathedrale:
Vom Kreuzgang kommt man durch einen schmalen Gang und betritt die Kathedrale direkt hinter der Westfassade.
Gewölbe über dem schmalen Gang.
Blick von Westen durch das südliche Seitenschiff.
Blick in das 113 m lange Langhaus. Die spitzbogigen Arkaden stehen auf reich gegliederten Pfeilern, mit 24 vorgelagerten Diensten, die die Pfeiler recht massiv erscheinen lässt. Darüber das Triforium und ganz oben der Lichtgaden oder Obergaden mit einem Laufgang. Dadurch dass die Gewölbedienste erst oberhalb der Bögen des Triforiums ansetzen, gibt es eine recht starke Horizontalwirkung. Im Hintergrund die berühmten Scherenbögen in der westlichen Vierung.
Blick in das Kreuzrippengewölbe.
Details von skulptierten Köpfen und Kapitellen mit Tieren und Blättern im Langhaus.
Vor der westlichen Vierung steht ein Altar. Hinter den Scherenbögen in der westlichen Vierung die Orgel. Der Druck des nachträglich erbauten Turmes über der westlichen Vierung, machte stabilisierende Maßnahmen notwendig.
Dies führte um 1338 zur Konstruktion der berühmten Scherenbögen, die allgemein dem Baumeister William Joy (1310-1348), der seit 1329 in Wells tätig war, zugeschrieben werden. Da die Quellenlage nicht eindeutig ist, gibt es auch Informationen, die den Bau der Scherenbögen für die Jahre 1354-1356 datieren, was Joy als Architekten ausschließen würde. Diese Scherenbögen sind einzigartig in der Geschichte der Architektur.
Im oberen Bogen ist ein Kruzifix mit Maria und Johannes angebracht.
Blick durch das Langhaus Richtung Westen. Kurz vor der Vierung sind links und rechts kleine Kapellen eingebaut. Hier wurden Messen für die Toten gelesen, die als wohlhabende Gläubiger den Bau der Kapellen finanziert hatten.
Kleine Kapelle für Bischof Nicholas Bubwith, auf der Nordseite kurz vor der Vierung.
Informationstafel und in dler kapelle eine bemalte Statue der Madonna mit Kind aus Holz.
Informationstafel zu der Kapelle auf der Südseite kurz vor der Vierung. Der auf der Informationstafel erwähnte St. Edmund Rich ist der Erzbischof von Canterbury – Edmundus Abingdonensis (ca. 1180-1240).
Kapelle für Hugh Sugar. Er war ein wohlhabender und mächtiger Diener der Kirche, sowohl Schatzmeister von Wells als auch Generalvikar mehrerer Bischöfe, der mit dem Vertreter des Bischofs und mit seiner Autorität handelte. Er starb 1498 und die Kapelle entstand kurz danach. Bereits 1547 wurden durch einen Parlamentsbeschluss unter dem protestantischen Regime von König Edward VI. diese Kapellen abgeschafft.
Die Kapelle aus Sandstein wurde im spätgotischen Flamboyant-Stil erbaut. Oben halten Engel Wappenschilde.
Die Kapelle steht zwischen zwei Säulen des Langhauses und grenzt damit direkt an die Kapitelle der Säulen.
Die Decke der Kapelle bildet ein Fächergewölbe.
Blick in das Gewölbe der westlichen Vierung.
Über dem Eingang zur Chor in der Vierung, steht seit etwas 1335 eine Orgel. Laut Kirchenführer wurde die Orgel 1857 von Henry Willis erbaut und seitdem umgebaut und erweitert, zuletzt 1973/74. Nach anderen Informationen stammt die Orgel aus den Jahren 1909/1910 von den Orgelbauern Harrison & Harrison. Das Orgelgehäuse stammt aus dem Jahr 1974.
Unter der Orgel befindet sich eine Wand aus Sandstein mit gotischen Bögen, in denen sich der Durchgang in den Chor befindet.
Südliches Querschiff mit einigen Grabmälern und dem Taufbecken
Informationstafel zum Taufbecken. Die Trommel des Taufbeckens stammt aus der späten angelsächsischen Zeit und befand sich ursprünglich in der angelsächsischen Kathedrale, die vor dem heutigen Gebäude errichtet wurde. Es wurde im Laufe der Jahre stark verändert und verfügte über Figuren und andere dekorative Elemente, die heute nicht mehr existieren. Als das Taufbecken in das heutige Gebäude eingefügt wurde, hat man die glatten Bögen rundherum so geändert, dass sie nun jeweils spitz zulaufen. Man wollte, daß das Taufbecken an seinem neuen Standort zu der Umgebung mit ebenfalls spitz zulaufenden Bögen passte. Der Deckel stammt aus der Zeit um 1635.
Reste eines gotischen Grabmals.
Daneben das gotische Grabmal von William March oder William de Marchia (-1302), Bischof von Bath und Wells, aus dem Jahr 1302.
St. Martin Kapelle im südlichen Querschiff. Sie dient als Denkmal für die Männer von Somerset, die im 1. Weltkrieg gefallen sind. Farbiger neugotischer Altar und Ausstellungsvitrinen mit Listen der Gefallenen und Kränzen aus remembrance poppies, den roten Mohnblüten.
Gotisches Grabmal von William Byconyll (-1448).
Nördliches Querschiff von der Vierung aus gesehen.
Detail des nörlichen Scherenbogens und des Unterbaus der Orgel in der Vierung.
Informationstafel zur astronomischen Uhr.
Astronomische Uhr: Im nördlichen Querschiff befindet sich seit dem späten 14. Jahrhundert das Innere der bedeutenden astronomischen Uhr, die wir bereits auf der Außenseite der Kathedrale gesehen haben. Das originale Uhrwerk ist zwischen 1386 und 1392 entstanden. Angefertigt wurde die Uhr warscheinlich von den Holländern Johannes und Williemus Vrieman sowie von Johannes Lietuy aus Delft. Nach anderen Quellen stammt sie aus der Zeit um 1325 und wurde vermutlich von Peter Lightfoot, einem Mönch aus Glastonbury angefertigt. Der Auftrag für eine Uhr, ursprünglich für die Kathedrale in Salisbury, stammte von König Edward III. (1312-1377) und dem Bischof von Salisbury. Das originale Uhrwerk wurde schließlich 1871 dem Science Museum in London übergeben, wo es bis heute funktioniert.
Das Ziffernblatt zeigt im äußere Kreis ist eine 24-Stunden-Uhr mit 12 Uhr Mittag oben und 12 Uhr Mitternacht unten. Der zweite Kreis markiert die Minuten jeder Stunde mit einem kleinen goldenen Stern und das dritte innere Zifferblatt markiert die Tage des Monats. Wenn die Uhr jede Viertelstunde schlägt, bekämpfen sich Ritter auf Pferden oberhalb der Uhr. Es ist die zweitälteste erhaltene Uhr der Welt und die älteste in England.
Rechts oberhalb der Uhr sitzt Jack Blandifers. Er ist der Quarter Jack, der alle Viertelstunde zwei Glocken mit Hämmern und zwei mit seinen Absätzen schlägt.
Grabmäler in nördlichen Querschiff:
Grabmal von Bischof Cornish von 1513 mit Flachreliefs von Wappen.
Grabmal aus Alabaster von Bischof John Still (ca. 1543–1607/08). Bischof von Bath und Wells, sowie Rektor von zwei Colleges in Cambridge. Es wurde im 19. Jahrhundert neu bemalt.
Gramal von Bischof Richard Kidder (ca. 1633-1703). Er starb im Bischofspalast in Wells beim Großen Sturm 1703, als der Schornstein auf sein Bett fiel. Die weibliche Plastik auf seinem Grabmal ist seine Tochter.
Detail einer Konsole mit der Darstellung einer Eidechse.
Informationstafel zum Chor und dem Glasfenster mit der Wurzel Jesse
Glasfenster mit der Wurzel Jesse. Es ist eines der wertvollsten Beispiele für Glas aus dem 14. Jahrhundert in Europa. Jesse gilt als Vorfahre Jesu. In einer Prophezeiung wird ein Spross, der von der Seite Jesse kommt gesprochen, der sich zum Messias entwickeln wird, dem Auserwählten Gottes, den die Kirche als Jesus identifiziert. Jesse schläft unten am mittleren Fenster. Ein weißer Trieb kommt von seiner Seite und schlängelt sich um den Rest des Fensters herum, wobei er durch verschiedene andere Figuren hindurchgeht, die angeblich Vorfahren Jesu sind. Über Jesse sieht man Maria mit Jesus als Kleinkind, darüber Jesus auf einem grünen Kreuz.
Chor: Der Chor ist das Herz der Kathedrale. Alle Gottesdienste im Mittelalter wurden hier abgehalten, dem Ritus folgend 8 Gottesdienste pro Tag. Auch heute noch wird an den meisten Tagen im Chor ein abendlicher Gottesdienst abgehalten mit Chorgesang und Orgelmusik. Der Chor hat sechs Joche und ein eigenes Querschiff. Dadurch ist der gesamte Chor ungefähr so groß wie das Langhaus mit dem westlichen Querschiff. Die Existenz von zwei Querschiffen ist ein Kennzeichen englischer Kirchenbauten. Der Chor wurde als erstes errichtet, und wurde wahrscheinlich vor 1200 bereits genutzt. Zwischen 1320 und 1340 wurde er dann nach Osten erweitert, um sich der bestehenden Marienkapelle anzuschließen. Der unterschiedliche Baustil der drei östlichen Joche jenseits von Kanzel und Bischofsthron markiert diese Erweiterung deutlich.
Blick über das Chorgestühl Richtung Osten.
Gewölbe des Chors.
Die östliche Wand mit farbigen Glasfenstern und Statuen in Nischen, als Abschluss des Chores vor dem östlichen Querschiff und dem Retroquire oder Hinterchor, dem Raum hinter dem Hochaltar.
Blick über das Chorgestühl zum Hauptaltar und dem dahinter liegenden Hinterchor und der Marienkapelle. Die steinernen Überdachungen des Chorgestühls wurden erst 1848 hinzugefügt, nachdem die im 16. Jahrhundert errichteten Holzgalerien für die Familien des Klerus abgerissen worden waren.
Blick durch den Chor zurück zur Orgel und dem Chorgestühl. Auch hier wieder die steinernen, später hinzugefügten steinernen Überdachungen. Links der Thron des Bischofs, rechts die Kanzel.
Der Thron des Bischofs, an der Rückwand mit Stickereien verziert. Engel halten Wappenschilde und der heilige Andreas mit seinem Kreuz.
Blick auf das Chorgestühl und die farbenprächtigen Stickereien, die Mitte des 20. Jahrhunderts von der Handarbeiterzunft angefertigt wurden.
An einer Wand einige erhaltene Miserikordien oder Misericordien. Es sind kleine Stützbretter im Chorgestühl. Hier konnten sich die Geistlichen bei langen Gottesdiensten abstützen, wenn sie langen stehen mussten. Insgesamt haben sich in Wells 65 solcher Schnitzereien erhalten. Sie gehören zu den schönsten in England. Jedes wurde aus einem einzigen Stück Eiche geschnitzt und besteht aus einem Menschen, einem Tier oder einer fantastischen Figur, die zwischen zwei Blättern aus Blättern dargestellt ist.
Blick in das südliche Seitenschiff des Chores. Die Seitenschiffe des Chores führen als Prozessionswege zum Hinterchor und der Marienkapelle. Aus der alten Kathedrale wurden auch die Gebeine von sieben sächsischen Bischöfen mitgebracht, deren Gräber aus der Zeit um 1200 stammen und die Nord- und Südchorschiffe säumen.
Informationstafel. Die Bildnisse über den Gräbern wurden um 1210 angefertigt, als der heutige Chor in Betrieb genommen wurde. Die Gebeine der Bischöfe wurden aus der alten Kathedrale ausgegraben und hierher umgebettet.
Grabmal für den Bischof von Bath und Wells John Harewell (- 1386).
Weiteres Grabmal eines Bischofs.
Grabmal von Bischof Lord Arthur Hervey von 1894. Seine Füße liegen auf einem Schneeleoparden, sein Wappentier.
Grabmal Thomas Beckington (ca. 1390-1465), Bischof von Bath und Wells und königlicher Sekretär unter Heinrich VI. Das Grabmal zeigt ihn oben als Statue
aus Alabaster, in seiner Kleidung als Bischof, farbig bemalt. Die untere Plastik zeigt ihn als verwesenden Leichnam, der die Vergänglichkeit symbolisieren soll, bekannt als Memento mori.
Blick in das südöstliche Querschiff mit der St. Katharinen-Kapelle: vorne das farbige Grabmal von John Drokensford oder Droxford, Bischof von Bath und Wells 1309-1329 und Schatzmeister von England.
Farbiges Glasfenster
Neugotischer Altar, daneben eine gotische Wandnische.
Blick vom südlichen Seitenschiff des Chores in den Hinterchor und die Marienkapelle. Der Retroquire wurde später im 14. Jahrhundert erbaut, um die Marienkapelle mit dem Quire zu verbinden, und sein Wald aus Säulen verbindet die Schiffe des Chores mit den Seitenkapellen, das östliche kleine Querschiff und die Marienkapelle am östlichen Ende.
Neugotischer Altar und farbiges Glasfenster am Ende des südlichen Seitenschiffs des Chores.
Blick vom Hinterchor oder Retroquire zurück in den Chor. In der Mitte ein Lesepult oder Ambo aus Metall.
Marienkapelle oder Lady Chapel:
Die ursprüngliche Marienkapelle grenzte an den Kreuzgang. Sie wurden während der Reformation zerstört, aber seine Überreste sind noch immer im Camery Garden zu sehen. Die Verehrung der Jungfrau Maria nahm im 13. und 14. Jahrhundert zu. Aus diesem Grund wurde 1326 im Osten der Kathedrale eine neue achtseitige Kapelle fertiggestellt, die vom Hauptteil der Kathedrale getrennt war. Die Marienkapelle wurde wahrscheinlich von Thomas Witney (1292-1342) in den Jahren 1310–1319 entworfen und errichtet. Obwohl separat, war die neue Kapelle genau auf den Chor ausgerichtet, und kurz nach ihrer Fertigstellung wurde der Chor nach Osten erweitert und der Retroquire gebaut, um die beiden zu verbinden. Die moderne Statue von Maria mit dem Jesuskind stammt von Arthur George Walker (1861-1939).
Die Glasfenster in der Marienkapelle enthalten noch teilweise die Originale von 1320–1326. Der große Rest der Glasfenster ist ein Mosaik aus Fragmenten, die gerettet wurden, als die Fenster während des Bürgerkriegs (1642–1647) und der Monmouth-Rebellion (1685) zerstört wurden.
Details der Glasfenster.
Details der mit Fliesen belegten Fußböden.
Blick in das östliche Ende des nördlichen Seitenschiffs des Chors. Es wird durch ein kunstvoll geschmiedetes Gitter von 1450 abgeteilt.
Detail des schmiedeeisernen Gitters. Es zeigt die Verkündigung und die Anbetung der heiligen drei Könige.
Altar und farbiges Glasfenster am östlichen Ende des nördlichen Seitenschiffs des Chors.
Grabmal von Ralph of Shrewsbury (-1363), Bischof von Bath und Wells und 1328-1329 Kanzler der Universität Oxford.
Corpus Christi Kapelle im nordöstlichen Querschiff: die Kapelle ist abgeteilt durch Bögen aus Holz. Gleich dahinter das gotische Grabmal von Dekan Godelee von 1333.
Detail der geschnitzen Bögen aus Holz.
Farbiges Glasfenster mit Heiligen und Wappen aus dem 19. Jahrhundert.
In der Ecke rechts das Grabmal von Bischof Creyghton aus Alabaster aus dem Jahr 1672. Links daneben das gotische Grabmal von John Milton von 1337.
An der Wand ein bemaltes Flachrelief mit der Himmelfahrt.
Seitenbank aus Stein mit bestickten Kissen.
Davor noch mittelalterliche, gemusterte Fliesen auf dem Boden.
Von kleinen Säulen mit Kapitellen flankierte Tür mit gotischem Bogen darüber.
Geklöppelte Spitze für einen Altar mit floralen Motiven und Heiligen in einer Ausstellungsvitrine.
Decke über einem Grabmal mit aufwändigem, farbigen Gewölbe.
Konsole mit der Darstellung eines Mönchs im Kampf mit einer Echse.
Steile Treppe, die zum Chapter House oder Kapitelsaal führt. Eine schmale Tür vom nördlichen Querschiff führt zu den breiten, geschwungenen Stufen in den ersten Stock.
Der zusätzliche Flur weiter oben, führt zum Chain Gate mit der Brücke hinüber zum Vicar’s Close und wurde im 15. Jahrhundert hinzugefügt.
Informationstafeln.
Blick von außen durch ein gotisches Fenster in den Kapitelsaal. Der Bau des Kapitelsaals, der 1306 fertiggestellt wurde, war das Ergebnis der Wiederherstellung von Wells in den Status einer Kathedrale. Hier wurden vom Kapitel die Geschäfte und Entscheidungen des Klosters besprochen.
Der Kapitelsaal ist als erstes Stockwerk auf einem Untergeschoss errichtet. Der Unterbau diente als „Tresorraum“ der Kathedrale und wurde lange vor Beginn des Kapitelsaals darüber fertiggestellt.
Der Kapitelsaal ist achteckig und das gewölbte Dach hat 32 Rippen, die von einer zentralen Säule getragen werden, sodass es einem aus dem Boden aufsteigenden Fontäne ähnelt. Die riesigen Fenster verloren den größten Teil ihrer ursprünglichen Verglasung mit Szenen aus der Bibel, als sie 1634 wahrscheinlich von Cromwell’s Soldaten zerschlagen wurden.
An den Wänden entlang die Sitzbänke der Kanoniker. Dem Eingang gegenüber der Sitz des Bischofs mit dem Wappen von König Jakob I. darüber.
Über den Sitzen jeweils Messingschilder mit einem Namen oder einer Funktion. Die Plastiken von Köpfen zwischen dem gotischen Bögen reichem vom König bis zum Bauern und sind alle individuell gestaltet.
Blick zurück in den kleinen Vorraum des Kapitelsaals.
Wieder zurück in der Kathedrale geht man im nördlichen Seitenschiff mit seinen Kapitellen und lebhaften kleinen Plastiken zurück zum Eingang.
Tür des Bischofs: Im Kreuzgang ein gotischer Spitzbogen mit einer Tür in den Garten und zum Übergang über den Burggraben, direkt zum Bischofspalast. Über der Tür eine Plastik des heiligen Andreas.
Von hier gelangt man auch auf den ehemaligen Friedhof, direkt neben dem Kreuzgang im Süden der Kathedrale. Informationstafel mit den hier aufgefundenen Grundmauern der Vorgängerbauten der Kathedrale. Links ganz dünn gezeichnet, die Südwand der heutigen Kathedrale. Rot im Süden liegend, mit der gleichen West-Ost-Ausrichtung, die spätmittelalterliche Kirche. Leicht schräg die frühmittelalterliche Kirche in schwarz und in grün Grundmauern der sächsichen Kirche.
Südseite der Kathedrale.
Fassade des südlichen Querschiffs.
Blick auf den Chor und das östliche kleine Querschiff. Im Garten eine Statue aus Metall von Jesus, der zur Kathedrale schaut.
Die Südseite des Hinterchors und der Marienkapelle.
Blick zum Vierungsturm und dem vor dem Chor liegenden alten Friedhof. In Hintergrund der östliche Flügel des Kreuzgangs mit der Tür des Bischofs.
Informationstafel zum St. Andrews-Brunnen. Diese Quelle entspringt in den Gärten des Bischofspalastes und stammt von unterirdischen Bächen aus den Mendip Hills.
Seit der Jungsteinzeit zog dieser nie versiegende Vorrat an Süßwasser Siedler an, und um 700 gründete König Ina von Wessex (- 726) eine Münsterkirche direkt südlich der heutigen Kathedrale. Sie war dem heiligen Andreas gewidmet, dem ersten Jünger von Jesus.
Üppige Vegetation rund um die Quelle.
Marktplatz von Wells mit Marktständen mit lokalen Produkten.
Hinter den Marktständen die Türme der Kathedrale und die Tore zum Geländer der Kathedrale und zum Bischofspalast.
Schaufenster eines Ladens mit thailändischem Kunstgewerbe, Statuen von Buddha, große blau-weiße Vasen.
Mittelalterlicher Brunnen aus Sandstein auf dem Marktplatz.
Blick auf die Südseite des Marktplatzes mit dem Rathaus, Touristeninformation und dem historischen Gebäude eines Restaurants.
Auf der Ostseite des Marktes, der Kathedrale und dem Bischofspalast zugewandt, 2 mittelalterliche Tore. Links Penniless Porch, rechts Bishop’s Eye.
Penniless Porch: Gotisches Tor zur Liberty of St. Andrew, dem Gelände der Kathedrale. Es wurde 1450 von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut. Das dreistöckige Gebäude wurde aus Doulting-Quadersteinen errichtet. Oben am Dach Zinnen. An der Fassade Flachreliefs. Tiere halten ein Wappen, darüber ein Engel, kleine Fenster mit Maßwerk.
Bishop’s Eye: es wurde ebenfalls von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) erbaut und ist das Eingangstor zum Bischofspalast und seinem Garten. Auch dieses Tor ist dreistöckig und aus Doulting-Quadersteinen errichtet. Die Tore aus Holz wurden im 18. Jahrhundert hinzugefügt. An der Vorderseite des Gebäudes, die zum Marktplatz zeigt, befinden sich mehrere stark beschädigte Statuen in Nischen und Wappen als Flachrelief.
Fischplatte aus dem Restaurant „Bishop’s Eye“.
Bischofspalast:
Landkarte des Bischofspalastes und seines Gartens. Ganz unten des Tor „Bishop’s Eye“. Um den Palast führt ein Burggraben. Eine Brücke führt zu einem weiteren Torhaus. Dem Palast ist ein Krocket-Rasen vorgelagert. Rechts davon eine Kapelle und daran anschließend die Ruinen der großen Halle, die um 1380 teilweise abgerissen wurde. Der Bischofspalast ist seit dem 13. Jahrhundert die Residenz der Bischöfe von Bath und Wells. Der Bau des Palastes wurde um 1210 von den Bischöfen Joceclin von Wells (-1242) und Reginald Fitz Jocelin (-1191) begonnen. Die Hauptarbeiten fielen aber in die Jahre um 1230.
Die Kapelle und die große Halle wurden zwischen 1275 und 1292 von Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) hinzugefügt. Der Burggraben, die 5 m hohe, mit Zinnen bekrönte Umfassungsmauern und das Torhaus wurde erst im 14. Jahrhundert von Bischof Ralph von Shrewsbury (-1363) hinzugefügt. Er hatte ein gespanntes Verhältnis zu den Bürgern von Wells, wegen der von ihm erhobenen Steuern. Der Nordflügel, heute das Bischofshaus wurde im 15. Jahrhundert von Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465) hinzugefügt und im 18. Jahrhundert und 1810 umgebaut von Bischof Richard Beadon (1737-1824). Ursprünglich war der Palast von einem Wildpark umgeben. Im 14. Jahrhundert wurden dann Bäche umgeleitet um den Burggraben zu füllen. In den 1820er Jahren wurden die Anlagen innerhalb der Mauern von Bischof George Henry Law (1761-1845) bepflanzt und als Park und Ziergarten angelegt
Bishop’s Eye vom Gelände des Bischofspalastes aus gesehen.
Detail eines Turms mit Zinnen und ein Wasserspeier.
Blick auf das dreistöckige Torhaus aus dem Jahr 1341 mit seiner Brücke über den Graben. Der Eingang war durch ein Tor, ein Fallgitter und eine Zugbrücke gesichert. Bis 1831 war die Zugbrücke noch in Betrieb.
Rechts vom Torhaus, ein runder Turm in der zinnenbekrönten Mauer. Blick von der Ecke Richtung Kathedrale.
Höckschwan mit Jungtieren. Die Höckerschwäne auf dem Burggraben wurden in früherer Zeit von der Tochter eines Bischofs darauf trainiert, Glocken zu läuten, indem sie an Fäden ziehen, um um Futter zu betteln. Bereits in den 1870er Jahren gab es diese Sitte.
Blick entlang der westlichen und südlichen Umfassungsmauer.
Torhaus als Hintergrund für Hochzeitsfotos.
Gleich links hinter dem Torhaus der Blick auf die Kathedrale und den vor dem Palast liegenden Krocket-Rasen.
Blick auf den Palast: links der Nordflügel (heute Bischofshaus), dann der Bischofspalast mit Eingangshalle und rechts die Kapelle.
Informationstafel
Rechts von der Kapelle steht die Ruine der gotischen „Großen Halle“. Sie ist heute eines der Kernstücke des Gartens. Sie wurde von Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) als riesiger, prunkvoller Bankettsaal beauftragt. Er hatte die Hoffnung, Hier König Edward I. hier zu empfangen und zu bewirten. Burnell war Edwards Lieblingsfreund und auch sein Kanzler. An dieser Wand befand sich ein prächtiger Eingang für die Zeremonie der Ankunft des Königs. Über dem Durchgang kann man im Mauerwerk noch die Reste der zweistöckigen Veranda erkennen.
Bischof George Henry Law ließ sie Südmauer der verfallenen Halle abreißen und es wurde eine Rasenfläche mit zahlreichen Bäumen und Büschen angelegt. Auf dem Rasen steht die Plastik „The Pilgrim“, der Pilger, von David Backhouse, einem Künstler aus Somerset.
Ein Weg führt entlang der Umfassungsmauer.
Informationstafel.
Kleiner Rastplatz an der Mauer und einem Nebengebäude.
Alter Blauglockenbaum.
Giebel des Bischofspalasted mit Eingangshalle und Schmalseite der kleinen Kapelle, mit großem gotischen Fenster – vom Garten aus gesehen. Hier gibt es ein Kaffeehaus.
Von kleinen Hecken aus Eiben und Buchsbaum umgebene, geometrisch angelegte Blumenbeete auf der Rückseite des Bischofspalastes.
In der Mitte der sich kreuzenden Wege eine Schale mit Blumen aus Stein.
Die Nordostecke des Gartens mit Umfassungsmauer und einem Turm. Links ein Erker in der 1. Etage des Bischofspalastes.
In einer Ecke des Bischofspalastes im Nordosten die Plastik eine Kranichs. Ein Kunstwerk aus weißem Glas und Metall von Edgar Phillips (1970-).
Blick von der Mauer auf die Schmalseite der Kapelle, einen Flügel des Bischofspalastes und die davor liegenden Beete.
Blick auf die Mauer von einem der Türme.
Informationstafel.
Blick auf den östlichen Burggraben. Ganz hinten rechts der Übergang zum Arboretum und den äußeren Teilen des Gartens.
Unter der kleinen Brücke eine Kaskade, daneben einer der Türme der Mauer.
Höckerschwan.
Brücke aus Holz, die in die äußeren Gärten führt. Im Hintergrund die Kathedrale.
Blick von der Brücke auf die Kathedrale und die äußeren Gärten. In der Mitte das kleine steinerne Brunnenhaus „Well House“. Erbaut 1451 unter Bischof Thomas Beckington (ca. 1390-1465). An den vier Zapfhähnen konnte die Bevölkerung von Wells frisches Wasser abfüllen, das über eine 255 Meter lange Messingleitung hergeleitet wurde. Oben auf dem Dach die Plastik eines Jagdhundes.
Blick auf den nordöstlichen Turm mit dem Weg, der in die äußeren Gärten führt,
unterhalb der Umfassungsmauer.
Blick auf die dem Burggraben zugewandte Fassade des Bischofshauses, des Nordflügels.
In Teilen des Gartens wird auch Gemüse und Obst angebaut. Es war für den bischöflichen Haushalt vorgesehen.
Blick über das Brunnenhaus und den Burggraben Richtung Kathedrale.
Blick über den Burggraben Richtung Nordflügel oder Bischofshaus.
Arkanthus oder Bärenklau.
Beet mit Gewöhnlichem Blutweiderich, Schmetterlingsflieder und Artischocke.
Blüte der Artischocke.
Blick über das gotische Brunnenhaus auf die Kathedrale von Südosten.
Fassade des Nordflügels. Davor die Plastik „The Weight of our Sins“ – „Das Gewicht unserer Sünden“, ein Kunstwerk von Josefina de Vasconcellos (1904-2005).
Brunnenhaus und Kunstwerk von Josefina de Vasconcellos.
Blick über Hortensien und den Burggraben auf die Kathedrale.
Inneres des Bischofpalastes:
Der Jocelin-Block, der älteste Teil des Palastes, ist zwei Stockwerke hoch. Im Erdgeschoss befinden sich zwei lange Räume, die als Eingangshalle und Untergeschoss bekannt sind. Die Eingangshalle selbst war wahrscheinlich in kleinere Räume unterteilt.
Informationstafel
Blick in die Eingangshalle mit ihrem Kreuzrippengewölbe und dem langen Tisch aus dem Refektorium.
Kamin aus dem 16. Jahrhundert – Tudorzeit, mit Flachreliefs und den Wappen von Bath und Wells. Vorher wurde der Raum mit Kohlebecken geheizt.
Stuhl mit hoher Lehne aus geschnitztem Holz. Das Polster ist bestickt mit Blüten und gotischen Spitzbögen.
Eingang mit Spitzbogen, flankiert von 2 kleinen Säulen, zum Großen Saal.
Informationstafel zum Großen Saal oder unterirdischen Gewölbe.
Großer Saal mit Kreuzrippengewölbe aus dem 13. Jahrhundert im Erdgeschoss, parallel zur Empfangshalle. Das Gewölbe ist aus Doulting-Stein, die Säulen aus blauem Lias-Stein. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Raum, der auch unterteilt wurde, als Weinlager, Speisekammer, Kohlen- und Holzkeller oder als Raum für das Personal genutzt.
Viktorianischer Kamin mit einer Mitra als Dekoration.
Informationstafel zur Treppe.
Steinerne Wendeltreppen führten im 13. Jahrhundert, jeweils am Ende der Eingangshalle in das Obergeschoss mit den wichtigeren, hochrangigeren Räumen. Heute führt eine Treppe aus Holz in die obere Etage. Sie wurde unter Bischof Manes Montague zwischen 1608 und 1616 eingebaut. Damals war sie bunt bemalt. Die Bemalung wurde allerdings in den 1970er Jahren entfernt.
Farbig sind heute nur noch die 4 grünen Drachen von Somerset, die das Wappen von Bath und Wells halten.
In der oberen Etage befinden sich historische Räume und eine Ausstellung zur Geschichte des Bischofspalastes und der Bischöfe von Bath und Wells.
Informationstafeln zum 13., 17. und 18. Jahrhundert.
Informationstafel
Getäfeltes Zimmer, ein ehemaliger privater Raum. Vom frühen 13. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg, dienten die Räume in diesem Gebäude den Bischöfen als Wohnräume. Bischof Underhill zog während des 2. Weltkrieges in den Nordflügel – das sogenannte Bischofshaus, in dem seit Mitte des 15. Jahrhunderts die Dienstboten ihre Zimmer hatten. So konnten Schüler und Lehrer aus der St. Brandon’s Schule in Bristol sicher untergebracht werden. Nach dem Krieg wohnten die Bischöfe weiterhin im Nordflügel.
An der Wand ein Gemälde eines Bischofs mit einem kostbaren Umhang, einer Kasel, die in einer Vitrine daneben ausgestellt ist. Sie ist aus cremefarbenem Seidendamast und mit goldenen Fäden mit Sonnen bestickt.
Informationstafel zum Privileg der Bischöfe von Bath und Wells, den jeweiligen Herrscher bei seiner Krönung zu unterstützen. Dieses Privileg reicht über 9 Jahrhunderte zurück, bis in die Zeit von König Richard I.
Informationstafel mit einem Zeitstrang mit Fotos und Abbildungen von Krönungen.
Weitere prächtig bestickte Kaseln.
Informationstafel zum Bischofsstab.
Bischofsstab aus Silber, teilweise vergoldet und mit Elfenbein, verziert mit Bergkristall und Halbedelsteinen aus dem Jahr 1885. Insgesamt 210 cm lang. Auseinander geschraubt untergebracht in einer Kiste aus Eichenholz mit Stahlbeschlägen.
Mehrteiliger Spiegel, dessen Rahmen mit chinesischen Motiven verziert ist.
Informationstafel zum Konferenzraum. Auf einer Informationstafel sieht man historische Fotos von Schülern und Lehrern der St. Brandon’s Schule in Bristol, die während des 2. Weltkrieges hier untergebracht waren.
Zusammen mit den daneben liegenden Salon, bildete dieser Raum im 13. Jahrhundert die große Halle. An der Decke kann man den, von Bischof Richard Bagot bevorzugten, viktorianisch-italienisch-gotischen Stil bewundern.
Das Wappen von Bischof Bagot sieht man in den Ecken der Decke.
Kasel für Pfingsten: Die üppig bestickte und mit Applikationen versehene Kasel für den Pfingst-Gottesdiens, wurde von der Textil-Designerin Carolyn Partleton (1974-) entworfen und 2021-2022 in über 2000 Arbeitsstunden gefertigt.
Kasel für Ostern: Inspiriert vom Gemälde der Kreuzabnahme des Malers Peter Paul Rubens, wurde auch diese Kasel für den Oster-Gottesdienst von der Textil-Designerin Carolyn Partleton in der Zeit von 2022-2024 designet. Oberhalb diese Szene Engel und eine Taube.
Auf der Vorderseite der Kasel zeigt eine Straßenszene in Jerusalem, in der die Menschen ihren täglichen Geschäften nachgehen.
Informationstafel zu den Gärten hinter dem Bischofspalast.
Informationstafel zum Salon.
Salon: er war im 13. Jahrhundert Bestandteil der großen Halle. 1977 hat man hinter viktorianischen Bücherschränken zwei der ursprünglichen Fensteröffnungen entdeckt. In der linken Fensternische steht jetzt der originale Glastonbury-Stuhl.
Lange Galerie: im Mittelalter war die Galerie wahrscheinlich in 3 Räume zum Arbeiten und Erholen unterteilt. Während des Bürgerkriegs zwischen König und Parlament 1641 richteten die königlichen Truppen im Palast ihr Hauptquartier ein. Als die parlamentarischen Truppen in den Palast einmarschierten, wurden Porträts und eine Orgel gestohlen. Jahrzehntelang wurde der Palast vernachlässigt. Bis 1824 hat dann Bischof George Henry Law (1761-1845) den Palast in einen Wohnsitz im gregorianischen Stil umgewandelt und begann mit der Sammlung von Porträts bzw. Bildnissen. Da unter Bischof Richard Bagot eine Etage über der langen Galerie erbaut worden war, konnte der Architekt Benjamin Ferrey (1810-1880) die erste Etage renovieren. Die Fenster wurden vergrößert, Stuckdecken eingebaut und die von Bischof Richard Bagot bevorzugten Verzierungen im viktorianisch-italienisch-gotischen Stil durchgeführt werden.
Informationstafeln
Blick auf die Fensterseite der langen Galerie mit einem langen, eingedeckten Tisch vom Ende des 19. Jahrhunderts.
Blick auf die Bildergalerie mit den chronologisch angeordneten Bildnissen von Bischöfen von Bath und Wells durch die Jahrhunderte.
Kapelle: von der Eingangshalle führt eine Tür in die einschiffige Kapelle, die der heiligen Dreifaltigkeit und dem heiligen Markus geweiht ist. Sie wurde unter Bischof Robert Burnell (ca. 1239-1292) im frühen englischen decorated-gothic-style erbaut. Die Fenster sind für das späte 13. Jahrhundert sehr groß, das Maßwerk ein Beispiel für die englische Frühgotik. Für das Gewölbe wurde der lokale Doulting-Stein verwendet.
Blick auf das Fenster im Osten und den Altar, sowie das Chorgestühl. Im 19. Jahrhundert wurde die vernachlässigte Kirche unter Bischof George Henry Law (1761-1845) restauriert und das vernagelte, große Fenster im Osten wieder hergestellt und mit Scherben von zerstörten Kirchenfenstern aus Rouen verziert.
Blick in das Gewölbe mit farbigen Schlusssteinen mit floralen Motiven.
Das Chorgestühl stammt von örtlichen Holzschnitzern aus dem frühen 20. Jahrhundert. An den Rückwänden gemalten Wappen.
Details der hinter dem Altar befindlichen gotischen Blendarkaden, die mit farbigen, gemalten Vierpässen verziert sind. Sie zeigen Szenen aus der Bibel.
Orgel.
Altes Haus direkt neben dem Chorabschluss der Kathedrale und dem Kapitelsaal in der St. Andrew Street. An der Fassade gotische Fenster mit Maßwerk und einige Wappen als Flachrelief. Im Garten ein Baum mit grün-weißen Blättern.
Fahrt nach Bath. An den Straßen dichte Hecken, die bis an die Fahrbahn reichen.
Typisch englische Reihenhäuser.
-
Bath: ca. 100.000 Einwohner zählende Großstadt im Südwesten Englands. Sie ist berühmt für ihre römischen Bäder. Ab 43 nach Christus haben die Römer die hier existierenden warmen Quellen für ihre Thermen verwendet. Diese einzigen heißen Quellen in England waren der Überlieferung nach schon zur Zeit der Kelten bekannt. Mit dem Abzug der Römer und dem schwindenden Einfluss des Römischen Reiches begann der Untergang der Badekultur und der Bäder, auch in Bath. Seit der Zeit von Elisabeth I. entwickelte sich Bath immer mehr zum Kurort der wohlhabenden Bevölkerung. Daher gibt es noch viele historische Gebäude, insbesondere aus der georgianischen Epoche. Der das Stadtbild prägende Georgian Style, ist der Sammelbegriff für die englischen Dekorationsstile von etwa 1714 bis 1837, während der Regierungszeit von George I. bis zum Ende der Ära George IV. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts lebten innerhalb der Stadtmauern rund 3000 Menschen. Innerhalb von nur einem Jahrhundert wuchs die Bevölkerungszahl des bedeutendsten britischen Thermalbades um mehr als das Zehnfache auf etwa 34.000. Der Architekt John Wood der Ältere (1704-1754) und sein Sohn John Wood der Jüngere (1728-1782) entwarfen ein großzügiges Stadtbild, das die mittelalterlichen Stadtmauern sprengte und keinem starren geometrischen Schema folgte. Die Gebäude dieser Zeit wurden aus dem in der Nachbarschaft abgebauten Bath Stone erbaut. Bath ist Universitätsstadt und von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft. Bath liegt am Fluss Avon, etwa 20 km südöstlich der Hafenstadt Bristol.
Stadtplan
Häuser mit mehrgeschossigen Erkern und den typischen Schornsteinen.
Sprossenfenster mit einem Gesims darüber.
Typisch englische Schornsteine.
Bathwick Street kurz vor einer Brücke über den Fluss Avon. Rechts und links auf beiden Seiten des Flusses, jeweils ein kleines Haus mit Säulen davor.
„The Curfew“ Schild mit Ritter von einem Pub.
Mehrgeschossige Häuserzeile an der London Road.
St. Swithin’s Church, eine historische Episkopalkirche an der London Road. Erbaut zwischen 1777 und 1797(nach anderen Quellen 1779-1790) von John Palmer. Rechts der oberhalb der Stadt gelegene Hedgemead Park.
The Paragon: Die Straße ist wahrscheinlich bereits römischen Ursprungs. Auf mittelalterlichen Karten gibt es sie ebenfalls. Sie liegt im Stadtteil Walcot und hat zahlreiche denkmalgeschützte Häuser im georgianischen Stil vom Architekten Thomas Warr Attwood (ca. 1733-1775). Sie flankieren die Straße wie eine hohe Wand.
Milsom Street
Historisches Haus in der Old Bond Street mit Laden „Sweet little things“, dessen Fassade mit rosafarbenen Blumen dekoriert ist..
St. Michael’s Church in der Broad Street, ganz in der Nähe des Flusses Avon. Die georgianische Kirche wurde 1835-1837 im neugotischen Stil vom Stadtarchitekten George Philipp Manners (1789-1866) erbaut. Sie war Ersatz für eine frühere Kirche. Der erste Vorgängerbau war im Mittelalter die erste Kirche, die außerhalb der Stadtmauern von Bath erbaut worden war und lag außerhalb des Northgate. Der nach Süden vorspringende Turm hat auf seiner Südseite ein hohes Dreifachfenster unter einem kleineren Rosettenfenster. Der Turm trägt eine verzierte achteckige offene Laterne und eine Turmspitze.
Stadtplan
„Saracens Head“ Schild eines Pubs mit dem Kopf eines Sarazenen.
Blick in die Regale der Öffentliche Bibliothek von Bath.
Historische Fassade mit Säulen mit ionischen Kapitellen und einem Band aus Flachreliefs mit griechischen Göttern, in der High Street, die auf die Kathedrale zuführt.
Direkt daneben die Guildhall.
Eingang zur historischen Markhalle. Über dem Durchgang eine schmiedeeiserne Dekoration.
Ebenfalls in der Hight Street der Zugang zum Einkaufszentrum „Corridor“ mit schmiedeeisernem Dach über dem Eingang.
The Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul oder Abteikirche: Die Kirche war ursprünglich die Klosterkirche einer Benediktiner-Abtei. Zwischenzeitlich war sie auch Bischofssitz der Diözese Bath und Wells. Sie ist den Aposteln Petrus und Paulus geweiht. Berichte über die Gründung einer Abtei in Bath reichen bis ins 7. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1088, also 22 Jahre nach der normannischen Eroberung Englands, wurde der Bau einer repräsentativen Bischofskirche im anglo-normannischen Stil beschlossen. Nachdem sie im 13. Jahrhundert stark beschädigt wurde, Ab 1499 begann der Wiederaufbau im Perpendicular Stil, ein für England typischer Baustil der Spätgotik. Im Auftrag von Königin Elisabeth I. wurde die Kirche von 1574-1611 restauriert. Ab 1583 wurde die ehemalige Abteikirche und Kathedrale als Pfarrkirche von Bath genutzt. Weitere Restaurierungen erfolgten in der Zeit des Historismus von 1860-1877 unter dem Architekten George Gilbert Scott (1811-1878). Die dreischiffige Kirche ist in Form eines lateinischen Kreuzes errichtet und fasst etwa 1200 Personen.
Blick auf die Fassade des nördlichen Querschiffs, den 49 m hohen Turm auf der Vierung und das Langhaus von der High Street. Die Kirche ist ca. 67 m lang und einschließlich der Seitenschiffe 22 m breit.
Auf der Nordseite der Kirche der Rebecca-Brunnen von Rushton Walker aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der heute als Sitzbank genutzt wird.
Westfassade. Über dem Hauptportal ein großes Fenster mit gotischem Maßwerk.
Einmalig sind die beiden Himmelsleitern auf beiden Seiten des Hauptportals, die von Engeln genutzt werden. Sie entstanden zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach einem nächtlichen Traum des Bischofs Oliver King (1432-1503) und wurden um 1900 erneuert. Sie enden in zwei achteckigen kleinen Türmen, zwischen denen ein Giebel mit weiteren Engelsfiguren und mit Maßwerk verzierten Zinnen steht. Ganz oben thront Christus.
Hauptportal, flankiert von zwei lebensgroßen Statuen. Über der Tür die Statue eines Königs und das königliche Wappen aus dem Mittelalter mit Löwen und Lilien. Die Tür aus Holz ist mit geschnitzen Wappen, Spruchbändern und andere dekorativen Motiven verziert.
Das rechte Portal an der Westfassade. Darüber ein Fenster mit Maßwerk und einer Statue. Pfeiler daneben ein Relief von 2 Bäumen, einer Krone und einer Mitra.
Blick in das Innere der Kirche, welches nicht betreten werden konnte wegen eines Gottesdienstes anlässlich der Universitätsabschlüsse. Das Hauptschiff ist 24 m hoch und von einem Fächergewölbe bedeckt.
Hinter dem Hochaltar das große und ungewöhnlicherweise rechteckige Chorfenster mit 56 Szenen aus dem Leben Christi.
Südseite der Kirche: hier liegt der Platz Kingston Parade. An dieser Stelle befand sich einst der Kreuzgang des Benediktiner-Klosters. Der Platz ist umgeben von der Kirche im Norden, den römischen Bädern im Westen und anderen historischen Bauten.
Blick auf die Vierung mit Turm und der Fassade des südlichen Querschiffs. Straßenmusikanten und viele Bänke laden zum Verweilen ein.
Absolventen der Universität, gekleidet in Talar und Hut, die traditionelle Kleidung von Professoren, Absolventen, Geistlichen und Juristen seit dem Mittelalter. Universitätsangehörige tragen Talare nur bei besonderen, feierlichen Anlässen wie etwa Verleihungen von Ehrentiteln, Amtseinführungen oder Jubiläen. Aus den Farben ist ersichtlich, welcher Fakultät und Universität der Träger angehört. Sie laufen Richtung Eingang der Kirche.
Vor der Westfassade der Kirche liegt der Platz Abbey Churchyard. Hier befindet sich auch der Eingang zu den römischen Bädern. Diese Thermen der Römer wurden bis in das 5. Jahrhundert nach Christus genutzt. Die Quelle befindet sich heute in Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert, die von den Architekten John Wood der Ältere (1704-1754) und seinem Sohn John Wood der Jüngere (1728-1782) entworfen wurden. Die Besucher tranken das Wasser im Grand Pump Room, einem neoklassizistischen Salon, der noch immer sowohl zum Trinken als auch für gesellschaftliche Anlässe genutzt wird. Die viktorianische Erweiterung des Bäderkomplexes folgte der neoklassizistischen Tradition der Woods. Die dem Platz zugewandten Giebel zeigen Säulen mit korinthischen Kapitellen. Links der Eingang zu den Bädern, rechts der Eingang zum Pump Room Restaurant.
Werbeplakat für die römischen Bäder mit einem Foto des Wasserbeckens.
Landkarte von Europa mit den größten Kurorten, wie z.B. Baden Baden, Wien, Vichy oder Bad Ems.
Bogen aus orangefarbenen, künstlichen Blüten vor einem Restaurant.
Blick über den Platz mit seinen Läden und den abschließenden Kollonaden zur Stall Street.
Laden und Schaufenster mit Andenken.
Blick über den Kingston Parade im Süden der Kathedrale und die ihm umgebenden Häuser.
Von hier führt die York Street zur Stall Street im Süden an den römischen Bädern vorbei. Ein Bogen, der Abbey Arch – mit kleinem Giebel und dem Kopf eines römischen Gottes, führt über die Straße. Er verbirgt über die Straße führende Rohrleitungen.
Blick zurück durch die York Street zur Kirche. Links die Außenmauer der römischen Bäder, rechts der Eingang zum World Heritage Center der Stadt.
Ausstellung im World Heritage Center mit Fotografien und Luftbildern von Bath. The Royal Crescent bzw. der Königliche Halbmond und das Rund des Circus als Luftbild. Entstanden in der georgianischen Periode von 1714-1830 in der Zeit der Herrschaftn der Könige George I. bis George IV.
Luftbild der Innenstadt von Bath.
Foto der Palladian Bridge im Prior Park im Süden der Stadt.
Schild mit dem Hinweis nicht die Möwen zu füttern und den Müll in einen Mülleimer zu werfen.
Halbrundes Gebäude mit Kuppel an der Monmouth Street mit einem thailändischen Restaurant. Oben am Balkon Blumen und eine große Glocke.
Pub „Garrick’s Head“ am St. John’s Place.
Daneben an der Saw Close das New Theatre Royal. Erbaut 1805 für 900 Zuschauer und eines der wenigen erhaltenen Theaterbauten der georgianischen Zeit. Der Architekt war George Dance der Jüngere (1741-1825) und John Palmer (ca. 1738-1817) führte einen Großteil der Arbeiten aus. Ein Großbrand im Jahr 1862 zerstörte das Innere des Gebäudes, wurde aber sehr schnell mit einem Wiederaufbauprogramm von Charles John Phipps (1835-1897) wieder errichtet. Hierbei wurde 1863 auch die heutige Einganshalle gebaut.
Details der Fassade mit dem königlichen Wappen und vergoldeten Kapitellen.
Historisches Haus gegenüber vom Theater.
Auch das 1860 errichtete Bluecoat House, in dem sich heute das thailändische Restaurant „Giggling Squid“ befindet. Hier befand sich die Bluecoat Schule, die anglikanischen Jungen und Mädchen kostenlose Bildung anbot. Architekt war William Killigrew. Killigrews Gebäude wurde 1859 abgerissen und ein neues Gebäude im Stil der „nördlichen Renaissance“ errichtet. Dieses von John Elkington Gill (1821-1874) und dem Stadtarchitekten George Phillips Manners (1789-1866) entworfene Gebäude war Teil einer Neugestaltung dieses Stadtteils. Das Gebäude wurde weiterhin als Schule genutzt, dann 1921 verkauft und schließlich von der lokalen Regierung als Büro genutzt.
2 „typische“ englische Männer.
Etwas weiter nördlich der Queen Square: Der Platz ist umgeben von georgianischen Häusern. Er war der früheste Teil der Umgestaltung der Stadt durch John Wood den Älteren (1704.1754) und seinen Sohn.. Auf der Nordseite steht ein Gebäude, was wie ein Palast wirkt. Die Fassaden wurden nach den Regeln der palladianischen Architektur entworfen.
Der kleine quadratische Park in der Mitte des Platzes, wurde 1738 von Beau Nash (1674-1762) angelegt. Ursprünglich hatte er in seiner Mitte einen Teich und einem 21 m hohen Obelisken darin. 1815 brach der Obelisk bei einem Sturm ab und wurde beschädigt.
Historisches Gebäude mit halbrundem Erker, am Queen Square und der Gay Street, die zum Circus führt.
Jane Austen Centre in der Gay Street 40.
Circus: Der Circus wurde vom Architekten John Wood dem Älteren (1704.1754) entworfen als städtisches Infrastruktur- und Wohnungsbauprojekt. Ursprünglich hieß der Komplex King’s Crescent. Bereits 3 Monate nach der Grundsteinlegung starb er und das Projekt wurde von seinem Sohn John Wood der Jüngere (1728-1782) fortgeführt. Gedanklich wurde das Projekt sowohl vom Kolosseum im Rom, als auch von Steinkreis in Stonehenge beeinflusst. Die Anlage bildet einen Kreis mit 3 abgehenden Straßen. Alle Häuser sind gleich gestaltet. Sie haben ein Souterrain und 3 Etagen darüber. In den kleineren Dachgeschossen befanden sich Kammern für die Dienstboten. Alle Fassaden sind durch Doppelsäulen strukturiert. Sie habe im Erdgeschoss dorische, in der 1. Etage ionischen und in der 2. Etage korinthische Kapitelle.
In der Mitte befand sich eine Freifläche, die aber schon im 19. Jahrhundert von den Bewohnern bespflanzt wurde. Heute stehen hier große, alte Bäume.
Die 525 verschiedenen Reliefs über den Türen und Fenstern, zeigen versteckte Druiden- und Freimaurersymbole.
Blühender Chinesischer Sternjasmin (Trachelospermum jasminoides).
Historisches Haus in der Brock Street.
Historisches Auto Anfang des 20. Jahrhundert, ggf. ein Adler.
Alte Telefonzelle.
Royal Crescent bzw. Königlichen Halbmond: Stirnseite des halbrunden Komplexes. Der Baukomplex besteht aus 30 halbkreisförmig aneinander gebauten Häusern mit vorgeblendeten Dreiviertelsäulen mit ionischen Kapitellen, die ihm in seiner Gesamtheit das Aussehen eines Palastes verleihen. Er steht am oberen Ende einer leicht ansteigenden Wiese. Der Komplex entstand zwischen 1767 und 1774 im Georgianischen Stil nach Entwürfen des Architekten John Wood dem Jüngeren (1728-1782). Stilistisch ähnelt er dem von seinem Vater entworfenen und nur 300 m entfernten Circus. Im 2. Weltkrieg wurden Teile des Gebäudekomplexes durch Bomben beschädigt. Im Untergeschoss befinden sich Wirtschafts- und Lagerräumen, im Mittelgeschoss hinter den von Halbsäulen flankierten Fenstern, befinden sich Repräsentationsräume und darüber die Schlafzimmer. In den von einer Balustrade verdeckten, gedrungenen und nur von kleinen Fenstern belichteten Dachräumen waren die Schlafkammern der Dienstboten.
Die Wiese ist seit Beginn durch einen Ha-Ha-Graben zweigeteilt. Dies ist ein trockener, unter dem Geländeniveau liegender Graben mit einer Mauer. Der Graben verhindert, daß Tiere oder ungebetene Gäste in den Garten gelangen und der Blick auf das Gelände wird nicht durch die Mauer verstellt.
Blick auf den unteren Teil der Wiese. Hinter dem Royal Crescent verläuft eine Straße, an der die Marlborough Buildings stehen.
Historisches Haus mit Balkon, am gegenüberliegenden Ende des Royal Crescent, an der Brock Street.
Von hier kommt man direkt zum Victorian Garden, einem Teil des Royal Victoria Parc. Die damals elfjährige Prinzession Victoria weihte ihn 1830 ein. Er war der erste Park, der ihren Namen trug. Der Park ist 23 Hektar groß und enthält neben einem botanischen Garten, einen Minigolfplatz und zahlreiche andere Attraktionen.
Rosafarbenes Auto verkauft Eis.
Victorianischer Musikpavillon.
Bath on the beach. Sandstrand, Liegestühle und eine Bar.
Zapfhähne für Guiness Bier in der Form einer keltischen Harfe.
Asiatisches Langhaus aus Bambus.
Minigolfplatz.
Historische Reihenhäuser im Georgianischen Stil mit den typischen Schornsteinen.
Queen’s Gate mit Medici-Löwen, an der Royal Avenue, am südöstlichen Ende des Parks. Davor Blumenbeete und eine Ziervase aus Stein.
Direkt hinter dem Tor das Bath War Memorial mit den für England typischen Kränzen aus Remembrance Poppies. Das Kriegerdenkmal wurde 1923 nach einem Entwurf von Sir Reginald Blomfield (1856-1942) errichtet.
Stockrosen (Alcea rosea).
Blick in den „The Bath and Country Club“.
Ausstellung der „Bath Royal Literary and Scientific Institution“ mit kuriosen Gegenständen von überall auf der Welt. Vom Schädel eines Dachses (Nr. 20), dem Zahn eines Wollnashorns (Nr. 13), eine Spielzeugkatze mit Maus aus China (Nr. 1), eine kleine russische Teekanne (nr. 4), eine ca. 300 Jahre alte Brille (Nr. 9), über verschiedene Muscheln und Mineralien.
Chinesische Gegenstände und alte Fotos, aus der Zeit des Opium-Krieges im 19. Jahrhundert.
Vitrine mit vielen ausgestopften Vögeln, wie z.B. Pirol, Wiedehopf und Bienenfresser.
Fossil ggf. eines Mosasauriers.
Fossil eines Dapedium politum, ein ausgestorbener Knochenfisch.
Historisches Foto der Westfassade der Abteikirche von Bath aus dem Jahr 1853.
Weitere naturwissenschaftliche Exponate aus der historischen Sammlung.
Historischer Druck mit Abbildung zahlreicher Spinnen.
Vitrine mit vielen Käfern.
Vitrine mit alten Werkzeugen aus Stein von Jägern und Sammlern aus dem Paläolithikum mit Informationstafel.
Historischer Globus, Bücher und Reiseandenken an Ausstralien.
Vitrine mit Fundstücken aus antiken Ruinen, z. B. Griechische Öllampen von 400 v. Chr., Statue der Venus aus Eisen aus Pompeji und kleines Relief aus Marmor aus Pompeji.Silbermöwe.
Holy Trinity Church in der Chapel Row, südöstlich des Queen Square. Die 1822 gegründete Holy Trinity Church ist seit fast zwei Jahrhunderten ein Eckpfeiler der örtlichen Gemeinde. Leider musste die Kirche im März 2011 ihre Türen schließen, da sie die laufenden Kosten für ein so großes Gebäude nicht tragen konnte.
Absolvent einer Universität in Schottenrock und Talar.
Pulteney Bridge: Sie wurde 1769-1774 von den schottisch-stämmigen, aber in London lebenden Architekten Robert Adam (1728-1792) und seinem Bruder James Adam (1732-1794) entworfen und gebaut. Mit 3 Bögen überspannt sie den Fluss Avon.
In Hintergrund die North Parade Bridge.
Zahlreiche Silbermöwen und Schwäne tummeln sich am Avon.
Direkt am Ufer ein großer georgianischer Bau, das „Framptons“.
Blick über die Brücke mit ihren Läden. Ein Juweliergeschaft und ein Laden mit Mosaiken, in Anlehnung an die Kunst der Römer.
Von einem der Kaffeehäuser hat man einen wunderbaren Blick auf den Fluss.
Auf dem Weg von Bath zurück nach Salisbury bei dem kleinen Ort Rode – „The Mill at Rode“, ein empfehlenswertes Restaurant in einer alten Wassermühle, gespeist vom River Frome.
Auf dem Weg nach Lincoln: Historische flache Häuser mit Reetdach.
Transport eines Fahrgeschäfts für einen Rummel.
Blick über die Landschaft mit Hügeln und Feldern.
Gaststätte, auch mit vielen Spielautomaten.
-
Lincoln: Die Hauptstadt der Grafschaft Lincolnshire und wird vom Fluss Witham durchflossen und hat ca. 90.000 Einwohner. Schon lange vor den Römern war das Gelände der Stadt besiedelt. 48 n. Chr. wurde hier der erste Militärstützpunkt der Römer errichtet. Durch den Fluss und weil hier zwei große Handelsstraßen zusammenliefen, war die Stadt schon früh ein wichtiges Handelszentrum. Die Normannen erbauten 1068 unter Wilhelm dem Eroberer bzw. König Wilhelm I. (1027-1087) die mächtige Burg Lincoln Castle. Vier Jahre später wurde mit dem Bau der Kathedrale begonnen, einer der mächtigsten und monumentalsten mittelalterlichen Kirchen in Großbritannien. Bis 1549 war sie das höchste Kirchenbauwerk der Welt. Lincoln verdiente ab dem Mittelalter lange durch den Woll- und Tuchhandel und wurde zu einer wohlhabenden Stadt. Vom Niedergang dieses Wirtschaftszweiges ab dem 14. Jahrhundert erholte sich die Stadt erst im 19. Jahrhundert mit Beginn der industriellen Revolution. Heute ist Lincoln ein wichtiger Industriestandort.
Moderne Reihenhäuser, im Design aber typisch englisch mit Erkern und großen Dachgauben.
Stadtpläne von Lincoln. Beim 1. Stadtplan ist Westen oben.
Blick von Weitem auf die Kathedrale.
Der kanalisierte Fluss Witham.
Der Pub „The green dragon“ in einem historischen Fachwerkhaus, direkt am Fluss.
St. Swithin Church: Die ursprüngliche Kirche befand sich in der Nähe des Sheep Market, wurde 1644 durch Brand zerstört und ab 1801 aus Stein wieder aufgebaut. Architekt war James Fowler (1828-1892). Der Bau des Turms und der Turmspitze erfolgte zwischen 1884 und 1887.
Die Straße Saltergate, die parallel zum Fluss verläuft, mit dem Eingang zum Stonebow Center.
Der Pub „Still“ Saltergate 18-20, mit Zitaten von Frank Sinatra über dem Bartresen.
Schaufenster eines Ladens mit furchterregenden Fantasy-Figuren.
Guildhall und Stonebow: Seit dem Mittelalter ist dies der Versammlungsort des Stadtrats. Der Stonebow ist ein Torbogen, der die High Street überspannt, eine Straße, die von Süden in die Stadt führt. Das erste Tor an dieser Stelle, wurde bereits 211 n. Chr. fertiggestellt. Das südliche Tor wurde nach der Wikingerinvasion im späten 8. Jahrhundert als Stonebow bekannt. Im späten 14. Jahrhundert abgerissen, wurde dann das heutige Gebäude aus Geldmangel aber erst 1520 fertiggestellt. Um 1840 wurden umfangreiche Umbauten am östlichen Ende des Stonebow vorgenommen, als das Gefängnis was sich hier befand, abgerissen wurde. William Adams Nicholson (1803-1853) errichtete dann ein neues Gebäude im Osten des Tores, welches 1844 fertiggestellt wurde. Bei den Abriss- und Umbauarbeiten wurde nördlich des Tores Reste der alten römischen Stadtmauer entdeckt und dort wo das Tor heute steht, befand sich wohl eine römische Barbakane. 1889 wurde dann vom bedeutenden Uhrenhersteller Potts of Leeds eine Uhr über dem Tor angebracht, mit Ziffernblättern sowohl im Süden, als auch im Norden, auf der Stadtseite.
Die östliche Seite der Gebäude, wo sich früher das Gefängnis befand.
Informationstafel zur Guildhall mit einem Foto des Sitzungssaals, der sich in der 1. Etage befindet.
Das Stonebow ist aus Kalkstein gebaut und hat oben eine Brüstung aus Zinnen. Auf der Südseite hat sie einen profilierten Mittelbogen mit zwei überdachten Nischen mit Statuen und in der Mitte mit einer Einfassung aus Pilastern, das königliche Wappen von James I.Auf der Nordseite des Tores, also auf der Stadtseite, ist das Tor schlichter gestaltet.
Historische Gebäude in der Guildhall Street, die vor dem Tor nach Westen verläuft. Ein Kaffeehaus, Nr. 19/20 das Restaurant „Mailbox“ mit 6 kleinen Giebeln zur Straße, geflügelten Löwen und floralen Motiven über dem Eingang. Gegenüber das Restaurant „The William Foster“ mit auffälliger Fassade.
Fachwerkhaus in der Silver Street, die in die Mint Street übergeht.
Historische Gebäude in der Mint Street. Mint Street und Guildhall Street münden im Westen in die Straße Newland.
In der Straße Newland die Kirche „Alive Lincoln Central“. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Kongregationsalistenkriche (dies ist eine reformierte, calvinistische Form des protestantischen Christentums), die 1876 erbaut wurde.Die High Street verläuft in Nord-Süd-Richtung durch den Stonebow. High Street 234, nördlich des Stonebow. Indisches Restaurant „Mowgli“ mit ungewöhnlicher Inneneinrichtung.
Überall in der Stadt stehen von Künstlern bemalte Skulpturen von Elefanten. Hier bemalt von Marnie Maurri, inspiriert von Henri Matisse.
Neugotisches Backsteinhaus mit Turm von 1908, High Street 302, direkt an der High Bridge, die auch Glory Hole genannt wird.
Details von Reliefs an der Fassade, z. B. mit dem Jahr 1908, das von Blumen gehaltene Wappen von Lincoln, von Pflanzen gehaltene Wappenschilde mit einem Fisch und dem 8. Regierungsjahr von König Edward VII.
High-Bridge oder Glory Hole: Die Brücke wurde 1160 erbaut und obwohl sie im Laufe der Jahrhunderte erweitert wurde, ist ein Großteil der normannischen Struktur erhalten geblieben. Die Fachwerkhäuser wurden im Jahr 1550 auf der Brücke errichtet, was sie zur ältesten bewohnten Brücke Großbritanniens macht. Die Häuser, heute ausschließlich Geschäfte, wurden 1902 unter der Aufsicht des Architekten William Watkins wieder aufgebaut. Im Jahr 1235 wurde auf der Brücke eine Thomas Becket gewidmete Kapelle errichtet, die jedoch 1762 abgerissen wurde.Rechts vom Fachwerkhaus führt eine schmale Treppe runter zum Fluss Witham in Richtung Westen.
Blick von Westen über den Fluss zur mit Fachwerk überbauten Brücke.
Feuertreppe an einem Gebäude aus Backstein.
In der Umgebung zahlreiche neuere Gebäude aus Backstein.
Von der High-Bridge in Richtung Osten runter zum Fluss – Waterside N. Auf dem gegenüberliegenden Ufer ein Einkaufszentrum.
Am nördlichen Ufer liegt das Schiff „Moonraker“, ein schwimmendes Teehaus.
Eine Brücke führt auf die Waterside S und am Ende der Pub und Biergarten in einem Fachwerkhaus „The Witch and Wardrobe“.
Blick von der Brücke Richtung Westen auf die 16 m hohe Skulptur „Emporement“ vor dem Waterside Shopping Centre. Die Skulptur von 2002 stammt vom Bildhauer Stephen Broadbent (1961-) und ist aus Aluminium und Stahl.Blick von der Brücke Richtung Osten.
An der Brücke über den Within hat man den Blick auf den Kirchturm der St. Swithin Church auf der Nordseite des Flusses.
An der Waterside S liegt der Cornhill Market. Das historische Gebäude wurde erst im Mai 2024 als Markthalle wieder neu eröffnet.
Blick in die Markthalle.
Auslage einer Konditorei mit kleinen Kuchen.
An der Markthalle wieder eine bemalte Skulptur eines Elefanten mit Motiven inspiriert von Vincent Van Gogh.
Sincil Street neben der Markhalle mit Läden in historischen Häusern.
Computeranimierte Ansicht der Sincil Street, die als neu gestaltete Einkaufsstraße in historischer Umgebung konzipiert wurde.
Blick auf die Boote am gegenüberliegenden Ufer des Witham.
Blick auf die High-Bridge von Osten, wenn man am südlichen Ufer des Witham entlang geht.
High Street südlich des Stonebow und südlich der High-Bridge. Hier befindet sich das Lincoln War Memorial von 1922. Direkt daneben die gotische St. Benedict’s Church. 1107 erstmals erwähnt, war sie vor dem englischen Bürgerkrieg die Stadtkirche von Lincoln. Im Bürgerkrieg wurde sie weitgehend zerstört und nur teilweise wiederhergestellt. Der niedrige Turm wurde nach dem Vorbild der anderen spätangelsächsischen Türme in Lincoln wiederaufgebaut. Erhalten geblieben sind lediglich das heutige Kirchenschiff, welches früher der Altarraum der früheren Kirche war und die Kapelle im Norden, die 1378 von Robert Tattershall erbaut wurde.
Gegenüber ein Gebäude mit zwei halbrunden Erkern und neugotischen Blendbögen. Daneben ein weiteres Gebäude aus Backsteinen mit einem Giebel im Stil der Neurenaissance.
Noch weiter südlich ein weiteres historisches Gebäude aus Backsteinen mit neugotischer Fassade.
Eine recht steile Straße – The Strait – führt hinauf zur Kathedrale. Sie geht über in die Straße Steep Hill, die durch das südlich der Kathedrale liegende ehemalige blühende, jüdische Viertel führt. Im Hintergrund die Türme der Kathedrale.
„Jews House“ und „Jews Court“, zwei der ältesten Gebäude in Lincoln. Die Häuser zeigen charakteristische normannische Fenster mit Sprossen. Das „Jews House“ wurde um 1170 erbaut. Der Judenhass wurde 1255 geschürt, durch die Behauptung, daß die Juden einen Ritualmord an einem christlichen Kind namens Litte Saint Hugh of Lincoln verübt haben sollen. Daraufhin wurde 1290 die gesamte jüdische Gemeinde von Eduard I. aus England vertrieben. Das „Jews House“ wurde seinem jüdischen Besitzer weggenommen. Bis zur heutigen Zeit ist das Gebäude ununterbrochen bewohnt und seit 1973 ein Restaurant. Über dem Eingang haben sich zwei romanische Doppelbogenfenster erhalten. Über dem Eingang ist ein Kaminsims sichtbar. Das Haus rechts daneben könnte die ehemalige Synagoge gewesen sein, wurde aber in den letzten 300 Jahren massiv verändert.
Informationstafel zum Norman House.
Noch etwas weiter oben dann das sogenannte Norman House oder Normannische Haus, welches früher als „Aaron the Jew’s House“ bekannt war. Die architektonischen Funde deuten auf eine Datierung zwischen 1170 und 1180 hin.
Einmündung der Straße Steep Hill oben auf dem Castle Hill. Hier gibt es viele Läden in historischen Häusern.
Pub und Restaurant „Wig & Mitre“.
Der Einmündung gegenüber liegt die Touristen-Information in einem Fachwerkhaus.
Castle Hill: Vor dem großen Exchequer Gate stehen zahlreiche historische Autos, Oldtimer. Es wird das „1940’s Weekend“ gefeiert. Auch die Menschen kleiden sich wie in den 1940ger Jahren.
Church of St. Mary Magdalene: Das aktuelle Gebäude stammt aus dem späten 12. bzw. frühen 13. Jahrhundert. Nachdem sie 1644 von parlamentarischen Streitkräften beschädigt worden war, baute man sie 1695 wieder auf. 1882 führte der Architekt George Frederick Bodley (1827-1907) einige Umbauarbeiten durch. Chorschranken und ein Orgelprospekt wurden eingebaut.
Blick in das Innere der Kirche mit neugootischer Chorschranke, dem Altar und farbigen Glasfenstern.
Einmündung der Straße Bailgate, gegenüber der Einmündung Steep Hill. Auch hier vielen Läden in historischen Gebäuden.
Hotel „White Hart“ mit einem Oldtimer.
An der Ecke East Gate eine Post in einem Gebäude aus Backsteinen.
In einem Schaufenster Plakat für das „1940’s Weekend“, mit dem Modell eines alten Flugzeuges.
Ein Oldtimer mit dem Modell eines Flugzeuges auf dem Dach.
Blick über den Castle Hill. Links die Touristen-Information, das Exchequer Gate mit der Kathedrale und rechts die Einmündung der Straße Steep Hill.
Auf dem Platz Marktstände mit Gegenständen aus den 1940ger Jahren. Hier kleine Packungen für einen Spielzeug-Kaufmannsladen.
Die Menschen verkleiden sich, zum Beispiel als Soldaten oder als Winston Churchill.
Blick zum gotischen Exchequer Gate mit der dahinter liegenden Kathedrale.
Detail einer kleinen Skulptur außen am Bogen, mit Mondsichel und Stern in den Händen.
Details des Gewölbes im Tor. Ein Schlussstein mit einem Reiter.
Blick vom Minster Yard auf das Exchequer Gate.
Hinter dem Tor liegt die Kathedrale und der Minster Yard mit Reihenhäusern aus Backsteinen mit den typischen Erkern und Schornsteinen.
The Cathedral Church of St. Mary oder Kathedrale von Lincoln: Die Kathedrale ist eines der bedeutendsten Bauwerke der englischen Gotik zeigt auch noch Teile des normannischen Baustils. Auf dem heute flachen Abschluss des Vierungsturms befand sich ein hölzerner Turmhelm, welcher der Kathedrale nach einer ungesicherten Überlieferung eine Gesamthöhe von ca. 160 Metern verlieh und damit für eine gewissen Zeit (ca. 1311-1549) als das höchste Gebäude der Welt galt. Sie liegt im Nordosten der Altstadt, gegenüber vom Lincoln Castle.
Die früheste Vorgängerkirche wurde noch zur Zeit von Wilhelm dem Eroberer errichtet. Die Bauarbeiten begannen 1072 und waren 1092 vollendet. 1137 oder 1139 gab es einen großen Brand. Der Wiederaufbau erfolgte kurz danch unter Bischof Alexander. Er ist verantwortlich für die figurenreiche Gestaltung der romanischen Westfassade. Über den Portalen der Westfassade befindet sich aus dieser Zeit noch ein Relieffries mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zuseiten der Majestas Domini (um 1141–50). Hier zeigt sich der früheste Einfluss der Ile de France, der Basilika Saint-Denis, in England. 1185 zerstörte ein Erdbeben einen große Teile der Kathedrale. Erhalten blieben wohl nur untere Teile der Westfassade und der Westtürme. Diese Fassade aus dem 2. Viertel des 12. Jahrhunderts zeigt drei Nischen mit Rundbögen, deren Größe und Breite sich zur Mitte steigern. Um diese Nischen herum befinden sich auf der ganzen Fassade spitzbogige Blendarkaden. Dieses Motiv ist überall bei englischen Kirchen, innen und außen, sehr beliebt. Hinter der Fassade befinden sich zwei Türme. Die heutige Kathedrale ist eine dreischiffige Emporen-Basilika. Sie hat wie andere englische Kathedralen zwei Querschiffe. Das westliche Querschiff ist länger und wird von einem rieseigen Vierungsturm bekrönt. Auch der Chorabschluss ist, wie häufig bei englischen Kathedralen, gerade. Während die englischen Kathedralklöster in der Regel frei in der Landschaft in einem eigenen Bezirk liegen, ist Lincoln wie die Kathedralen Kontinentaleuropas Bestandteil der Stadt. Da sie auf einem Hügel liegt, ist sie schon von Weitem als Landmarke sichtbar.
Westfassade: Die Fassade aus dem 2. Viertel des 12. Jahrhunderts zeigt drei Nischen, deren Größe und Breite sich zur Mitte steigern. Der zentrale Bereich der Westfassade stammt noch von der normannischen Kathedrale, die unter Bischof Remigius erbaut wurde. Er war Bischof von 1072-1092. Nach dem zerstörerischen Feuerim ersten Drittel des 12. Jahrhunderts, baute Bischof Alexander die Kathedrale wieder auf. Er ergänzte bei den runden normannischen Türbögen an der Westfassade aufwendige Dekorationen. In Frankreich und Italien hatte er Kirchen mit bandförmigen Skulpturen an der Westfassade gesehen. Ihm wird zugeschrieben, dass er den Fries an der Westfassade der Kathedrale iin Auftrag gegeben hat. Er zeigt biblische Szenen von Adam und Eva im Garten Eden bis zur Zeit Christi.
Bischof Hugh Licolniensis (1140-1200) oder Hugo von Lincoln aus Avalon in Frankreich, gab eine Erneuerung der Kathedrale in Auftrag, nachdem ein Erdbeben große Teile zerstört hatte. Die Westfassade blieb erhalten. Während seiner Amtszeit begann der Architekt Geoffrey de Noiers 1192 mit einem neuen groß angelegten Steinbau im gotischen Stil, der 1235 abgeschlossen wurde. Bereits 1220 wurde der Bischof heilig gesprochen. Das große Mittelfenster im Perpendicular Style stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Der Fries mit sitzenden Königen über dem mittleren Portal ist allerdings aus dem 14. Jahrhundert.
Details des mittleren Portals mit seinen skulptierten Säulen im Gewände. Das romanische Portal hat auf seinen Säulenschäften normannische Dämonen- und Zickzackornamentik. Vorbilder für die ornamentale Gestaltung vieler Motive finden sich in der Buchmalerei „Schule von Winchester“ des 11. Jahrhunderts.
Detail eines Flachreliefs, rechts oben vom Hauptportal, über der Statue eines Bischofs.
Details der gotischen Blendarkaden rechts von der rechten Tür.
Blick auf die mittlere und die rechte Tür, die jetzt der Eingang ist.
Flachrelief mit biblischer Szene, rechts oberhalb des rechten Portals. Eventuell Josef und Jesus als Zimmermann, Daniel in der Löwengrube, Menschen in einem Boot.
Das linke Portal mit seinen skulptierten Säulen im Gewände.
Hier die Grenze zwischen dem romanischen Teil der Fassade und dem linken gotischen Teil mit den spitzbogigen Blendarkaden.
Der Fries mit Darstellungen der Hölle mit vielen Teufeln und dem Tor zur Hölle.
Fortsetzung des Frieses um die Ecke mit Bischöfen und Königen mit Palmwedeln. Daneben Engel und der jüdische Patriarch Abraham, der die Seelen der Toten sicher in einem bootförmigen Tuch hält.
Adam und Eva und die Vertreibung aus dem Paradies.
Im Gegenuhrzeigersinn gehen wir um die Kathedrale herum: Die Südseite mit den kleinen, an der Fassade sitzenden Türmchen mit gotischen Blendarkaden. Oben steht seit 800 Jahren die Statue des heiligen Hugh und hebt segnend die Hand. „Kill Canon Corner“ ist die Bezeichnung für die windige Südwestecke der Westfront.
Gleich hinter der Fassade befindet sich auf der Südseite das steile Dach des Konsistoriumshofs. Hier wurden einst Fälle verhandelt, die mit Kirchenrecht, Moral, Ehen und Testamenten zu tun hatten.
Blick auf die Vierung und das südwestliche Querschiff. Rechts eine Vorhalle oder Paradies, zum Eingang im südwestlichen Querschiff.
Der Vierungsturm, der gerade vollendet bereits 1239 einstürzte.
Die Fassade der Vorhalle, des Paradieses. Erbaut unter Robertus Grosseteste (1168-1253), der 1235 Bischof wurde. Kurz danach entstand die Vorhalle, die als „Galiläa“ bezeichnet wird.
Der Eingang im südwestlichen Querschiff.
Die Fassade des südwestlichen Querschiffs. Oben eine großes Fensterrose, genannt das „Auge des Bischofs“. Das Fenster enthält Fragmente von mittelalterlichen Glasfenstern.
Blick auf die Fassade des kleineren südöstlichen Querschiffs.
Die Südseite des Chores mit dem großen Portal mit Christus als Richter. Links von ihm erheben sich die tugendhaften Toten aus ihren Gräbern und werden von lächelnden Engeln im Himmel willkommen geheißen. Rechts von Christus gehen pelzige Teufel hart mit denen um, deren unbereute Sünden ihnen eine himmlische Belohnung verwehren. Das Portal zum Engelschor wird flankiert von zwei kleinen Anbauten.
Der Chorabschluss
Details der Wasserspeier am Dach, der Strebebögen und kleiner Köpfe an den Blendarkaden unterhalb des Daches vom Seitenschiff.
Blick von Osten auf den geraden Chorabschluss und das teilweise eingerüstete achteckige Kapitelhaus im Norden.
Kapitelhaus, welches im Osten des Kreuzganges liegt und natürlich einen direkten Zugang zum Kreuzgang hat.
Gebäude welches im Nordosten an den Kreuzgang angebaut ist, evt. die Bibliothek.
Nordseite der Kathedrale.
Inneres:
Gewölbe in einem der Westtürme.
Blick in das Kirchenschiff Richtung Osten zur Chorschranke und der dahinter stehenden Orgel. Sieben Paar Steinsäulen stützen das hohe Gewölbe des Kirchenschiffs. Für Dienstschäfte, Kapitelle und Sockelblenden wurde vor allem schwarzer Purbeck-Marmor in unterschiedlichen Ausführungen verwendet. Es gab einst mehr als 30 Altäre in der Kathedrale, und einige davon befanden sich im Kirchenschiff, höchstwahrscheinlich an den Säulen.
Gleich hinter dem Eingang das Grabmal von John Kaye (1783-1853), Bischof von Lincoln
Blick in das nördliche Seitenschiff mit farbigen Glasfenstern aus der Zeit von Königin Victoria (1837-1901) mit Szenen aus dem neuen Testament.
Blick vom Hauptschiff in das südliche Seitenschiff mit Blendarkaden und farbigen Glasfenstern aus der Zeit Königin Victorias, mit Szenen aus dem alten Testament.
Blick in das Gewölbe im Langhaus.
Zwischen den Obergadenfenstern und der unteren Arkadenreihe liegt das Triforiumsgeschoss, das aber auch Emporencharakter hat, d. h. der Raum hinter den Säulen ist betretbar, aber dunkel.
Blick auf die Chorschranke bzw den Lettner und die Orgel. Rechts die Kanzel aus dem frühen 18. Jahrhundert. Einst war sie ein Geschenk von Königin Anne an die englische St.-Marien-Kirche in Rotterdam. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg musste die Kirche wegen baulicher Probleme abgerissen werden. Der Akademiker A.C. Benson kaufte die Kanzel und schenkte sie der Kathedrale von Lincoln zum Gedenken an seinen Vater Edward White Benson, den späteren Erzbischof von Canterbury.
Das Gewölbe der Vierung.
Blick zurück durch das Langhaus Richtung Westen.
Das mittlere Portal der Westfassade mit den farbigen Glasfenstern darüber, von innen.
Detail des großen farbigen Fensters in der Westfassade von den Gebrüdern Sutton. Sie zeigen Könige des Alten Testaments, darunter Propheten.
Nordwestliches Querschiff:
Auf der rechten Seite des Querschiffs befinden sich Kapellen zum Gedenken an gefallene Soldaten.
Die beiden runden Glasfenster oder Fensterrosen, sind das auffälligste Merkmal in beiden Querschiffen. Die Fensterrose im nördlichen Querschiff stammt noch aus dem von St. Hugo begonnenen Bau und ist in Design und Datum mit der Rosette der Kathedrale von Chartres in Frankreich vergleichbar. Es wird „Dean’s Eye“ genannt und hat den größten Teil seiner Glasmalereien aus dem frühen 13. Jahrhundert erhalten. Dargestellt ist das Jüngste Gericht. Christus thront als Weltenrichter in der Mitte. Um ihn herum heben die Seligen im Himmel ihre Hände zum Gebet. Im oberen äußeren Rondell erscheint Christus erneut als Richter. Er streckt seine Arme aus, um die Wunden seiner Kreuzigung zu zeigen. Rechts und links von ihm Engel mit den Symbolen seines Martyriums.
Der Dichter Henry d’Avranches schrieb „Das metrische Leben des Heiligen Hugo“ zu der Zeit, als die beiden ursprünglichen runden Fenster fertiggestellt wurden. Er erklärt die Bedeutung ihrer Namen: Das Bishops Eye befindet sich auf der sonnigen Südseite des Gebäudes und das Deans Eye auf der dunklen Nordseite. Denn der Norden stellt den Teufel dar und der Süden den Heiligen Geist, und in diese Richtungen blicken die beiden Augen. Der Bischof blickt nach Süden, um einzuladen, und der Dekan nach Norden, um abzuwehren. Der eine achtet darauf, gerettet zu werden, der andere achtet darauf, nicht zugrunde zu gehen.
Militärkapellen: Drei Kapellen im nördlichen Querschiff ehren diejenigen, die in bewaffneten Konflikten gedient haben – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die königliche Standarte hängt im nördlichen Querschiff außerhalb dieser Kapellen und vereint alle drei. Die Soldatenkapelle ist dem Heiligen Georg gewidmet, dem Schutzpatron Englands und der Soldaten. Hier wird ein Erinnerungsbuch des Lincolnshire Regiments aufbewahrt. Geschnitzter Durchgang in weiß-gold zu den Militarkapellen.
Details von kleinen Skulpturen knieender Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.
Hinter dem Altar Blendarkaden mit einem farbigen Relief des heiligen Georg und Wappen. Die beiden Fenster von Sir Archibald Nicholson wurden 1924 zum Gedenken an die Soldaten eingeweiht, die im 1. Weltkrieg ihr Leben ließen. Oben wurden hier Regimentsfarben „aufgelegt“, die im aktiven Dienst verwendet wurden.
Daneben weitere Altäre. In der Mitte die Seemannskapelle. Sie ist dem heiligen Andreas geweiht, einem zum Apostel berufenen Fischer. Es ist ein Denkmal für die Mitglieder der Royal Navy und der Merchenat Navy, die die britischen Küsten verteidigt haben. Über dem Altar die Statue des heiligen Andreas, mehrere Wappen, eine Glocke und das Modell eines Segelschiffs.
Ganz links die Kapelle für die Luftwaffe oder Kapalle der Royal Air Force. Lincolnshire war „Bomber County“ mit mehr als 25 Bomberflugplätzen. Die Kapelle ist dem Erzengel Michael geweiht.
Südwestliches Querschiff:
Blick in das südwestliche Querschiff. Die heutige Fensterrose ersetzt ein älteres Fenster aus den 1330er Jahren. Zwei nebeneinander angeordnete Blätter bilden das Muster des Maßwerks „Bishops Eye“, in welches mittelalterliche Glasfragmente eingelassen sind. Unten sind Lanzettfenster mit Szenen aus der Bibel und dem Leben verschiedener Heiliger.
Direkt unter dem „Bishop's Eye“ steht die Statue von Bischof Edward King (1829-1910), geschaffen von William Blake Richmond (1842-1921), 1915 enthüllt. Die Werkskapelle und Rettungsdienstkapelle, dahinter die Kapelle der heiligen Anna. Die Kapelle mit der Begrenzung aus Sandstein, wurde um das Jahr 1200 für Priester gegründet, um Messen für die Seelen der Menschen zu lesen, die zum Bau der gotischen Kathedrale beigetragen haben. Blick in eine der Kapellen mit Altar und gotischen Blendarkaden dahinter. Informationstafeln zur Jubiläums-Eiche, aus der ein riesiger Jubiläums-Tisch gemacht wurde. Der Tisch aus einem riesigen Eichenstamm steht im südwestlichen Querschiff. Chorschranke bzw. Lettner in der Vierung: Eine Chorwand umschließt den St. Hughs Chor auf allen vier Seiten und schafft so eine Kirche in der Kirche. 1300–1320 entstanden, ist sie in einem extremen Decorated-Style gestaltet. Das gewaffelte Rosettenmuster wird diaper-work genannt. Man vermutet, dass hier islamische Fliesenverkleidungen in Flachreliefs aus Stein umgesetzt wurden. Jeder Zentimeter davon ist mit skurrilen skulptierten Figuren und Köpfen bedeckt. Es haben sich Spuren von roter und blauer Farbe erhalten, die davon zeugen, daß die Chorschranke in den 1330er Jahren farbig bemalt und mit Goldfarbe abgesetzt war. Blick durch das Gitter in den Chorraum. Über den Durchgang zum St. Hughs Chor, befindet sich die 1898 fertiggestelle Orgel vom Orgelbauer Henry Willis (1821-1901), mit über 4000 Orgelpfeifen. Sie ersetzte ein Instrument, das 1826 von dem Orgelbauer William Allen in einem Gehäuse des Architekten E. J. Wilson erbaut worden war. In der Orgel wurde Pfeifenmaterial aus der Allen-Orgel wiederverwendet. Die Orgel war auch die erste Kathedralorgel Englands, deren Windanlage elektrisch betrieben wurde. 1960 wurde die Orgel von den Orgelbauern Harrison & Harrison reorganisiert. Allerdings blieb der Pfeifenbestand von 1898 unangetastet und insbesondere in seiner historischen Intonation erhalten. In den Jahren 1563 bis ca. 1572 war der berühmte Komponist William Byrd Organist und Chorleiter der Kathedrale. Blick durch den Chorraum Richtung Osten Blick durch den Chorraum Richtung Westen mit der Orgel und dem Chorgestühl. In der Mitte das Rednerpult für die Bibel in der Form eines Adlers. Die Tradition der Adlerpulte reicht bis ins Mittelalter zurück. Der Londoner Kunsthandwerker William Burroughs stellte dieses Messingpult im Jahr 1667 her und goss ein identisches Rednerpult für die Kathedrale von Canterbury. Der dreistufige Kronleuchter ist von 1698. Das Chorgestühl wurde 1778 nach Osten erweitert. Der Bischofssitz befindet sich in diesem neueren Abschnitt, der dem Heiligtum am nächsten liegt. Ganz oben auf dem Baldachin befindet sich eine Statue von Christus dem guten Hirten, die einen Hirtenstab und ein Lamm hält. Ein Bischof trägt einen Krummstab, als Symbol des Hirtenstabes. Das mittelalterliche Chorgestühl gleicht einem Theater, mit Schrägsitzen und Klappsitzen. Die höchsten Stände sind Sitzplätze für die Kanoniker. Über jedem Sitz befindet sich eine gerahmte Gedenktafel, die den Ort nennt, an dem sich ein Pfründenbauernhof befand, der den Domherren ein Einkommen verschaffte. Unter dem Ortsnamen steht die erste Zeile eines Psalms Kurz vor dem Hauptaltar befindet sich die Kanzel. Blick zum Hauptaltar mit dem dahinter liegenden Chorabschluss oder Engelschor. Rechts mit der bogenförmigen Überdachung, befindet sich das Grab von Katherine Swynford und ihrer Tochter. Sie war die Mätresse und spätere Ehefrau von John of Gaunt, dem Herzog von Lancaster und Sohn von König Edward III. Zu ihren Nachfahren gehören Henry Tudor, Richard III. und die derzeitige königliche Familie. Auf der linken Seite das Grab von Bischof Remigius, dem Erbauer der normannischen Kathedrale. Blick zum nordöstichen Querschiff, wo sich der Zugang zum Kreuzgang und der Schatzkammer befindet. Zugang zum südlichen Chorschiff. Beide Chorschiffe führen zum Herzstück der Kathedrale im St.-Hughs-Chor und zum Schrein des Hl. Hugh im Engelschor. Das südliche Chorschiff-Tor entstand um 1260. Die Bildhauerarbeiten im Stein zeigen Männer, die Drachen töten, die den Teufel symbolisieren. Auf der linken Seite hängen die toten Drachen kopfüber im Laubwerk – Trophäen, die den Sieg über das Böse verkünden. Arkaden an der Außenwand des südlichen Chorschiffs. Blick in das südöstliche Querschiff. Die beiden östlichen Querschiffe gehen vom St. Hugh-Chor aus und sind wesentlich kleiner als die westlichen Querschiffe. Hier befinden sich 8 farbige Glasfenster von George Hedgeland (1825-1898). Unten rechts fällt Saulus von seinem Pferd, hört die Stimme Christi und bereut seine Taten im Zusammenhang mit seiner Verfolgung von Christen. Er ändert seinen Namen in Paulus und verbreitet künftig die christliche Botschaft. Darüber Szenen aus dem Leben von Jesus. Hier befindet sich das Grab von Robert Grosseteste von 1953, Bischof von Lincoln 1235-1253. Das originale Grab wurde während des Civil War in den 1600er Jahren zerstört. Blick in den, hinter dem St. Hugh-Chor liegenden Engelschor. Hier der Bereich direkt hinter dem Hauptaltar. Details des darüber liegenden Triforiums und des Obergaden. Blick Richtung Westen. Eine steinerne Chorschranke trennt den Engelschor vom St. Hugh-Chor. Das südliche Schiff des Engelschores, genannt „Cantilupe Chantry Chapel“. Durch das Durchbrechen der Südwand des südlichen Chorschiffes, entstanden die Kapellen für John Russell (-1494), Bischof von Lincoln und Lordkanzler unter König Richard III. und John Longland, Bischof von Lincoln (1473-1547) in der Zeit von König Heinrich VIII. Grabkapelle für John Russell, sein Sarkophag, die Glasfenster in der Kapelle und die Wandmalereien von 1956-58 in der Kapelle von Duncan Grant (1885-1978). Grabkapelle von John Longland, Bischof in Lincoln 1521-1547, also in der Zeit von König Heinrich VIII. 1540 befahlt der König die Entfernung wertvoller Bilder und Schreine aus der Kathedrale. Die Statue von Maria mit dem Jesuskind stammt von Aidan Hart (1957-). In dem 800 Jahre alten, farbigen Glasfenstern dahinter, sieht man rechts oben Noah in der Arche. Das große 18 Meter hohe Ostfenster im Mittelschiff des östlichen Chorabschlusses mit der Engelschor. Ursprünglich wurde es 1275 geschaffen und war das erste gotische Fenster mit acht Lanzettfenstern der Welt. Das Glas ist heute viktorianische und wurde 1855 von Ward und Hughes hergestellt. Dargestellt sind Szenen aus dem Leben Christi, aber auch Szenen aus dem alten Testament (unten z. B. Der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies) und dazwischen verschiedene Propheten. Das Grab der Eingeweide von Königin Eleonore von Kastilien (1244-1290), Königin von England. Die Gründung des Engelchors im Jahr 1280 war ein bedeutsames Ereignis in der Geschichte der Kathedrale, mit König Edward I. und Königin Eleonore von Kastilien als Ehrengästen. Zehn Jahre später wurde Eleonore krank und starb auf dem Weg zur Kathedrale. Der König veranlasste die Einbalsamierung ihres Leichnams und die meisten ihrer inneren Organe wurden in dieser Kapelle begraben. Ihr Körper wurde unter einem identischen Grab in der Westminster Abbey in London beigesetzt und ihr Herz wurde in der Kapelle des Blackfriars Priory in London beigesetzt. An der Seite des Grabes sind farbige Reliefs von Wappen. Detail des Grabes mit der Liegefigur der Königin aus Metall. Auf der Seite des nördlichen Chorschiffes, steht der St. Hughs-Schrein. Hugh von Lincoln 1186 in Westminster zum Bischof von Lincoln geweiht. Nachdem ein Erdbeben 1185 die Kathedrale schwer beschädigt hatte, begann Bischof Hugh mit dem Wiederaufbau und der erheblichen Erweiterung in dem neuen gotischen Baustil. Er erlebte jedoch nur noch die ersten Arbeiten am Chor. Hugo wurde 1220 heiliggesprochen und ist der Schutzpatron der kranken Kinder, Kranken, Schuster und Schwäne. 1280 wurden seine sterblichen Überreste in den Engelschor überführt, der als Heiligtum des Heiligen errichtet wurde. Außerdem Sarkophage mit Mitgliedern der Familie Burghersh, mit farbigen Reliefs von Wappen an der Seite. Nördliches Chorschiff: Die beiden Sarkophage hinter dem St. Hughs-Schrein vom Abschluss des nördlichen Chorschiff aus gesehen. Hier ist die Grabkapelle der Familie Burghersh. Sie wurde 1332 von Bischof Henry Burghersh von Lincoln für die Seelen seiner Familie gegründet. Der Sarkophag mit der Liegefigur ist das Grab von Henry Burghersh, Bischof von Lincoln (ca. 1290-1340). Der Sarkophag ohne Liegefigur, ist das Grab seines Vaters Robert, 1. Baron von Burghersh. Die großen Kerzenhalter aus Keramik in der Burghersh Grabkapelle stammen von dem Keramiker Robin Welch (1936-2019). Die „Gilbert Pots“ sind benannt zu Ehren des Heiligen Gilbert von Sempringham, der von 1083-1189 lebte. Der in Lincolnshire geborene und aufgewachsene Gilbert gründete den einzigen englischen Orden von Mönchen und Nonnen. die Gilbertiner genannt. In der nördlichen Außenwand liegt der Bruder des Bischofs, Bartholomäus. Die Liegefigur zeigt ihn als Baron in Rüstung. Zwei Figuren halten das Wappen über seinem Kopf. In der südlichen Außenwand des nördlichen Chorschiffs die Grabkapelle für Robert Fleming, Dekan von Lincoln 1452–1483. Er gründete die Fleming Chantry für seine eigene Seele und für die Seele seines Onkels Richard Fleming, Bischof von Lincoln. Die Figur von Bischof Fleming (ca. 1385-1431) ist zweimal auf seinem Grab abgebildet. Es ist eines der frühesten Memento mori Grabmäler des Landes, was übersetzt bedeutet „Sei dir der Sterblichkeit bewusst“. Oben ist er bei voller Gesundheit und Kraft und trägt die Robe eines Bischofs. Unten ist er ein verwesender Leichnam. Auf der nördlichen Seite der kleinen Vierung bei den östlichen Querschiffen, das neugotische Grabmal von Christopher Wordsworth (1807-1885), Bischof von Lincoln. Blick durch das nördliche Chorschiff Richtung Chorabschluss mit der Grabkapelle der Familie Burghersh und den Gilbert Pots. Eine der zahlreichen Grabplatten im Boden der nördlichen und südlichen Chorschiffe. Bei vielen der anderen Steinplatten zeigen sich nur noch die flachen, eingeschnittenen Umrisse der ehemals vorhandenen Messingfiguren. Sie wurden während des Civil War von Soldaten des Parlaments herausgebrochen und eingeschmolzen, um Waffen herzustellen. Trondheim Säule: An der Ecke des nordöstlichen Querschiffs - gegenüber auch beim südöstlichen Querschiff - befindet sich eine Säule mit gewundenen Blattformen, sogenannten Crockets, die eine innere Säule schmücken. Ähnliche Pfeiler befinden sich in der Nidaros-Kathedrale in Trondheim, Norwegen. Dies deutet darauf hin, dass möglicherweise dieselben Steinmetze im frühen 12. Jahrhundert diese Säule gefertigt haben. Im nordöstlichen Querschiff, neben der Trondheim-Säule, befindet sich die Tür zur Schatzkammer. Die Tür ist aus Holz mit schmiedeeisernen Beschlägen. Darüber Wandmalereien vom venezianischen Künsterl Vincenzo Damini (ca. 1700-1749) von 1728. Er übermalte damals die schlecht erhaltenen, mittelalterliche Wandmalereien mit der Darstellung von normannischen Bischöfen. Dargestellt sind die Bischöfe allerdings im Habit des frühen 18. Jahrhunderts. Der Abschluss des nordöstlichen Querschiffs. Nachbildung des Exemplars der Magna Carta von Lincoln. Das Original wird im Tresor des Lincoln Castle ausgestellt. Es gibt nur noch 4 Exemplare der Magna Carta von 1215. 2 in der British Library, eines in der Kathedrale von Salisbury und dieses hier in Lincoln. Blick durch das nördliche Seitenschiff Richtung Westen. Weitere nicht näher bestimmte Innenaufnahmen: Stationen des Kreuzweges geschnitzt aus Holz unter spitzbogigen Blendarkaden. Blick in eine Kapelle mit einer Säule in der Mitte. An der Wand ein kostbar besticktes goldfarbenes Altartuch. In der Mitte Christus Pantokrator, umgeben von musizierenden Engeln. Blick in ein Schiff mit mehreren Altären, die durch halbhohe Mauern mit spitzbogigen Arkaden abgeteilt sind. Grabkapelle an der Wand mit farbigen Wappen, Altar Unbestimmte Grabkapelle mit Holzkreuz. Geschnitzter Stuhl aus Holz in dieser Grabkapelle. Epitaph mit Intarsien aus Halbedelsteinen für Henry Wollaston Hutton und seine Frau, ca. 19. Jahrhundert. Flügelalter, Triptychon. Malerei auf Holz mit Verkündigung und zwei Heiligen. Neugotischer Sarkophag des Malers William Hilton (1786-1839). Skulptur aus Stein mit Schild „Gehe hin und mache dasselbe“. Informationstafel zur Restaurierung der farbigen Glasfenster. Farbige Glasfenster, ohne Angabe des Ortes in der Kathedrale. Überwiegend Szenen aus dem Alten Testament. Zugang zum Kreuzgang und Kapitelsaal vom nordöstlichen Querschiff aus. Die Kathedrale von Lincoln war kein Kloster, daher gab es außerhalb des Kreuzgangs keine Schlafsäle bzw. Dormitorium für Mönche, und die Geistlichen, die der Kathedrale dienten, lebten in Häusern in Minter Yard. Dennoch gab es genauso viele Gottesdienste wie in einer Klosterkathedrale und der Tag der Geistlichen drehte sich um die 10 Gottesdienste täglich. In der Mitte des Kreuzganges befindet sich eine Rasenfläche und drei Arme des Kreuzganges stammen noch aus dem späten 12. Jahrhundert. Der der Kathedrale gegenüberliegende Arm im Norden, wurde als klassische Kolonnade 1676 erbaut. Er liegt unter der Klosterbibliothek, die von Christopher Wren (1632-1723) erbaut wurde. Blick in den östlichen Arm des Kreuzganges. Gruppe von jungen Musikern, die sich probend im Kreuzgang aufhalten. Das Portal mit zwei Türen aus Holz, mit schmiedeeisernen Beschlägen, welches zum Kapitelhaus führt. Vorraum zum Kapitelhaus. Wenn man sich umdreht sieht man Richtung Kreuzgang eine Fensterrose. Informationstafel. Blick in das Kapitelhaus. Der zehnseitige Kapitelsaal wurde in den 1220er Jahren begonnen. Der einzelne Pfeiler trägt das Steingewölbe, welches aus 20 Rippen besteht, die ein sternförmiges Gewölbe bilden. Die farbigen Glasfenster zeigen Szenen aus der Geschichte der Kathedrale. Kapitelsaal ist der Austragungsort einer jährlichen Zusammenkunft des Kollegiums der Kanoniker. Sie wählen hier jeden Bischof von Lincoln und es ist auch ein beliebter Veranstaltungsort für Konzerte, Vorträge und Ausstellungen. Sitz des Bischofs im Kapitelhaus. Kapitelsaal mit farbiger Beleuchtung. Informationstafel zur Bibliothek, deren Zugang sich in der nordöstlichen Ecke des Kreuzganges befindet. Blick auf den nördlichen Arm des Kreuzganges mit der Bibliothek über den Kolonnaden von 1676. Probende Musiker und Tänzerinnen in rot-goldenen Kostümen. Blick von Norden auf die Vierung der Kathedrale und das nordwestliche Querschiff mit seiner mittelalterlichen Fensterrose „Dean's Eye“. Blick auf den südlichen Arm des Kreuzganges und das nordöstlichen Querschiff. Blick auf die Fassade des Kapitelsaals, vom westlichen Arm des Kreuzganges aus. Südlicher Arm des Kreuzganges mit Deckengewölbe aus Holz. Details des Gewölbes und der Schlusssteine aus Holz. Außerhalb der Kathedrale wieder das Exchequer Gate mit Oldtimern und Männern in historischen Uniformen. Blick auf das Gericht der Pfarrer im Südosten der Kathedrale, aber innerhalb des Minster Yard. Historisches Gebäude an der Priory Gate / Minster Yard. Das Haus ist aus Backsteinen mit gotischer Toreinfahrt und Fenstern, Erker mit Zinnen. Reihenhäuser aus Backstein. Priory Arch. Denkmal für Alfred Lord Tennyson auf einer Grünfläche im Nordosten der Kathedrale. Westfassade und kleiner Glockenturm von St. Peter in Eastgate, eine kleine neugotische Kirche. Die ursprüngliche Kirche aus dem 11. Jahrhundert, wurde im Bürgerkrieg schwer beschädigt, dann im 18. Jahrhundert neu erbaut, bis eine größere Kirche benötigt wurden. Die heutige Kirche wurde 1870 vom Architekten Sir Arthur W. Blomfield (1829-1899) erbaut. Wohnhaus in der Eastgate, unmittelbar vor der Außenmauer des Kreuzganges, der ungewöhnlicher Weise auf der Nordseite der Kathedrale liegt. Auf der Nordseite des Kreuzganges, an der Straße Eastgate, liegt ein kleiner Garten und das Lincoln Cathedral Cafe. Direkt daneben liegt auch der Eingang zur Kathedrale durch das Nordwestliche Querschiff. Gegenüber Eastgate 12, Toreinfahrt mit sanierten historischen Häusern in einem Garten. Historisches Gebäude aus Backsteinen mit Erker, an der Ecke James Street. Historische Häuser im Minster Yard 27. Plastik eines Elefanten, bemalt mit dem Vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci. Parade der Kinetika Bloco, einer wohltätigen Jugendmusik-Organisation. Musiker und und kostümierten Tänzerinnen, die im Kreuzgang vorher geübt haben, ziehen durch das Exchequer Gate auf den Castle Hill. Lincoln Castle: Die Burg wurde von Wilhelm dem Eroberer (1027-1087) im 11. Jahrhundert anstelle einer römischen Festung erbaut. Als Wilhelm Lincoln, eine der größeren Ansiedlungen im Lande, erreichte, fand er ein Wirtschafts- und Handelszentrum der Wikinger mit einer Bevölkerungszahl von 6000 bis 8000 vor. Die Überreste der alten, eingefriedeten römischen Festung, etwa 60 Meter über dem Land, erwies sich als strategisch idealer Ort zum Bau einer neuen Burg. Außerdem lag Lincoln an der Kreuzung mehrerer wichtiger Verkehrswege. Die Arbeiten an der neuen Festung wurden 1068 abgeschlossen. Die Burg diente bis vor Kurzem als Gefängnis und Gerichtsgebäude und ist eine der besser erhaltenen Burgen im Lande. Auf dem Castle Hill wird nach der Musik aus den 1940er Jahren und in der Kleidung der Zeit getanzt und gesunden. Modell der Burg mit Nummern und Legende dazu: oben das East Gate, das Ost-Tor, durch welches man die Festung vom Castle Hill aus betritt. Rechts daneben der Observatory Tower. Darunter das Lincoln Castle und das Gefängnis. Rechts auf der Mauer der Lucy Tower und unten der Lincoln Crown Court. Festungsmauer mit dem Observatory Tower links und dem East Gate rechts. Observatory Tower, ein quadratischer Turm, der eine der zwei Motten (künstlich angelegter Erdhügel mit einem meist turmförmigen Gebäude) überragt. Alte Kanone. Eingang am East Gate. Zwischen den beiden Toren ein Erker vom John of Gaunt's Palace. Dies war das Haus eines Kaufmanns aus dem späten 14. Jahrhundert, welches in der High Street stand und vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre nach und nach abgerissen wurde. Nur der Erker hat sich erhalten und wurde hier im Torhaus montiert. Details des Erkers. Blick zurück auf das East Gate von Innen. Dahinter die Türme der Kathedrale. Plastiken von Drachens vor der Mauer der Festung. Aus Anlass des „1940's Weekend“ tragen die Männer historische Uniformen und bedienen hier einen Imbissstand. Historischer Konzertpavillon. Blick zurück zum East Gate, Konzertpavillon und der Fassade aus Backsteinen vom Lincoln Castle. Dahinter liegt das Gefängnis. Blaskapelle vor dem Lincoln Crown Court. Seit dem Bau des Lincoln Castle fanden hier Gerichtsverhandlungen statt. Ein erstes Gerichtsgebäude wurde 1776 abgerissen. Das heutige Gebäude wurde von Sir Robert Smirke (1780-1867) im neugotischen Stil entworfen und 1823 fertiggestellt. Die symmetrische Hauptfassade ist auf das East Gate ausgerichtet. Der mittlere Teil hat im ersten Stock einen gewölbten Eingang mit drei neugotischen Fenstern. Am Dach sind Zinnen und rechts und links jeweils ein achteckiger Turm. . Historischer Jeep und historisch gekleidete Soldaten. Im Hintergrund die heutige Fassade des Lincoln Castle. Vor dem Bath House an der Festungsmauer die Büste von König George III. Hinter dem Gerichtsgebäude befindet sich das West Gate. Von hier hat man einen Blick auf den West Gate Water Tower, ein Wasserturm von 1911. Er wurde von Reginald Blomfield im Stil des Neubarock entworfen und ist 36 m hoch. Blick auf die Reihenhäuser aus Backsteinen mit kleinen Gärten in der Union Road, an der Westseite des Lincoln Castle. „Castle View“ ein indisches Restaurant, direkt neben dem West Gate. An der Südseite des Lincoln Castle der Lucy Tower. Er ist die zweite Motte dieser Festung. Der ursprünglich ein Stockwerk höhere Lucy Tower beherbergte die aus Holz errichteten Wohnquartiere des Burgbeamten. Der Ost- und ein Westflügel des Turms sind nicht erhalten. Im frühen 19. Jahrhundert wurde der Turm zu einer Begräbnisstätte. Darin liegen noch immer Gräber von Gefangenen, die in der Burg gehängt wurden. Historisches Militarflugzeug vor dem Lincoln Castle. Schaufenster mit Elefanten aus Halbedelsteinen. Straßenmusiker, der mit seinen Bewegungen an Fäden einen künstlichen Ritter bewegt. Straße mit Häusern aus Backsteinen. Schaufenster mit zahlreichen politischen Plakaten aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Bischofpalast Lincoln: Der Ende des 12. Jahrhundert erbaute Palast des Bischofs, wurde im Süden der Kathedrale und unmittelbar südlich der römischen Mauer errichtet, die sowohl die Kathedrale, als auch das Lincoln Castle umfasste. Die Ruinen des Palastes sind über den Minster Yard erreichbar. Der Bischofspalast wurde erstmals in den späten 1150er Jahren von Robert de Chesney (-1166) auf einem Gelände errichtet, das ihm König Heinrich II. geschenkt hatte. Das meiste, was heute noch übrig ist, ist der Palast, der in den 1190er Jahren von St. Hugh of Lincoln und in den 1220er Jahren von Hugh of Wells erbaut und im frühen 15. Jahrhundert von Bischof William Alnwick (-1449) modernisiert und verbessert wurde. Sein Grundriss ist typisch für Bischofspaläste. Es gibt zwei Säle, einer für den privaten Gebrauch des Bischofs mit angeschlossener Kapelle und einer für öffentliche Veranstaltungen – alle von einer hohen Mauer umgeben. Informationstafel mit einer Ansicht der rekonstruierten Gebäude von Süden. Oben der Alnwick Tower, daneben die Alnwick Kapelle. Darunter Richtung Süden die Osthalle, links daneben die große Westhalle. Unten links die Küche. Man betritt den Bereich des Palastes durch diese zwei mit Zinnen bekrönten Torbogen von Osten, direkt neben dem Vicars Court. Alnwick Tower: erbaut in den 1430er Jahren unter Bischof William Alnwick. Dieser Turm verband seine privaten Räume in der Osthalle mit dem öffentlichen Westhalle. Das achtteilige Rippengewölbte im Erdgeschoss diente als Vorraum zwischen der Westhalle und der Bischofskapelle. Rechts die Wand zur ehemaligen Westhalle mit der viktorianischen Bischofskapelle dahinter, gesehen von der Tür zur oberen Osthalle. Informationstafeln zur Kapelle und zur Westhalle. Die Fläche auf der sich früher die große Westhalle befand mit einem Zugang zur Kapelle. Die im Bürgerkrieg zerstörte Westhalle wurde in den 1650er-Jahren zu einer Pferdekoppel, ihre Veranda wurde in eine Remise umgewandelt und an der Westwand wurde ein Stall errichtet. In den 1880er Jahren wurde in den Ruinen der Butter- und Speisekammer am südlichen Ende der Westhalle die Kapelle des neuen Bischofspalastes errichtet. Die Gebäude hinter der Mauer sind Verwaltungsgebäude der Diözese Lincoln. Rechts der Alnwick Tower und im Hintergrund die Südseite Kathedrale. Zugang zur ehemaligen Westhalle.mit gotischen Bögen. Blick auf die Verwaltungsgebäude der Diözese Lincoln. Informationstafel zur Osthalle. Der östliche Hallenblock wurde in den 1190er Jahren von Bischof St. Hugh als privater Teil des Palastes erbaut. Sein Flur befand sich im ersten Stock, dahinter befanden sich sein Schlafzimmer, seine Garderobe und seine Latrine. Sein Haushalt verfügt im Erdgeschoss über sehr ähnliche Räume und die beiden Geschosse waren durch eine Wendeltreppe verbunden. Im 15. Jahrhundert war die große Halle von St. Hughs nicht mehr in Mode. Bischof Alnwick baute oben an den Wänden einen Boden ein und verwandelte das Dach in eine Mansardenunterkunft für seine Mitarbeiter. Die alte Halle im Erdgeschoss wurde zum Keller und der Rest der St. Hughs-Halle wurde zum privaten Speisesaal des Bischofs. Blick von der Osthalle auf den östlichen Giebel der viktorianischen Kapelle mit einem großen Fenster mit Maßwerk. Darunter ein kleiner zugemauerter Durchgang mit Spitzbogen. Rechts der Alnwick Tower und dazwischen die Wand zur Westhalle. Blick nach Norden zur Kathedrale über die Fläche der ehemaligen Osthalle. Blick in die im Süden, unterhalb des Palastes liegenden Gärten, dahinter die Stadt Lincoln. Durchgang in die Küche, im südwestlichen Bereich des Palastes hinter der Kapelle. Informationstafel zur Küche. In der Nähe befand sich die Bäckerei und die Brauerei. Jedes Mitglied des bischöflichen Haushalts erhielt täglich sieben Pints (0,56 Liter) Bier und zwei Pfund Brot sowie seine Mahlzeiten im Saal. In der Küche im oberen Geschoss, wurden die Mahlzeiten zubereitet. Man kann die gekachelten riesigen Kamine oben sehen. Fahrt nach Ely. Blick auf einen Ort mit typisch englischem Kirchturm.
-
Ely: die Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern, liegt 25 km nordöstlich von Cambridge. Die Stadt wurde 673 von der Königin Eliensis Etheldreda (-679) durch die Gründung einer Abtei gegründet, die 870 von den dänischen Invasoren zerstört wurde und mehr als 100 Jahre nicht wieder aufgebaut wurde. Etheldreda wurde später heiliggesprochen, da ihr Leichnam nicht verweste. Man bettete sie in einen Marmorsarg um, der als wundertätig beschrieben wurde und viele Pilger anlockte. Als die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer 1066 in England einfielen, war Ely eine Zufluchtsstätte der Angelsachsen. Schon im Jahr 1109 wurde eine Diözese Ely gegründet. Stadtplan „Prince Albert“, Pub in der Silver Street. Blumen und rankender Efeu. Schild an einem Pub „The Malt and Hops“. Historisches Haus mit 2 Erkern, im Obergeschoss ein Fachwerkbau. Häuser in der Nähe der Kathedrale. Der Pub „The Minster Tavern“ von außen und innen. Roter Briefkasten mit einem gestrickten Aufsatz mit kleinen Puppen. Süßspeise vom Thailänder. Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit oder The Cathedral Church of The Holy and Undivided Trinity: Die Anlage geht auf eine benediktinische Gründung aus dem 7. Jahrhundert zurück. Angeblich war die heilige Etheldedra, die Königin von Northumbria, die Gründerin im Jahr 673 und Äbtissin. Auf einer Anhöhe im damaligen Sumpfgebietder, der Isle of Ely gelegen, wurde die Kirche im Volksmund auch „Ship of the Fens“ genannt, errichtet. Von hier hatten sich die Angelsachsen bis 1071 gegen die Normannen verteidigen können. Unter Wilhelm I. oder Wilhelm dem Eroberer wurde wurde 1083 der romanische Neubau als Abteikirche durch den normannischen Abt Simeon begonnen. Man begann zunächst mit dem Bau des Chores. Erst 1351 wurde die Kathedrale fertiggestellt. Sie ist eine wegen ihres romanischen Kerns und normannischen Grundkonzepts weithin als Musterbeispiel romanisch-normannischer Architektur bekannte anglikanische Kathedrale. Dabei haben ihre Bauelemente in großer Zahl gotische Formen, deren Verwendung hier schon im 12. Jahrhundert begann. Das östliche Querschiff wurde zwischen 1087 und 1093 erbaut. 1109 wurde aus der Abteikirche eine Kathedrale mit einem Abtbischof. Das Langhaus stammt aus dem 12. Jahrhundert, wurde 1180 vollendet und besitzt das höchste Mittelschiff in ganz England. Nach einer Pause von dreißig Jahren wurden unter Bischof Geoffrey Ridel (1174–1189) der Westturm und das westliches Querschiff vollendet. Dem neuen Baumeister gelang es, das in romanischen Formen begonnene Werk unter konsequenter Verwendung frühgotischer Spitzbögen und feinem Zierrat prächtig zu vollenden, ohne eine Disharmonie zwischen Alt und Neu entstehen zu lassen. Der südliche Arm des westlichen Querschiffes endet mit zwei kleinen Ecktürmen. Der nördliche Querhausarm stürzte am Ende des 16. Jahrhunderts ein und wurde nicht wiederhergestellt. Dadurch wurde die Westfassade asymmetrisch. 1322 stürzte der quadratische romanische Vierungsturm ein und wurde ersetzt durch einen größeren, oktogonalen Vierungsturm. Aufgrund von Dokumenten ist man sich nahezu sicher, dass die Idee zu diesem berühmten Oktogon auf den Sakristan bzw. Küster der Kathedrale, Alanus of Walsingham (-1364) zurückgeht, der damit Eingang in die Architekturgeschichte fand. In der viktorianischen Zeit wurde die Kathedrale umfassend restauriert unter der Regie des Architekten George Gilbert Scott (1811-1878). Grundriss mit dem westlichen Querschiff und dem Eingang oben. Das östliche Querschiff und der Chor unten. Rechts vom rechteckigen Chorabschluss die Lady Chapel. Blick von Westen auf die Kathedrale, über den Park vor dem alten Bischofspalast rechts. Auf dem Weg eine alte russische Kanone. Blick auf die Westseite mit dem Narthex (Vorhalle), errichtet im frühgotischen Stil 1200-1215 im Auftrag von Bischof Eustace. Dahinter liegt der Westturm. Er wurde im späten 14. Jahrhundert fertiggestellt, durch die Ergänzung eines bestehenden normannischen Turms. Rechts das noch erhaltene normannische südwestliche Querschiff. Das identische Querschiff auf der nordwestlichen Seite war im Mittelalter eingestürzt. Eingang zur Vorhalle mit gotischem Portal und spitzbogigen Blendarkaden. Links oben eine der Statuen von Sean Henry (1965-) – ein Mann mit Tasse, die in und um die Kathedrale ausgestellt werden. Details des Giebels der Vorhalle mit Zinnen. Dahinter die Türme des südwestlichen Querschiffs und die Geschosse des Turms im Westen. Rundgang im Uhrzeigersinn um die Kathedrale: Nordwestliche Seite der Kathedrale mit den Resten des eingestürzten nordwestlichen Querschiffs und dem dahinter liegenden Langhaus. Detail der Nordseite der Galiläa-Vorhalle. Blick auf das Langhaus mit dem östlichen Querschiff und der links daneben liegenden Lady Chapel oder Marienkapelle. Oktogonaler Vierungsturm. Überlebensgroße Statue von Sean Henry auf der Nordseite mit einem sitzenden Mann mit Aktentasche von 2016. Blick von Norden auf den Westturm und das eingestürzte nordwestliche Querschiff. Nordseite der Kathedrale, Lady Chapel oder Marienkapelle, östliches Querschiff und Vierungsturm. Auf dem Rasen Statuen von Sean Henry: Stehender Mann und stehende Frau von 2019. Oktogonaler Vierungsturm mit 25 m Durchmesser von Alanus of Walsingham. Im Inneren steht das Oktogon auf 8 Steinsäulen. In 43 m Höhe befindet sich innen ein Sterngewölbe. Unter dem Dach des Langhauses kleine Rundbögen mit Köpfen und Fratzen. Normannische Nordfassade des nordöstlichen Querschiffs und Westfassade der Marienkapelle. In dem Winkel dazwischen haben sich einige alte Gräber erhalten. Die Marienkapelle ist die größte in England, fertiggestellt 1349. Das große, fast die gesamte Nordseite einnehmende Fenster, war einst mit bunten Glas verziert, welches 1541 nach der Auflösung des Klosters zerstört wurde. Ostseite der Kathedrale: Marienkapelle mit großem Fenster auf der Ostseite und dem Blick auf die Nordseite des geraden Chorabschlusses aus dem 13. Jahrhundert. Blick auf Nordostseite des Vierungsturms. Südseite der Kathedrale: Südfassade des normannischen östlichen Querschiffs mit einer Sonnenuhr. Blick auf die, hinter einer Mauer liegende Südseite der Kathedrale. Oktogonaler Vierungsturm von Süden. Blick von Süden: das südwestliche Querhaus unten romanisch bzw. normannisch, darüber frühgotisch. Der Obergaden des Langhauses romanisch bzw. normannisch. Die Mauer rechts führt entlang der Straße The Gallery. Romanisches bzw. normannisches südwestliches Querschiff mit zahlreichen Details. Blendarkaden und Öffnungen reihen sich in 5 Etagen übereinander. An den Ecktürmen sind es 7 Etagen. Im unteren Bereich das berühmte englische Waffelmuster (diaper-work) und zahlreiche Köpfe und Fratzen. Auf der Südseite der Kathedrale, von einer Mauer umgeben, befindet sich ein kleiner Garten. Hier befand sich früher der Kreuzgang. Maulbeerbäume und ihre Früchte. Stengel mit Samenkapseln. Blick Richtung Westen entlang des Langhauses zum Westturm. Blick von Südlsten auf das westliche Querschiff und den Westturm. Wohnhaus direkt neben dem Garten. Inneres: Haupteingang vom Narthex im Westen. Portal mit Spitzbögen, 13. Jahrhundert. Tür aus Holz mit üppigen schmiedeeisernen Verzierungen. Auf dem Boden unter dem Westturm, befindet sich ein Labyrinth. Die Strecke des Labyrinthes ist genauso lang, wie der Turm hoch ist. Südwestliches Querschiff mit einem Taufbecken aus dem 19. Jahrhundert. Blick in die Kassettendecke aus Holz. Die Bögen unten sind noch romanisch bzw. normannisch, weiter oben bereits gotisch. Romanische Blendarkaden im südwestlichen Querschiff. Teil des „Modern Art Trail“ in der Kathedrale, gleich neben dem Taufbecken. 11 m hoch schlängelt sich der „Weg des Lebens“ die Wand hinauf. Die Skulptur aus Aluminium stammt von Jonathan Clarke (1961-). Blick in das Langhaus, welches 1180 vollendet wurde. 12 Joche und 170 Meter lang – das höchste Mittelschiff Englands. Die Holzdecke überspannt eine Breite von fast 15 Metern. Vorne links begrüßt eine Statue des Christus die Besucher. Sie stammt von Hans Feibusch (1898-1998), einem deutschen Juden, der 1933 nach London emigrierte. Die bemalte Holzdecke ist aus viktorianischer Zeit. Sie stammt von zwei Künstlern. Henry Styleman oder Henry L'Estrange Styleman Le Strange (1815-1862) malte die ersten 6 Tafeln und orientierte sich hierbei an der Decke von St. Michael in Hildesheim. Thomas Gambier Parry (1816-1888) malte die letzten 6 Tafeln. Erschaffung Adams, Südenfall, Abraham, Jakob und David, Hochzeit von Maria und Josef, Verkündigung, Geburt Christi. Flankiert werden die Szenen von Darstellungen der Propheten. Blick Richtung Altar (entworfen von Luke Hughes) und Vierung mit Detail des Fußbodens, belegt mit graphischen Mustern und farbigem Marmor. Hinter dem Altar eine neugotische Chorschranke von George Gilbert Scott (1811-1878). Reste romanischer Bemalung an einem der Rundbögen zum Seitenschiff. Blick zurück Richtung Westen durch das Langhaus. Oktogonaler Vierungsturm: eine Struktur aus Holz, Glas und Blei, die auf 8 massiven Steinsäulen steht. Entstanden nach 1322, als der normannische Vierungsturm eingestürzt war. Außerdem entstanden 3 weitere Chorjoche (ca. 1328-1340). Der achteckige Kuppelraum ist so breit wie das Langhaus. Durchmesser 25 m. Über dem unteren Oktogon erhebt sich eine komplizierte achteckige Holzkonstruktion aus Eichenholz von William Hurley (-1354), dem Zimmermann des Königs. Er ließ von den acht Mauerpfeilern, nach dem Prinzip des Hammer-Gerüstes, 16 lange in Dreieckform gefasste hölzerne Träger nach oben führen und die mächtige Holzlaterne tragen. Jeweils zwei dieser Träger ruhen auf einem der acht Pfeiler und tragen zusammen die Last von gut 400 Tonnen. Im Inneren sorgen vergoldete Bemalungen, aufwendige Steinschnitzereien und farbenfrohe Fenster für eine reiche Verzierung. Dieses Sterngewölbe wurde 1335 vollendet. Es hängt in 43 Metern Höhe. Ganz oben an der Spitze der Laterne bildet eine markante Skulptur mit Jesus das Zentrum. Beleuchtet wird dieses Vierungsgewölbe durch allseitig umlaufende Fenster über einer Folge von Blendbögen. Vollendet wurde diese in der ganzen gotischen Architektur einmalige Anlage 1342, unter der Leitung des Sakristan Alanus of Walsingham (-1364). Der heutige äußere Aufbau des Oktogons ist neuzeitlich. 1539 wurde das Kloster von Ely geschlossen, die Kathedrale blieb weitestgehend leer. Nur unter dem Oktogon fanden noch Gottedienste statt. Ende des 18. Jahrhunderts, nach 200 Jahren der Vernachlässigung, war das Oktogon ernsthaft vom Einsturz bedroht. Große Reparaturen verhinderten eine Katastrophe. Die mittelalterlichen „Misericord“-Sitze für die Mönche, wurden an das östliche Ende der Kathedrale verlegt, und der zentrale Raum wurde am Sonntag für Predigten vor den Einheimischen genutzt. Im späten 19. Jahrhundert wurden weitere Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Unter den Fenstern im Oktogon stehen 32 Engel, von Thomas Gambier Parry (1816-1888) gemalt, die Instrumente des Mittelalters spielen. Die Mauern über den Spitzbogen in der Vierung zeigen Skulpturen der 12 Apostel. Blick von der Vierung in den Chor mit der Chorschranke und der Kanzel links daneben. Darüber die Statue eines segnenden Christus. Blick von der Vierung in das nördliche Querschiff. Die Arkaden der Seitenschiffe gehören zu den ältesten Teilen der Kathedrale. Vorne der moderne Altar entworfen von Luke Hughes. An den Seiten hängen Falggen des britischen Militärs. Farbige Glasfenster im nördlichen Querschiff. Blick an die Decke des nördlichen Querschiffs. Die Kathedrale von Ely ist die einzige Kathedrale mit einem offenen Hammerbalkendach aus dem 15. Jahrhundert. Es wird von einer Reihe geschntzter Engel getragen, die Wappenschilde halten. Beide Decken der Querschiffe wurden im 19. Jahrhundert restauriert. Moderne Statue eines stehenden Mannes von 2024 vom Künstler Sean Henry. Kapelle des heiligen Georg im nördlichen Querschiff. Die Kapelle ist die Gedenkkapelle für die gefallenen Soldaten des 1. und 2. Weltkrieges aus Cambridgeshire. Auf den Holztafeln im Inneren sind die Namen von über 5000 gefallenen Soldanten des 1. Weltkrieges genannt. Vor dem Altar Kränze mit den Remenbrance Poppies. Farbiges Glasfenster in der Kapelle mit der Darstellung untr anderem der Kreuzigung und den Heiligen St. Georg und St. Martin. Kapelle des heiligen Edmund im nördlichen Querschiff. Neugotischer Altar aus Stein mit dem segnenden Christus, flankiert von 2 Engeln. Farbiges Glasfenster hinter dem Altar. Reste von Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert haben sich hier erhalten. Blick in das südliche Querschiff über den modernen Altar in der Vierung. Auch hier gehören die Arkaden zu den ältesten Teilen der Kathedrale. Farbige Glasfenster an den Enden des Querschiffs. Mehrere Kapellen sind hier durch sich überschneidende, bogenförmige Blendarkaden abgeteilt. Reste von mittelalterlichen Malereien haben sich an den Kapitellen und Rundbögen erhalten. Blick in die Decke, ein offenes Hammerbalkendach aus dem 15. Jahrhundert. Details einiger Engel. „Noli me tangere“, Skulptur aus Bronze von David Wynne von 1963. Die lateinischen Worte aus der Übersetzung des Johannesevangeliums bedeuten „Rühre mich nicht an“ und sind die an Maria Magdalena gewandten Worte von Jesus nach der Auferstehung. Zurück in der Vierung – Detail der Kanzel aus Stein. Neugotisch mit Statue des heiligen Petrus. Blick von der Vierung auf die neugotische Chorschranke und den dahinter liegenden Chor. Über der Kanzel Skulptur des segnenden Christus von Peter Eugene Ball (1943-) aus dem Jahr 2000. Detail der neugotischen Chorschranke von George Gilbert Scott (1811-1878). Blick in den wieder errichteten Chor aus dem 14. Jahrhundert. Das Lesepult im Chor, hier typisch als Adlerpult gestaltet. Das Chorgestühl stammt aus dem 14. und 19. Jahrhundert. Details des Chorgestühls. Orgel: Über dem Chorgestühl hängt auf der nördlichen Seite die Orgel. Sie geht zurück auf ein Instrument, das im Jahre 1831 von den Orgelbauern Elliot und Hill erbaut worden war. Das Orgelgehäuse stammt von 1850. 1908 wurde von den Orgelbauern Harrison und Harrison unter Wiederverwendung von Pfeifen aus der Vorgängerorgel, ein neues Instrument konstruiert. Die Orgel wurde mehrfach restauriert. Im Zuge der Gebäuderestaurierung in den Jahren 1999–2000 wurde die Orgel ausgebaut und durch die Orgelbaufirma Harrison und Harrison umfassend restauriert und erweitert. Details des Fußboden mit Ornamenten und Wappen auf den Fliesen. Blick zurück in die oktogonale Vierung und die Chorschranke von innen. Blick durch den Chor mit Chorgestühl Richtung Westen. Blick in das Fächergewölbe und Netzgewölbe des Chores. Unter Bischof Hugh von Northwold wurde der polygonale romanische Chor abgebrochen und ab 1234 durch den heutigen sechsjochigen gotischen Chor ersetzt, vollendet 1252. Sein rechteckiger Abschluss ist für die englische Gotik typisch. Alle Arkaden haben mit Maßwerk verzierte Spitzbögen, die Fenster der Obergaden ebenfalls Spitzbögen, die der Emporen und Seitenschiffe überwiegend abgeflachte Rundbögen, wie sie andernorts erst in der Spätgotik auftauchen. Hochaltar: Der Hochaltar befindet sich heiligsten Bereich der Kathedrale, dem Presbyterium. Hier befand sich ursprünglich der Schrein der heiligen Etheldreda, die das Kloster 673 gründete und deren Schrein über Jahrhunderte Pilger anzog. Der Schrein selber wurde während der Reformation zerstört. Hinter dem Altartisch befindet sich ein Retabel aus Marmor, das von George Gilbert Scott, dem Architekten der viktorianischen Restaurierung in Ely, entworfen wurde. Die Alabasterfiguren in 5 Tafeln zeigen die Ereignisse der Karwoche vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zu seinem Tod am Kreuz. In der Mitte das letzte Abendmahl. Im südlichen Seitenschiff befindet sich der Zugang zum ehemaligen Kreuzgang. Tür aus Holz mit schmiedeeisernen Beschlägen. Das romanische Portal aus Barnack-Kalkstein stammt aus dem frühen 12. Jahrhundert. Im Tympanon Christus in der Mandorla. Ursprünglich war das Portal bemalt. Auf beiden Seiten kunstvoll dekorierte Säulen mit Flechtwerk und floralen Motiven, sowie Bestien, die an die Wikingerzeit erinnern. Ganz außen auf der einen Seite Tierkreiszeichen und auf der anderen Seite menschliche Aktivitäten. 2 menschliche Köpfe direkt unter dem Tympanon. Informationstafel Ovin's Stein: Dieser Stein mit lateinischer Inschrift, stammt aus der sächsischen Zeit, möglicherweise vor 700, und ist die Basis eines Wegkreuzes, das im nahegelegenen Dorf Haddenham gefunden wurde. Es ist das älteste Objekt in der Kathedrale von Ely. Es wurde immer verehrt, nicht wegen seines Alters, sondern wegen der Person, an die es erinnert. Der heilige Ovin (heute Owen) war der beliebte Verwalter der heiligen Etheldreda , die 673 das Kloster in Ely gründete, das später von den Dänen zerstört wurde. Südlicher Chorumgang mit zahlreichen Grabmälern. Epitaph aus Marmor für Bischof Robert Butts (1684-1748). Er war nacheinander Bischof von Norwich und Bischof von Ely. Über einer Schrifttafel eine Büste von ihm. Grabmal von Bischof Joseph Allen (1770-1845). Er war Bischof von Bristol und Ely. Grabmal mit liegender Figur von Sir Mark Steward (1524-1504). Renaissance. Sein Onkel war Robert Steward. Informationstafel. Grabmal mit liegender Figur von Robert Steward (ca. 1526-1570), dem letzten Prior der Abtei Ely und der erste Dekan der Kathedrale von Ely.. Informationstafel. Blick vom südlichen Chorumgang in den Chor. Grabplatte von Humphrey Tyndall (1549-1614), Dekan von Ely 1591-1614 und neben zahlreichen anderen Ämtern auch Präsident des Queen's College in Cambridge. Tyndall war der böhmische Thronfolger, lehnte das Königreich jedoch mit der Begründung ab, dass er „eher der Untertan der Königin Elisabeth sein würde als ein ausländischer Prinz“. Grabmal mit Liegefigur aus Alabaster des Bischofs von Ely Martin Heton (1554-1609). Er war ein erfolgreicher und beliebter Bischof und trat sein Amt an, nachdem Königin Elisabeth I. die Kontrolle über die Vermögenswerte der Diözese übernommen hatte. Er schien die Wiederherstellung der Diözese ohne allzu große materielle Verluste zu bewältigen. Sein kurz vor seinem Tod verfasstes Testament bestand darauf, dass seine Beerdigung „ohne Pomp und Prunk“ erfolgen sollte. „Man Lying on his side“, eine Skulptur aus mit Ölfarbe bemalter Keramik von Sean Henry von 2000. Informationstafel. Barockes Grabmal von Bischof Peter Gunning (1614-1684). Er äußerte sich offen gegen Cromwell und wurde wegen seiner Loyalität gegenüber König Karl I. inhaftiert. Nach der Wiederherstellung der Monarchie wurde er Master des St. John's College in Cambridge. Dahinter ein farbiges Glasfenster. Gotisches Grabmal von John Tiptoft (1427-1470), Earl of Worcester zwischen 2 seiner 3 Frauen. Er war Staatsmann und Richter unter Heinrich VI. und Eduard IV. Als Constable of England war er verantwortlich für viele Todesurteile, die ihm den Namen "Butcher of England" eintrugen. Nach der Wiedereroberung Heinrichts VI. im Jahr 1470 gelang es Tiptoft nicht, mit Eduard IV. und seinen Anhängern zu fliehen. Er wurde von den Lancastrianern gefangen genommen und im Tower von London enthauptet, geächtet und seines Titels beraubt. Auf der Höhe des Hochaltars, kniet „Hedda“, eine mit Ölfarbe gemalte Skulptur aus Keramik von Sean Henry von 2018. Blick in das Gewölbe des gotischen Chores und die Spitzbögen der Seitenwände. Vor der Kapelle von Bischof West ein farbiges Glasfenster. Informationstafel Kapelle von Bischof West: im geraden Abschluss des Chores auf der südlichen Seite gelegen. Die gotische Wand vor der Kapelle zeigt zahlreiche Nischen mit Baldachinen, in denen heute einige Statuen des Künsters Sean Henry stehen. Links unten „Mann mit Kind“ von 2001. Farbiges Glasfenster hinter dem Altar von Ninian Comper (1864-1960) von 1947. Dargestellt ist Christus in Majestät, flankiert vom heiligen Basilius und dem heiligen Johannes Chrysostomos. Auf der rechten Seite der Kapelle befinden sich die Gebeine der 7 frühen Patrone und Wohltäter des Klosters Ely. Nachdem sie zunächst in der Abteikapelle beigesetzt wurden und dann 1154 in Nischen an der Nordwand des neuen Domchores aufbewahrt wurden, wurden sie 1771 nochmal umgebettet. Diese Männer waren Wulfstan (-1023) Erzbischof von York, Osmund (-1050) Bischof von Skare, Æthelstan (-1001), Ælfgar (-1021) und Ælfwine (gest. ca. 1023/1038) – Bischöfe von Elmham, Eadnoth von Ramsey oder Eadnoth I., Byrhtnoth (ca. 931-991). Links wieder Statuen von Sean Henry. Auf der gegenüberliegenden Wand wieder zahlreiche Nischen mit gotischen Baldachinen und einigen Statuen des Künstlers Sean Henry. Auch die Wand mit der Eingangstür ist mit Nischen mit gotischen Baldachinen und Fialen verziert. Blick in das Netzgewölbe mit Flachreliefs. Kapelle der heiligen Etheldreda in der Mitte des geraden Chorabschlusses. Das große farbige Glasfenster im Osten, in der Mitte des geraden Chorabschlusses. Angebracht wurde es während der viktorianischen Restaurierung. Es ist das Werk von William Wailes (1808-1881) und wurde aus dem Nachlass von Bishop Sparke finanziert, der ganz unten links betend zu sehen ist. Das Fenster stellt das Leben Christi dar. Rechts die Wurzel Jesse, Verkündigung, Heimsuchung, Geburt Jesu, Flucht nach Ägypten, Kindermord von Bethlehem. Links die Taufe Jesu, die Versuchung durch den Teufel, Hochzeit zu Kanaa, Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Die Mitteltafel zeigt die letzte Woche seines Lebens von seinem Einzug in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung. In den Fenstern darüber die Auferstehung und Christus in der Glorie. Kapelle von Bischof Alcock (ca. 1430-1500): im geraden Abschluss des Chores auf der nördlichen Seite gelegen. Baubeginn 1488. Die gotische Wand vor der Kapelle zeigt zahlreiche Nischen mit Baldachinen und Fialen, in denen heute eine Statue des Künsters Sean Henry steht. Kerze mit Stacheldraht bzw. Dornenkrone auf dem Altar. Farbiges Glasfenster hinter dem Altar. Liegender Mann, eine mit Ölfarbe bemalte Statue aus Keramik von Sean Henry von 2020 und gotischen Maßwerkbögen. Blick in die Decke der Kapelle mit seinem aufwändigen Fächergewölbe. Vor der Kapelle eine historische Heizung, ein Ofen. Blick in den nördlichen Chorumgang, in dem auch zahlreiche Grabmäler sind. Informationstafel. Gotisches Grabmal aus Marmor von Hugh of Northwold (-1254), ab 1229 Bischof in Ely. Bischof Northwold baute die sechs Joche des 1252 fertiggestellten Presbyteriums, um dort das Heiligtum von St. Etheldedra unterzubringen. Das Werk wurde im Beisein von König Heinrich III. eingeweiht. Das Bildnis des Bischofs ist auf der einen Seite von Schnitzereien eines Königs, eines Bischofs und eines Mönchs und auf der anderen Seite von einer Königin, einer Äbtissin und einer Nonne umgeben. Das Relief zu seinen Füßen zeigt das Martyrium des heiligen Edmund. Ein weiteres gotisches Grabmal mit Resten von Bemalung. Informationstafel Gotisches Grabmal von Bischof William of Kilkenny (-1256) und ehemaliger Lordkanzler von England. Er war auch Botschafter in Spanien, wo er starb. Hier ist nur sein Herz begraben. Gotisches Grabmal von Bischof Richard Redman (-1505). Liegefigur mit gotischem Maßwerk als Dach, verziert mit zahlreichen Wappen. Details des Grabmals. Wendeltreppe mit gotischem Maßwerk direkt neben dem Grabmal. Statue aus Bronze, mit Ölfarbe bemalt, von Sean Henry. „T.B.T.F.“ oder „The bigger the front“ von 2013. Sie steht in einer gotischen Nische am Übergang zur Lady Chapel oder Marienkapelle, die im Norden der Kathedrale liegt. Informationstafel. Marienkapelle oder Lady Chapel: Im 13. und 14. Jarhhundert gewann der Kult um Maria immer größere Bedeutung und so wurden in zahlreichen Kirchen Marienkapellen errichtet. Gebaut von 1321-1349. Der Bau wurde von John of Wisbech (-1349) geleitet. Ursprünglich war der Raum farbenfroh gestaltet mit farbigen Glasfenstern und bemalten Statuen in den Nischen. All dies wurde im 16. Jahrhundert während der Reformation zerstört, die im Einklang mit puritanischen Überzeugungen jede Form religiöser Verzierungen ablehnte. Es sind noch Reste von Farbe zu sehen, und im zentralen Fenster auf der Südseite sind noch Glasfragmente erhalten. Die Figuren in den unteren Nischen wurden unkenntlich gemacht und darüber befinden sich die leeren Sockel, auf denen die Statuen standen. Ab 1566 wurde die Lady Chapell zur Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit und diente den Einwohnern von Ely als Pfarrkirche. Die Wände waren weiß getüncht und die Fenster mit schlichtem Glas gefüllt, so wie man es heute noch sehen kann. An der Schmalseite die Statue der „Blessed Virgin Mary“ von David Wynne (1926-2014) von 2000. Blick vom nördlichen Seitenschiff in das Langhaus und das südliche Seitenschiff. Gut zu sehen der dreiteiligen Aufriss des romanischen Langhauses mit Stützenwechsel und Emporen. Es herrscht weitgehende Gleichwertigkeit der beiden unteren Geschosse. Die Bögen der Empore sind allerdings zweigeteilt. Der Obergaden oder Lichtgaden ist fast gleich hoch hat aber drei Bögen. Die Anzahl der Bögen pro Joch nimmt also von unten nach oben immer weiter zu. Die vom Boden aufsteigenden Dienste sind nur von zwei schmalen Horizontalbändern umkröpft. Blick in das nördliche Seitenschiff. Die Seitenschiffe sind mit Kreuzgradgewölben gedeckt. Rechts wieder eine historische Heizung, ein Ofen. Ein Tontechniker an seinem Pult, ein Konzert vorbereitend. Grabmal von Henry Caesar (ca. 1562-1636), Dekan von Ely. Weitere Skulpturen von Sean Henry „Ursula's Dream“ von 2001 aus Bronze, Gips, Holz, mit Ölfarbe bemalt. Neugotisches Grabmal von Bischof James Russell Woodford (1820-1885). Einige farbige Glasfenster aus der viktorianischen Zeit, die nicht genau lokalisiert werden konnten. Die meisten zeigen Könige, unter anderem auch Königin Victoria, Bischöfe, Äbtissinnen und Heilige, sowie Szenen aus dem Leben Christi. Drei der Fenster sind Rundbogenfenster und ggf. noch aus dem Mittelalter. Tischaufsatz aus Holz, dessen Front mit Abbildungen aus dem Leben und Martyrium eines Heiligen bedeckt ist. Die Abbildungen sind hinter Glas. Zwei Altardecken oder Wandbehänge mit religiösen Szenen. Prioratshaus, Internat der King's School: erbaut 1524 im Auftrag von Prior Crauden. Im Erdgeschoss kann man Spitzbogenfenster mit Maßwerk aus dem 14. Jahrhundert sehen. Auf der anderen Seite des Gebäudes gibt es sogar Gewölbe aus dem 12. Jahrhundert. Südlich der Kathedrale und östlich des Prioratshauses liegt ein Park. Ein Weg führt entlang der Grenze zum Cherry Hill Park. Von hier hat man einen Blick auf die Südseite der Kathedrale. Blüten der Großen Klette (Arctium lappa). Blick vom Cherry Hill Cottage auf die Südseite der Kathedrale. Cherry Hill Cottage Die Freifläche vor dem Cherry Hill Cottage und der Ely Porta. Am südwestlichen Ende des Parks um die Kathedrale, befindet sich die 1397 begonnene Ely Porta. Sie wurde von Prior Poucher (1401-18) fertiggestellt. Es handelt sich um einen großen rechteckigen, dreistöckigen Gebäudeblock. Ein Teil des Gebäudes beherbergte das Gefängnis des Bischofs und wurde als solches bis zum Ende des 17. Jahrhunderts genutzt, als das Gefängnis in die Lynn Road verlegt wurde. Das Gebäude bildete ursprünglich einen Komplex mit mehreren Gebäuden, um ein Kloster zu errichten . Später wurde es Teil einer Schule. Seit 1537 ist die Schule im Besitz der Krone. Sie trägt heute den Namen King's School. Blick von innen auf das Tor. Der Durchgang im Tor, getrennt für Fußgänger und Fahrzeuge. Das Tor von außen. Podest eines Bogens mit einem verwitterten Kopf. Von der Ely Porta Richtung Norden, zurück zur Kathedrale auf der Straße „The Gallery“. Die Bauten mit Strebepfeilern entlang der Straße stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Das Gebäude am Ende der langen Anbauten mit den drei Schornsteinen, wurde im 14. Jahrhundert von Prior Crauden als Ort zur Bewirtung der zu Besuch kommenden Könige erbaut. Das war damals König Edward III. und Königin Philippa. Die Anbauten davor stammen aus dem 19. Jahrhundert. Alter Bischofspalast: Die Bischöfe von Ely besaßen viele Paläste. Der Alte Palast vor der Westfassade der Kathedrale ist im Wesentlichen der Palast, der von Bischof John Alcock erbaut wurde, der von 1486-1500 Bischof war. Das Gebäude hat viele Veränderungen erfahren, einige Teile gingen nach der Reformation verloren. Eines der Merkmale des Gebäudes ist die lange Galerie, die neben dem Palace Green verläuft und 1549–50 von Bischof Goodrich erbaut wurde. Ab 1581 stand der Palast für viele Jahre leer, wurde als Gefängnis zweckentfremdet. In der Zeit von 1667-1675 war Benjamin Laney Bischof. Er trug viel dazu bei, den alten Palast wiederherzustellen und ihn in eine schöne Residenz mit Garten umzuwandeln. Bis zu 1941 war es Residenz der Bischöfe. Danach waren hier verschiedene Institutionen untergebracht. Seit 2012 ist es das Oberstufenzentrum der Schule King's Ely. Sacrist's Gate: erbaut 1325-1326 unter Alan de Walsingham in der High Street. Es diente als Eingang zu den Gebäuden der Sakristei. St. Mary's Church: Die Kirche wurde überwiegend im 13. Jahrhundert erbaut und im Jahr 1950 unter Denkmalschutz gestellt. Die Marienkirche war eine von zwei Pfarrkirchen, die andere war die der Heiligen Dreifaltigkeit. Es handelt sich um ein elegantes und leichtes Gebäude aus der Zeit von Bischof Eustachius (1197–1215). Es ist wahrscheinlich, dass es sich um den Wiederaufbau einer ursprünglichen Kirche handelte, über die nur wenig bekannt ist, aber höchstwahrscheinlich war es wesentlich früher als die Kathedrale selbst. Die Kirche selbst wurde 1876 umfassend renoviert. Der Friedhof, der die Kirche umgab, war einst Schauplatz berüchtigter Auferstehungsbewegungen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Friedhöfe wie St. Mary's überfüllt und neue Bestattungen waren manchmal ziemlich flach, und es war leicht, den Leichnam wieder auszugraben. Charles Fowler und Johnson Smith aus Cambridge verdienten Geld damit, kürzlich begrabene Leichen auszugraben, um sie an Anatomieschulen zu verkaufen. Die Angehörigen der kürzlich Verstorbenen waren so besorgt, dass sie auf dem Kirchhof Wache hielten. Durch die Verabschiedung des Anatomiegesetzes 1832 ging der makabere Handel zurück und starb schließlich aus. Der St.-Marien-Kirchhof wird seit 1855 nicht mehr für Bestattungen genutzt. Heute stehen hier nur eine zahlreiche Grabsteine. Narthex der Kirche. Blick in den Narthex zum Eingangsportal mit Spitzbogen. Detail des gotischen Portals Blick in die dreischiffige Kirche Richtung Chor mit dem Altar. Blick vom Seitenschiff in das Langhaus, durch die Spitzbogen mit runden Säulen. Farbiges Glasfenster, ca. 19. Jahrhundert in einem Seitenschiff. Darstellung von Christus, dem heiligen Edmund und der heiligen Etheldedra. Altar im südlichen Seitenschiff aus Marmor mit der Kreuzigung, flankiert von zwei Engeln. Blick durch das Langhaus Richtung Westen. Kissen mit der Geburt Christi, Engeln und zahlreichen Tieren in einer Art Patchwork. Oliver Cromwell's House: Das Familienhaus von Oliver Cromwell, steht direkt neben der St. Mary's Kirche und wurde bis 1986 als Pfarrhaus genutzt. Cromwells Familie lebte hier von 1636-1646. Nur die Küche stammt noch aus der Zeit um 1215, der Rest des Hauses wurde später gebaut. Seit 1988 gehört das Haus der Stadt Ely und wurde für Touristen geöffnet. Dieses Haus des ehemaligen Lordprotektors ist neben Hampton Court sein einziger noch existierender Wohnsitz. Direkt daneben liegt der Thomas Parson's Square: Thomas Parsons war im 15. Jahrhundert ein wohlhabender Einwohner von Ely, der diese Häuser für die älteren Armen von Ely zur Verfügung stellte und eine Wohltätigkeitsorganisation gründete, um sie auf Dauer zu erhalten. In den frühen 1840er Jahren entwarf George Basevi (1794-1845), einer der führenden Kirchenarchitekten seiner Zeit, für Parsons Charity einen offenen Innenhof mit Armenhäusern in der St. Mary's Street. Hier befand sich einst der Sextry Barn, einer der größten mittelalterlichen Zehntscheunen Europas. Seine Armenhäuser, die jetzt in Thomas Parsons umbenannt wurden, bieten immer noch Wohnungen für bedürftige ältere Menschen in Ely. Straße mit historischen Häusern – Bruchstein und Fachwerk. Kleine gotische Blendarkaden an einer Häuserwand. Blaue Lobelien (Lobelia erinus), Polster aus blauen Blumen. Blüte einer dunkelroten Stockrose. Abwasserrohne an einer Außenwand – fast ein Kunstwerk.
-
Cambridge: berühmte Universitätsstadt mit etwa 125.063 Einwohnern, davon etwa 24.500 Studenten. Allein 31 Colleges prägen das Antlitz der Stadt. Die Stadt liegt im Osten England, etwa 30 km südwestlich von Ely und 80 km nordöstlich von London. Bereits zur Zeit der Römer war die Gegend besiedelt. Nach dem Rückzug der Römer wurde das Gebiet um den Castle Hill von den Angeln erobert. In angelsächsischen Chroniken wird die Siedlung „Grantebrycge“ genannt, der erste Hinweis auf eine Brücke in Cambridge über den Fluss Cam. Im Jahr 875 wurde in den angelsächsischen Chroniken von der Ankunft der Wikinger berichtet, was zu einem lebhaften Handel und dem schnellen Wachstum der Stadt führte. Während dieser Zeit verschob sich das Stadtzentrum vom Castle Hill am linken Flussufer hin zur heutigen Quayside auf der rechten Flussseite. Nach dem Ende der Wikinger-Epoche erlangten die Sachsen kurzzeitig die Macht in Cambridge zurück. Zwei Jahre nach der normannischen Eroberung Englands ließ Wilhelm der Eroberer am höchsten Punkt der Stadt Cambridge Castle errichten. Der Name der Stadt änderte sich in den folgenden Zeiten immer wieder bis zum heutigen Cambridge. Der Fluss Cam wird auch heute manchmal noch als Granta bezeichnet. Stadtplan: etwa bei Nr. 19 liegt das Christ's College, Nr. 33 King's College, Nr. 51 Jesus College, Nr. 42 St. John's College, Stadtplan vom Stadzentrum Modell des Zentrums der Stadt für Blinde. In der Mitte unten der Market Hill mit der Kirche Great St. Mary's und der Guildhall. Oben links das King's College, oben rechts das Trinity College. Neugotische Wesley Methodist Church an der Gabelung der King Street mit der Short Street. Sie wurde 1913 begründet für junge methodistische Studierende. Sie ist nach John Wesley benannt, einem Begründer des Methodismus. Lustiger Kopf einer Puppe mit Schiebermütze in einem Schaufenster. Park mit einem Kirchturm im Hintergrund. Market Hill im Zentrum der Stadt und seit der Zeit der Angelsachsen Marktplatz. An der Ecke der Guildhall steht diese bunte Skulptur. An der Südseite des Platzes die Guildhall bzw. das Rathaus der Stadt Cambridge. An dieser Stelle befanden sich über die Jahrhunderte die unterschiedlichsten Gebäude. Als das alte Zunfthaus den Anforderungen des Rates nicht mehr genügte, wurde das aktuelle Zunfthaus errichtet. Der Entwurf im neogeorgianischen Stil stammt von Charles Cowles-Voysey (1889-1981). Es wurde 1939 fertiggestellt. Auf seiner Rückseite im Erdgeschoss befindet sich heute auch die Touristen-Information. Am Balkon das Wappen von Cambridge mit Seepferdchen und Schiffen, was an die Zeit vor dem 17. Jahrhundert erinnert, als Cambridge noch vom Meer aus erreichbar war. Auf der Westseite von Market Hill befindet sich die Kirche Great St. Mary's, die Universitätskirche von Cambridge. Haupteingang und Turm liegt an der Straße King's Parade, gegenüber dem King's College. Die Kirche wird erstmals 1205 in einem Bericht erwähnt. Die Fundamente der Kirche stammen möglicherweise aus dem Jahr 1010, aber die Kirche wurde 1290 durch einen Brand größtenteils zerstört, den man damals der jüdischen Bevölkerung zuschrieb. Die Synagoge wurde daraufhin geschlossen und die Kirche wieder aufgebaut. Das heutige Gebäude wurde zwischen 1478 und 1519 errichtet, der Turm wurde erst später, im Jahr 1608, fertiggestellt. Blick vom Marktplatz auf die Ostseite, den Chor der Kirche. Nordseite der Kirche. Rote ehemalige Telefonzellen stehen neben der Kirche. Blick von Süden auf das Kirchenschiff und das südliche Portal. Der Turm mit dem südlichen Eingang. Eingangsportal auf der Südseite von 1888 in neugotischen Stil. Das Eingangsportal auf der Westseite, unter dem Turm mit spätgotischen Formen. Die Uhr der Universität von Cambridge über dem Westportal. Inneres: Blick Richtung Osten durch das Langhaus zum Altar. Die Kirche ist im späten Perpendicular Style (der dritte und letzte Stil der englischen Gotik) erbaut. Die Decken sind mit Kassetten aus Holz gedeckt. Um einen großen Zuhörerkreis aufnehmen zu können, vor allem bei besonderen Anlässen, wie der Universitätspredigt, deren Besuch Pflicht war, wurden 1735 Galerien eingefügt. Über den Spitzbögen zu den Seitenschiffen sind farbige Glasfenster von John Hardman & Co, aus den Jahren 1867-1869. Chorraum mit Chorgestühl und links eine der wenigen beweglichen Kanzeln Englands. Rechts eine der beiden Orgeln, die sogenannte „Gemeindeorgel“. Hinter dem Altar ein farbiges Glasfenster mit der Geburt Jesu, der Anbetung der heiligen drei Könige und der Hirten. Darunter die Verkündigung, die Heimsuchung, die Darbringung im Tempel und die Flucht nach Ägypten. Hinter dem Altar eine goldene Skulptur mit Christus Majestas und den Evangelistensymbolen. Sie wurde 1960 von Alan Durst (1883-1970) geschaffen. Chorgestühl mit Kassettendecke aus Holz darüber. Hinter dem Altar ein neugotisches Fenster mit Maßwerk. Blick in eines der flachen Seitenschiffe mit den Kirchenbänken aus Holz. Einige Details der Seitenwangen der Kirchenbänke mit geschnitzten Tieren neben der heraldischen Lilie aus Holz. Blick durch das Langhaus Richtung Westen zum Eingang und der Empore mit der „Universitätsorgel“. Diese Orgel wurde ursprünglich 1698 von der Universität gekauft und von dem berühmten Orgelbauer „Father“ Bernard Smith (ca. 1630-1708) gebaut. Sie wurde im 18. und 19. Jahrhundert erweitert. 1870 wurde von William Hill (1789-1870) ein größerer, aber behutsamer Umbau durchgeführt. Sie ist ein bekanntes historisches Instrument, ein bedeutendes Denkmal für das Werk von William Hill und darüber hinaus wahrscheinlich die größte Sammlung von Pfeifenwerk von Father Smith in einem einzigen Instrument. Direkt beim Eingang steht das Taufbecken von 1632. Schaufenster des Ladens „Department of magical gifts“ mit Figuren und Modellen zum Thema Harry Potter und Hogwarts. Historisches Gebäude am kleinen Guildhall Place, hinter der Guildhall mit Fachwerk, mehreren Erkern und einem achteckigen Erker mit Turmhaube, sowie Flachreliefs. Hier befindet sich heute das Restaurant Honest Burgers. Direkt benachbart Cambridge Corn Exchange: 1874-1875 von Richard Reynolds Rowe (1824-1899) im Stil der Neugotik errichtet. Es wurde aus in verschiedenen Farben gegossenen Ziegeln erbaut. Das Gebäude, das ursprünglich als Getreidebörse errichtet wurde, ist heute ein Konzertsaal und Veranstaltungsort. Details des Mauerwerks. Südöstlich des Marktes, in der St. Andrew's Street liegt die St. Andrew the Great Church. Im Hintergrund der Turm mit Uhr des Gebäudes von Fosters Bank in der Sidney Street. Fassade von Fosters Bank mit dem gestreiften Mauerwerk. Eine Kirche am Standort von St. Andrew the Great wird erstmals im Jahr 1200 namentlich erwähnt. In den Jahrhunderten wuchs die Gemeinde immer mehr und so wurde nach mehreren Vorgängerkirchen vom Architekten Ambrose Poynter (1796-1886) diese Kirche 1842-1843 in neugotischen Stil neu errichtet. Sie hat ein fünfjochiges Mittelschiff mit Seitenschiffen und einem vierstöckigen Westturm. Im 19. Jahrhundert wurde ein Südportal und eine Sakristei hinzugefügt. Der südliche Eingang Wasserspeier Westfassade mit Turm. Detail einer Laterne an der Wand. Nordseite der Kirche. Christ's College: Eines der Colleges der Universität Cambridge. Unter anderem hat hier Charles Darwin studiert. Das College wurde ursprünglich im Jahre 1448 unter dem Namen God's House auf dem Gelände der heutigen Kapelle des King's College gegründet. 1505 gründete Lady Margaret Beaufort, die Mutter von König Heinrich VII. das College auf dem heutigen Gelände neu. Am Eingangstor das Wappen der Tudors und der Gründerin, welches heute auch das Wappen des Christ's College ist. Dabei ist das Fallgitter das Kennzeichen der Familie Beaufort, ebenso der Windhund, der auf einer Seite das Wappenschild hält. Über dem Durchgang eine Statue von Lady Margaret Beaufort. Lageplan des College, mit den traditionellen durchgezählten Höfen. Rechts das Great Gate, der Haupteingang mit dem ersten Hof. Im Hof links die Kapelle. Darüber der zweite Hof mit dem Zugang zu Fellow's Garten. In der Mitte der dritte Hof, links der neue Hof. Blick auf die Häuserfront links vom Eingang. Blick auf Häuserfront die dem Eingang gegenüber liegt mit der sogenannten „Hall“ mit großen gotischen Fenstern. Blühender Blauregen. Links von der Hall die Eingangstür zur Master's Lodge mit dem Wappen der Tudors über der Tür. Blumen. Blaue Passionsblume (Passiflora caerulea) Blick zurück zum Haupteingang. Außenseite der „Hall“. Durchgang bei der „Hall“ in den zweiten Hof. Der Durchgang dekoriert mit der Tudor-Rose und dem Fallgitter und zwei weißen Widdern, die am Haupteingang das Wappen gehalten haben. Blick in das Innere der „Hall“, ein Speisesaal. Diese Halle stammt aus den Jahren 1857-1879 und bietet mit seinen bunten Glasfenstern einen einzigartigen Rahmen für Bankette, Mittagessen und Abendessen. Details der Kassettendecke aus Holz. Lageplan Der Durchgang vom zweiten Hof aus gesehen, mit einem verglasten Erker darüber und einem geflügelten Drachen und einem Windhund als Podeste für den Rahmen des Durchgangs. Blick in den zweiten Hof, gegenüber Fellow's Building und „Fellow's Gardengate“. Dieser Gebäudeflügel stammt aus den Jahren 1640-1642. Es ist ein Gebäude im Renaissancestil und verfügt über originale Treppen und Holzvertäfelungen Detail von „Fellow's Gardengate“. Fellow's Garden: Wie man auf dem Lageplan erkennen kann, nimmt der Garten mit seinen knapp 9.000 qm Fläche fast ein Drittel des College-Geländes ein. Dieser Garten wird von allen Mitgliedern des Colleges genutzt. Der Garten entstand 1825 und spiegelt die Ideen vom Gartenarchitekten John C. Loudon (1783-1843) wieder, dessen Absicht es war, „die individuelle Schönheit von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen in einem Zustand der Natur darzustellen“. Blick auf die Gartenseite vom Fellow's Building und blühenden Hortensien davor. Details von Fellow's Gardengate von der anderen Seite. Links hinter den Bäumen das Blyth Building. Blick auf den Rasen mit Sitzgelegenheiten und Sonnensegel, flaniert von Beeten mit zahlreichen verschiedenen Blumen und Gräsern. Blick zurück zum Fellow's Building. Details von Blumen. Gelbes Jakobs-Greiskraut Weicher Akanthus (Acanthus mollis) Gartentor in einer Mauer, darüber Tudor-Rose und das Fallgitter. Gelbe Schafgarbe Blüte einer Artischocke. Spinne in ihrem tunnelförmigen Netz – Trichternetzspinne. Seerosen. Maulbeerbaum (Morus nigra). Dieser Baum, der aus der Wurzel eines früheren Maulbeerbaums gewachsen ist, der 1608 gepflanzt wurde (dem Geburtsjahr von John Milton, aber ansonsten keine Verbindung zum Dichter hat), wird seit seiner Entwurzelung durch einen Sturm im Jahr 2010 von großen Holzpfosten gestützt. Er liefert noch immer jeden Sommer eine gute Ernte an Maulbeeren; Die Gärtner ernten diese und bringen sie in die College-Küchen, wo daraus Marmelade hergestellt wird. Details vom Baum mit Beeren und Schmetterling. Waldbrettspiel (Pararge aegeria) Kleine Sonnenuhr auf einer Säule Blick in den dritten Hof. Flachrelief mit dem Wappen der Tudors bzw. der Gründerin Lady Margaret Beaufort Schaufenster einer Bäckerei mit Keksen. Laden mit japanischen Spielzeugfiguren. Details verschiedener Spielzeugfiguren. Statue eines britischen Grenadier Guards vor der Touristen-Information. Das historische Innere der Touristen-Information mit einem Klavier, historischen Koffern, Möbeln aus Holz und Holzvertäfelung an den Wänden. St. Edward's Church oder St. Edward King & Martyr Church: die Kirche liegt im Zentrum von Cambridge auf dem Peas Hill. Sie ist Eduard dem Märtyrer gewidmet, der von 975 bis zu seiner Ermordung 978 König von England war. Die heutige Kirche wurde im 13. Jahrhundert an der Stelle einer früheren angelsächsischen Kirche errichtet. Um 1400 wurde die Kirche wieder aufgebaut, wobei der heutige Altarraum und die Bögen des Kirchenschiffs entstanden. 1525 wurde hier die erste „offen evangelische“ Predigt der englischen Reformation gehalten. Daher wird die Kirche manchmal als die „Wiege der Reformation“ bezeichnet. Die heutige Lage der Kirche hinter der Guildhall führt dazu, dass die Kirche etwas versteckt liegt. Blick auf die Ostseite, den Chor der Kirche, an der Straße Peas Hill, direkt gegenüber der Touristen-Information. Das Langhaus mit Strebepfeilern und der Turm im Westen. Um die Kirche haben sich Reste eines Friedhofs mit alten Grabsteinen erhalten. Ein Laden mit Büchern in der St. Edward's Passage, direkt an der Nordseite der Kirche. Senate House in der Trinity Street. Das zwischen 1722-1730 im neuklassizistischen Stil, aus Portland-Stein errichtete Gebäude, wurde früher für Senatssitzungen der Universität Cambridge genutzt, heute hauptsächlich für Abschlussfeiern. Architekt war James Gibbs (1682-1754) und wurde inspiriert vom Architekten Sir James Burrough (1691-1764). Blick zurück auf das Senate House und das daneben liegende Eingangsgebäude des Gonville & Caius College der University of Cambridge. The Old Schools zwischen dem Senate House und der Kapelle des King's College. Das Gebäude beherbergt die Hauptverwaltung der University of Cambridge. Das zweistöckige Gebäude hat eine Quaderfassade mit einer Brüstung darüber. In der Mitte des Hofes eine große Vase aus Bronze. Die Straße King's Parade: Die Straße führt in nord-südlicher Richtung durch das Zentrum von Cambridge. Auf der Westseite der Straße liegt das King's College, daher der Name. Rechts kann man die große Kapelle sehen, dahinter weitere Gebäude des College. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite historische Häuser, zum Teil als Fachwerkbau mit Läden und Kaffeehäuser. King's College: Es wurde im Jahr 1441 von König Heinrich VI. gegründet. Mit einer erneuten Gründungsurkunde von 1443 erweiterte Heinrich VI. seine Pläne: Das neue College sollte nun 70 Scholaren und Fellows beherbergen. Die Studenten wurden jährlich aus den besten Schülern am Eton College ausgewählt, welches 1440 ebenfalls von Heinrich VI. gegründet wurde. Die Collegemitglieder wurden nach dreijährigem Studium auch ohne Universitätsexamen graduiert. Da die ursprünglichen Baupläne nicht für diese Zahl von Studenten ausreichte, entwarf der König einen neuen Plan mit einer Kapelle als Nordseite des Hofs. Durch die Absetzung von Heinrich VI. in den Rosenkriegen wurde der Bau unterbrochen. Die Kapelle wurde als einziger Bestandteil dieses Planes bis 1515 unter den Tudor-Königen Heinrich VII und Heinrich VIII. fertiggestellt. Über ein Jahrhundert waren 5 Könige und 4 Baumeister mit der Errichtung des Kings's College beschäftigt. 1724 entwarf James Gibbs 3 neue klassizistische Seitenflügel um den von Heinrich VI. geplanten großen Hof. Errichtet wurde allerdings nur der westliche Flügel. Erst 1828 wurde der neue Hof, der Front Court, unter William Wilkins (1778-1839) im neugotischen Stil vollendet. 1851 wurde das alte Privileg der Graduierung ohne Examen aufgehoben. 1861 wurde die Zahl der Collegemitglieder um 24 vergrößert. Es wurden auch erstmals Undergraduates von anderen Schulen als Eton zugelassen. Weitere Gebäude wurden errichtet. 1972 nahm das King’s College als eines der ersten Colleges in Cambridge auch Frauen auf. Blick entlang der King's Parade, rechts die neugotischen Mauer von 1822, die die Kapelle, das Eingangstor und den südlichen Gebäudeflügel verbindet und so den großen Hof, den Front Court von der Straße abgrenzt. Hier machen zahlreiche Studenten und Touristen Pause, aber auch Hunde nutzen den Rasen. Das neugotische Eingangstor zum Front Court, 1828 unter William Wilkins entstanden. Vor dem Tor steht ein roter viktorianischer Briefkasten, der älteste von ganz England. Vor dem Tor eine chinesische Reisegruppe. Detail des Turms mit Kuppel mit Uhr und den neugotischen Verzierungen über dem Durchgang mit dem Wappen der Tudors, der Königskröne und der Tudor-Rose. Links vom Eingangstor das Camp einer Protestbewegung gegen den Gazakrieg. Links vom Eingangstor die Schmalseite des Wilkins Building, welches die Südseite des Front Court bildet. Blick durch die Trinity Street, die direkt in die Straße King's Parade, die am Christ's College vorbeiführt, übergeht. Rechts das Eingangsgebäude des Gonville & Caius College, welches das viertälteste College der University of Cambridge ist. Um zur Kapelle des Christ's College zu gelangen, muss man durch die Senate House Passage gehen. Diese schmale Gasse führt zwischen dem Senate House und dem Eingangsgebäudes des Gonville & Caius College hindurch. Drei Tore führen auf das Gelände. Das Tor der Demut, das Tor der Tugend und das Ehrentor. Über einem der Durchgänge ein Turm, ein Erker mit der Skulptur des Gründers Edmund Gonville (-1351) darunter. Details der Fassade vom Eingangsgebäude. Links neben dem Erker John Caius (1510-1573). John Caius war Student, zweiter Gründer und Master des Colleges von 1559 bis kurz vor seinem Tod im Jahre 1573. Das Gate of Honour, das Ehrentor, durch welches die Studierenden nach ihrem Abschluss das College verlassen. Am Turm des Tores eine Sonnenuhr. Haupteingang der Trinity Hall in der Trinity Lane. 1350 gegründet, um neue Anwälte auszubilden als Ersatz für die zahlreichen Opfer der Pest von 1300. Über dem Durchgang das Wappen des fünftältesten College von Cambridge. Schmale Straße zwischen der Bibliothek des Gonville & Caius College links und dem Clare College rechts. Das Gebäude der Bibliothek wurde 1834 von Charles Robert Cockerell (1788-1863) entworfen und wird daher auch Cockerell-Gebäude genannt. In ihm befand sich die Universitätsbibliothek, ein Museum und Büros. Es wurde mehrfach umgebaut. Neugotischer Erker am Gebäude der Bibliothek des Gonville & Caius College. Ein Erker mit Wappen vom Clare College. Gegründet 1326 ist es das zweitälteste College in Cambridge. The Old Schools: Der Westflügel wurde 1864–1867 von Sir George Gilbert Scott (1811-1878) erbautet und 1889–1890 von John Loughborough Pearson fertiggestellt. Hier das Portal in einen Hof, flankiert von zwei achteckigen Türmen mit Zinnen und verziert mit neugotischen Nischen und Fenstern. In den Nischen Statuen von Geistlichen. Details des Portals. Gewölbe, Sterngewölbe im Durchgang des Portals mit der Tudor-Rose und dem Fallgitter. Der nicht für die Öffentlichkeit geöffnete Innenhof, Old Court mit einem großen achteckigen Turm an einem der Gebäudeflügel des Old Schools. Zahlreiche Fahrräder von Studierenden und Mülltonnen. Der Ostflügel des Old Court, erbaut zwischen 1430 und 1457 beherbergt heute eine Druckerei. Stofftier, Affe oder Faultier als Dekoration an der Stoßstande eines Lastkraftwagens. Außerdem eine Figur aus Plastik eines Elefanten, ein Smily und eine Remembrance Poppy. Kapelle des King's College: Die King's College Chapel wird als das Wahrzeichen der Stadt gesehen und ist wohl das berühmteste Gebäude gotischer Architektur in Cambridge. Es wurde über einen Zeitraum von rund 100 Jahren in drei Etappen erbaut und verfügt über das größte steinerne Fächergewölbe der Welt. 1446 Grundsteinlegung und erst 1515 im wesentlich fertiggestellt. In die Bauzeit fallen die Rosenkriege, als Eduard, der Herzog von York, im Jahr 1455 das Recht Heinrichs VI. auf den Thron anfocht. Als Heinrich VI. 1461 gefangen genommen wurde, verließen die Bauarbeiter die Baustelle. Die Fundamente standen und die Ostwand. Man hatte Magnesiakalkstein, aus den collegeeigenen Steinbrüchen, verbaut. 1508 wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und mit dem dunkleren Oolith-Kalkstein gearbeitet. Erst unter den Tudor-Königen Heinrich VII. und Heinrich VIII. wurde der Bau 1515 vollendet. Außen stehen an den 4 Ecken kleine achteckige Türme, auf jeder Seite 11 Strebepfeiler. Die Kapellen innen sind nur eine Etage hoch, so dass sich 12 hohe Fenster auf jeder Seite zwischen den Pfeilern befinden. Auf der Nordseite befindet sich der Eingang. Details des Nordportals mit den darüber befindlichen großen Fenstern. Überall Skulpturen der Wappentiere der Tudors, Widder, Tudor-Rose und Fallgitter. Detail des Nordportals, welches zu einem Narthex, einer kleinen Vorhalle führt. Über dem Spitzbogen das Wappen der Tudors, gehalten von Drachen und Windhund, sowie die Tudor-Rose und gotische Baldachine über leeren Nischen. Blick entlang der Nordseite der Kapelle. Ostfassade zur Straße King's Parade mit großem Fenster. Westfassade mit großem Fenster, Skulpturen von Drache und Windhund, die das Wappen der Tudors halten, flankiert von Tudor-Rosen mit Krone. Auch hier gotische Baldachine über leeren Nischen. Details der Fassade und der Tür aus Holz mit kunstvollen schmiedeeisernen Beschlägen mit floralen Motiven und zwei Köpfen von Engeln. Blick vom Eingang der Kapelle zum Westflügel des The Old Schools. Gruppe asiatischer Schüler. Inneres: Fächergewölbe über dem Eingang im Norden. Fachergewölbe der Kapelle, welches 1512 bis 1515 von John Wastell (-1518) und dem Maurer und Steinmetz Henry Semark (1482- 1534) errichtet wurde. Es ist das größte steinerne Fächergewölbe der Welt. Westseite mit Portal von innen. Farbiges Glasfenster in der Westseite. Dieses Fenster sollte wohl ursprünglich das Jüngste Gericht zeigen, aber der Hof vom Nachfolger Heinrich VIII., Edward VI., lehnt diese bildliche Darstellung ab und so wurde die riesige Fläche mit einfachem Glas gefüllt. Erst 1879 wurde das Thema des Jüngsten Gerichts realisiert. Am unteren Rand des Fensters, links von der Mitte Heinrich VI. mit einem Modell der Kapelle. Über dem Portal in Nischen die Tudor-Rose und das Fallgitter jeweils mit einer Krone darüber. Außerdem das Wappen der Tudor gehalten von Drache und Windhund. Einige der großen farbigen Glasfenster noch vor dem Lettner. Diese Fenster sind die vollständigsten Kirchenfenster, die aus der Zeit Heinrichs VIII. erhalten blieben. Es sind zwölf große Fenster auf jeder Längsseite und jeweils größere Fenster an den Ost- und Westenden. Mit Ausnahme des Westfensters sind sie flämischer Herkunft und datieren aus den Jahren 1515 bis 1531. Vier Fenster sind Werke von Barnard Flower. Gaylon Hone schuf zusammen mit drei Partnern das Ostfenster und sechzehn weitere Fenster zwischen 1526 und 1531. Die letzten vier Fenster stellten Francis Williamson and Symon Symondes her. Das einzige moderne Fenster ist das Westfenster, das der King’s Alumnus Francis Stacey 1879 stiftete. Detail der Dekoration an der Wand unter den Fenstern. 5 gotische Blendarkaden, in denen in der Mitte das Tudor-Wappen steht, gehalten von den flankierenden Skulpturen von Drache und Windhund. In den beiden äußeren Blendarkaden das Fallgitter und die Tudor-Rose mit Krone. Seitenkapelle vor dem Lettner, mit farbigem Glasfenster und einem Altar mit einem Gemälde mit der Darstellung von Maria und dem Jesuskind. Details der Decke in der Seitenkapelle mit Fächergewölbe. Farbiges Glasfenster in der Seitenkapelle. Einer der Altäre in der Seitenkapelle die als Gründerkapelle bekannt ist. Die Wiedereröffnung im Jahr 2010 nach Jahren der Nichtbenutzung und Vernachlässigung wurde vom verstorbenen Pfarrer Ian Thompson inspiriert, der auch Dekan des King's College war. Hier der Meister der Grooteschen Anbetung, ein flämischer Maler, der um 1510 in Antwerpen tätig war. Hier ein Triptychon mit der Geburt Jesu, der Anbetung der Heiligen drei Könige und rechts die Flucht nach Ägypten. Der zweite Altar in der Gründerkapelle stammt von Girolamo Siciolante da Sermoneta (ca. 1521-1580). Die Kreuzabnahme von Jesu, ca. 1568-1572. Ein Geschenk von Frederick, 5. Earl of Carlisle im Jahr 1780. Details zweier runder farbiger Glasfenster: Darstellung des Sündenfalls und Männer in Kleidung der Renaissance an einem gedeckten Tisch. Das Blut des Gekreuzigten als Bad und Erschaffung Evas. Blick auf die Seitenwand der Kapelle mit den großen farbigen Glasfenstern und weiteren Kapellen darunter. Seitenkapelle mit dem Grab aus Mamor des früh verstorbenen John Churchill, Marquis von Blandford (1686-1703). Blick durch die Kapelle Richtung Osten. Der Lettner ist aus Eichenholz und teilt die Kapelle in Vorhalle und Chor. Ursprünglich war hier ein Lettner aus Stein vorgesehen. Der Lettner ist verziert mit Schnitzereien aus der Tudor-Zeit und ein gutes Beispiel für die englische Früh-Renaissance. Finanziert wurde der Lettner als Geschenk von Heinrich VIII. Durch die Initialen und Symbole der Familie Boleyn, kann der Lettner auf die Zeit 1533-1536 (die Dauer der Ehe mit Anna Boleyn) datiert werden. Über dem Lettner die Orgel. Der heutige Orgelkasten wurde von Renatus Harris (1652-1724) zwischen 1686 und 1688 erbaut. Durchgang im Lettner und der dahinter liegende Chorraum mit dem Chorgestühl. Im Hintergrund der gerade Chorabschluss mit dem Hauptaltar. Blick an die Decke mit der östlichen Seite des riesigen Fächergewölbes. Südlich des Durchgangs im Lettner eine geschnitzte Tafel hinter dem Chorstuhl des Provost. Sie zeigt den heiligen Georg, wie er den Drachen tötet. Chorgestühl aus Eichenholz, geschnitzt von den gleichen Künstlern, die auch den Lettner geschaffen haben. Über den Chorstühlen geschnitze Wappen, 1633 gestiftet. Es sind Wappen von verschiedenen Königen und Königinnen, ergänzt links um die Wappen von Eton und der Universität Oxford, rechts Wappen des King's College und der Universität Cambridge. Die Baldachine über den Chorstühlen wurden von 1675-1678 von Cornelius Austin geschnitzt. Blick zurück zum Lettner und der Orgel. Blick auf die Nordwand des Chores. Chorpult, Lesepult oder Ambo von 1515 aus Messing. Auf ihm steht die Figur Heinrichs VI. Auf der Seite, die hier zu sehen ist, sind Rosen eingeschnitzt. Auf dieser Seite werden Lesungen aus dem Alten Testament vorgenommen, auf der anderen Seite Lesungen aus dem Neuen Testament. Das große farbige Glasfenster im Osten. Es zeigt Szenen aus der Passion von Christus und endet mit der Kreuzabnahme. Das Fenster wurde 1540 eingesetzt. Hauptaltar mit dem Gemälde von Peter Paul Rubens mit der Darstellung der Anbetung der Heiligen drei Könige. Das Gemälde entstand 1634 für das Kloster der Weißen Nonnen in Louvain in Belgien. Gotisches Portal zu einer Seitenkapelle. Detail des skulptierten, farbigen Endes des Kielbogens mit der Darstellung einer Königin. Blick in eine Seitenkapelle, als Gedenkkapelle für die Toten des 1. Weltkrieges. Weiterer Kielbogen über einem gotischen Portal zu einer Seitenkapelle. Detail eines Engels, der ein Wappenschild mit drei Kronen hält, am Ende des Kielbogens. Seitenkapelle mit einem Altar mit einem Gemälde der Madonna im Strahlenkranz. Stundenbuch mit Gebeten von Heinrich VI. Paris 1498. Stammbaum von Heinrich VIII. Seine Eltern, der Tudor Heinrich VII. und Elisabeth von York, besigelten durch ihre Heirat das Ende der Rosenkriege zwischen den York und den Lancaster, zwei Zweige des französischen Hauses Plantagent. Die roten Tudor-Rosen oder eigentlich Lancaster-Rosen und die weißen Rosen der York sind bei Heinrich VIII. nunmehr vereinigt. Details des Fächergewölbes im Bereich der kleinen Ausstellung. Informationstafel zur Arbeit der Restaurierung der farbigen Glasfenster. Der Designer muss zunächst einen maßstabsgetreuen Umriss der zu restaurierenden Teile der Glasfenster einschließlich der Beschläge anfertigen. Anschließend bereitet er eine kleine Zeichnung zum gewünschten Thema vor, genannt Vidimus. Davon fertigt er nach Zustimmung des Auftraggebers eine Kopie im originalen Maßstab auf Papier oder Stoff an und legt ihn auf einem langen Tisch in der Werkstatt aus. Entweder das Vidimus oder die ausgelegte Kopie oder beide geben die zu verwendenden Glasfarben an. Anschließend werden Glasstücke zerbrochen und in die entsprechenden Formen zersplittert und auf den Cartoon gesetzt. Werkzeugen und Arbeitsschritte der Restaurierung von Glasfenstern. Südportal, durch welches man die Kapelle des King's College wieder verlässt. Die Dekoration über dem Portal ist identisch mit dem Nordportal. Außerdem rechts vom Portal eine Sonnenuhr. Südseite der Kapelle. Gut zu sehen die Seitenkapellen, die zwischen den Strebepfeilern liegen und wesentlich niedriger sind, damit Raum für die großen Fenster darüber ist. Hier ist auch an den Strebepfeilern gut der Wechsel des Baumaterials in der Baupause zwischen 1461 und 1508 zu erkennen. Unten der Magnesiakalkstein aus den collegeeigenen Steinbrüchen und weiter oben der dunklere Oolith-Kalkstein. Blick über den an der King's Parade liegenden Front Court. Links das Eingangsportal von innen, rechts daneben der Südflügel des Hofes, das Wilkins Gebäude, entworfen von William Wilking (1728-1839), errichtet 1823-1828. Unter anderem befindet sich hier der Speisesaal bzw. die Mensa. Details des Eingangsportals von innen. Schmalseite des Wilkins Gebäudes, gesehen von der King's Parade. Flankiert von zwei achteckigen Türmen mit Zinnen, steht zwischen zwei Erkern eine Statue von Heinrich VIII., mit einem neugotischen Baldachin darüber. Hofseite des Wilkins Gebäudes. Hinter dem großen sechseckigen Erker liegt der Speisesaal. Davor ein Brunnen mit mehreren Statuen aus Bronze, ganz oben ein König. Auf den Dach zwei Türme aus Metall und Glas, als Oberlicht für den Speisesaal. Als Stützen fungieren goldene Drachen und Windhunde, die Wappentiere der Tudors. Der Brunnen. Auf der Westseite des Hofe, dem Eingangsportal gegenüber das Gibbs Gebäude, das zweitälteste Gebäude im King's College, erbaut als Senate House. Architekt war James Gibbs (1682-1754). Grundsteinlegung 1724, Einzug der ersten Bewohner 1732. Das Gibbs Gebäude verbindet die Kapelle und das Wilkins Gebäude. Schaufenster der Läden in der Straße King's Parade: vegane Süßigkeiten Beutel aus Stoff mit Motiven der University of Cambridge. Andenken mit dem Motiv der Kapelle des King's College mit dem Spiegelbild der Kapelle im Hintergrund. The Fox and the Crow, Skulptur eines Fuchses mit einem Raben auf dem Kopf. Hund, Bulldogge Laden für Schlipse, Strumpfwaren und T-Shirs der Universität von Cambridge seit 1864. Schachspiel mit Figuren im Stil des Mittelalters, mit Ritterrüstungen. Laden mit Figuren aus den Harry Potter Filmen, z.B. Lord Voldemort, Dobby und die Schneeeule Hedwig. Laden zum Thema Hello Kitty, der japanischen fiktiven Katzenfigur der Firma Sanrio. Schaufenster mit Halsketten aus Halbedelsteinen. Flache Tiere aus Filz. An der Ecke Bene't Street und Trumpington Street (die Verlängerung der King's Parade) steht die 1867 erbauten Bibliothek des Corpus Christi Colleges Hier befindet sich die Corpus Uhr oder Fronleichnamsuhr. Ihr Schöpfer ist John C. Taylor (1936-), der daran 5 Jahre gearbeitet hat. Es wurden Techniken des 17. und 18. Jahrhunderts mit 6 neuen Erfingungen kombiniert. 2008 wurde sie vom berühmten Physiker Stephen Hawking eingeweiht. Es handelt sich um einen Chronophagen, einen Zeitfresser in der Gestalt einer Art Heuschrecke. Das Zifferblatt der Uhr ist eine geriffelte Scheibe aus Stahl, die mit 24 Karat Gold beschichtet ist. Sie hat einen Durchmesser von etwa 1,5 Metern und hat weder Zeiger noch Ziffern. Sie zeigt die Zeit an, indem sie einzelne Schlitze im Zifferblatt öffnet. Diese sind mit blauen LEDs von hinten beleuchtet. Die konzentrisch angeordneten Schlitze zeigen Stunden, Minuten und Sekunden an. Bewegt wird die Scheibe durch die Beine der Heuschrecke. Sie bewegt ihr Maul und scheint die Zeit zu fressen. Details der mechanischen Uhr. Skulptierter Kopf und florale Motive am Ende der Gurtbögen neben der Uhr. Blick entlang der Gebäude des Corpus Christi Colleges in der Trumpington Street. In Hintergrund der Turm des Pitt Buildings, ein Konferenz-, Tagungs- und Ausstellungszentrum der Universität Cambridge. Auf der gegenüberliegenden Seite der Main Court des 1474 gegründeten St. Catharine's College. Eingangstor des 1352 gegründeten Corpus Christi College mit zwei achteckigen zinnenbekrönten Türmen. Es wurde gegründet, um die Priester zu ersetzen, die der Pest zum Opfer gefallen waren. Fächergewölbe im Eingangstor mit dem Wappen des College. Lageplan des Corpus Christi College. Untern das Main Gate mit dem dahinter liegenden New Court. Blick in den New Court, der 1827 im neugotischen Stil errichtet wurde. Architekt war William Wilkins (1778-1839). Dem Eingangstor gegenüber liegt die Kapelle des College. Alle Gebäude sind von Zinnen bekrönt. Trumpington Street rechts mit der Fassade und dem Turm des Pitt Buildings, ein Konferenz-, Tagungs- und Ausstellungszentrum der Universität Cambridge. Neben dem College die St. Botolph's Church. Sie ist dem heiligen Botolph geweiht, einem Abt aus dem 7. Jahrhundert, der als Schutzpatron der Reisenden gilt. Die Kirche wurde neben dem seit langem zerstörten Südtor des mittelalterlichen Cambridge errichtet, durch das Reisende die Stadt betraten. Das heutige Gebäude stammt größtenteils aus dem 14. Jahrhundert, der Turm aus dem 15. Jahrhundert und ist aus Feuerstein und Bruchstein mit Barnack-Steinverkleidung gebaut. Informationstafeln zur Kirche. Blick in die Kirche Richtung Altar und Chor. Das achteckige Taufbecken von 1637 hat eine prächtige laudianische (orthodoxer Anglikanismus) Holzabdeckung. Mit Kreuzstichen bestickte Kissen in den Kirchenbänken aus Holz. Motive sind Königin Elisabeth II. mit ihren Lebensjahren, die Arche Noah, Tiere oder auch Noten eines Kirchenliedes. Der Chorraum mit dem einzigen mittelalterlichen Lettner, der in einer Pfarrkirche in Cambridge erhalten geblieben ist. Die Malereien stammen allerdings aus der Restaurierung im späten 19. Jahrhundert. Die gewölbte und aus bemalten Kassetten aus dunklem Holz bestehende Decke – hier die Decke im Chorraum. Rechts davor das Lesepult, ein Entwurf vm viktorianischen Architekten Geroge Frederick Bodley (1827-1907), der den Altarraum 1872 wieder aufgebaut hat. Chor mit dem Altar und der viktorianischen, neugotischen Dekoration von den lokalen Künstlern Frederick Leach (1837-1904) und G. Gray. Links an der Wand eine Orgel und ein Gemälde mit Maria und dem Kind, dem Stil Raffaels nachempfunden. An der Seite weitere mit Kreuzstichen bestickte Kissen mit Tiermotiven. Plakat als Werbung für die Gedenkfeier für Thomas Cranmer, die unter königlicher Schirmherrschaft steht, mit einem gemalten Porträt von König Charles III. Blick Richtung Westen zum Eingang. Blick in die Pembroke Street, die von der Trumpington Street abzweigt. Die Reihenhäuser sind meist aus Backteinen und haben die typischen, zahlreichen Schornsteine. Pembroke College: es ist das drittälteste College in Cambridge. Im Jahr 1347 gewährte König Eduard III. der Marie de Saint-Pol, der Witwe des 2. Earl of Pembroke, das Recht, eine neue Bildungseinrichtung an der jungen Universität in Cambridge zu gründen. Durch ein Torhaus betritt man einen ersten Hof, der ursprünglich wesentlich kleiner war und im 19. Jahrhundert erweitert wurde. Die dem Torhaus gegenüberliegenden Halle, wurde 1875/76 von Alfred Waterhouse (1830-1905) neu errichtet, nachdem er die damals bestehende für nicht sicher erklärt hatte. Etwas weiter rechts der Durchblick zum Uhrturm, rechts davon die Schmalseite der neueren Kapelle. Die Kapelle schließt an an den Gebäudeflügel, der zur Trumpington Street geht mit dem Torhaus in der Mitte. Es ist das älteste Torhaus im Cambridge. Durch die Veränderung des Baustils und Baumaterials kann man gut die im 19. Jahrhundert durchgeführte Erweiterung des Hofes erkennen. Im Hintergrund ragt ein Kirchturm mit Baugerüst auf, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht. Uhrturm In dem Gebäude an dem der Uhrturm bzw. Clocktower steht, befindet sich heute die Bibliothek. Am Dach zahlreiche Satteldachgauben. Detail eines bunten Glasfensters von außen. Vor dem Gebäude das Denkmal von William Pitt aus Kupfer. Geschaffen 1819 vom Bildhauer Richard Westmacott (1775-1856). Piit wurde 1783 als Abgeordneter für die Universität Cambridge gewählt. Er war von 1783 bis 1801 und von 1804 bis 1806 Premierminister und starb im Amt im Alter von 46 Jahren. Die Bibliothek von innen: die Ausleihe, Blick in den Lesesaal mit Regalen und Leseplätzen. Ein weiteres der „Red Buildings“, aus rotem Backstein, entworfen von Alfred Waterhouse. Es steht mit der Front an der Trumpington Street, direkt neben der Kapelle. Blick auf die Schmalseite mit großem Erker der großen Halle. Ostseite der Kapelle, Schmalseite der großen Halle und Durchblick zum Torhaus. Inneres der Kapelle: Während des Englischen Bürgerkriegs wurde einer der Angehörigen des Colleges, Matthew Wren (1585-1667), von Oliver Cromwell eingesperrt. Bei seiner Freilassung nach 18 Jahren löste er ein Versprechen ein, indem er seinen Neffen Christopher Wren (1632-1723) mit dem Neubau einer großen Kapelle in seinem früheren College beauftragte. Das Bauwerk wurde 1665 geweiht und an seiner Ostseite in den 1880er Jahren von George Gildert Scott !1811-1878) erweitert. Schwarz-weißer Marmorboden, aufwendige Decke aus Gips, alte Holzarbeiten am Chorgestühl und vor dem Altar ein Boden mit zwei Säulen aus Marmor. Hinter dem Altar ein farbiges Glasfenster. Denkmal für die gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges. Details der Decke aus Gips. Blick zurück auf die Orgelempore aus Holz, die Orgel und das Chorgestühl. Blick auf den Hof mit der großen Halle. Einige Details von Pflanzen in dem gepflegten Garten des Colleges: Kermesbeere (Phytolacca) Blüte einer Dahlie. Blühender Gummibaum, Details der Blüte. Straßenverkäuferin an einem Stand mit Tee, Nüssen und getrockneten Früchten auf dem Markplatz im Zentrum der Stadt. Mitten auf dem Marktplatz ein Sulky, ein einachsiges Pferdefuhrwerk, gezogen von einem gescheckten Pferd. Blick in die enge gebogene, für den Verkehr gesperrte Straße Rose Cres, die vom Marktplatz nach Norden führt. Auch hier stehen Pferde mit kleinen Kutschen zwischen den Tischen der Kaffeehäuser und warten – ungewöhnlich. Laden mit typisch englischen Gummienten, Motiv ist z.B. Elisabeth II. Church of Our Lady and the English Martyrs: in der Lensfield Road im Südosten der Stadt. Große neugotische Kirche, erbaut 1885-1890. Mit 65 m Höhe des Kirchturms ist es das höchste Gebäude in Cambridge. Cintra House: Hills Road 12-18. Regionaler Hauptsitz der Open University. Terrasse aus dem frühen 19. Jahrhundert, Fassade 1860-65 von John Edlin ersetzt. Über dem langen Balkon zahlreiche Medaillons mit Köpfen. Turm der St. Paul's Kirche: 1841 nach Entwürfen von Ambrose Poynter (1796-1886) in der Hills Road erbaut, mit späteren Ergänzungen. Poynters ursprünglicher Entwurf wurde in der ersten Ausgabe des Ecclesiologist von der Cambridge Camden Society 1841 wegen des fehlenden Altarraums, der Verwendung von Ziegeln statt Stein und des schmucklosen Stils des späten 16. oder frühen 17. Jahrhunderts verunglimpft. Royal Albert Homes: Ende des 19. Jahrhunderts entstandener Gebäudekomplex an der Hills Road 120. Subventioniertes Wohnheim für unabhängige ältere Menschen mit bescheidenen Mitteln, die eine enge Verbindung zu Cambridge haben. Blütenstände mit Samen vom Zierlauch, Allium. Der Pub Golden Hind in der Milton Raod in einem typisch britischen Haus aus Backstein mit vielen Schornsteinen. Die riesige Wiese Midsommer Common, am Fluss Cam in Nordosten der Stadt gelegen mit frei laufenden Rindern. Jesus College: Das Jesus College der Universität Cambridge ist 1496 durch Umwandlung eines von John Alcock, einem damaligen Bischof von Ely, gegründeten Nonnenklosters entstanden. Sein gebräuchlicher Name Jesus College leitet sich von seiner Klosterkirche, der Jesus Chapel her, die von 1157 bis 1245 als Benediktinerkonvent St. Mary and St. Radegund errichtet wurde und das älteste Gebäude der Universität ist, das immer noch benutzt wird. Der Standort des heutigen Jesus College lag Mitte des 12. Jahrhunderts außerhalb der Stadt. Seiteneingang von der Victoria Avenue aus. Am Zaun rechts und links von einer Einfahrt, jeweils ein Wappen und ein Wahlspruch. Links das Wappen des Colleges mit dem schwarzen Hahn. Lageplan des College. Rechts die Einfahrt von der Victoria Avenue. Direkt links daneben der Chapel Court. Noch weiter links der First Court. Blick in die Einfahrt, gesäumt von hohen Bäumen. 1885-1886 wurde das Carpenter Building errichtet. Das Gebäude aus rotem Backstein wurde vom Architekten Richard Herbert Carpenter (1841-1893) als Studentenwohnheim geplant. In der Mitte ein zentraler Torhausturm, der manchmal als Boatie Tower bezeichnet wird, da dort der Kapitän des Bootsclubs wohnt. Über der Tordurchfahrt mit Kielbogen einige Wappen und eine Statue der heiligen Radegund, der Schutzpatronin des College, mit einem neugotischen Baldachin darüber. Hinter dem Torhaus liegt der Chapel Court. Hinten links die Jesus Chapel, die dem College den Namen gab. Blick zurück zum Torhaus mit dem Carpenter Building. Kapelle: die Kapelle war vom 12. bis zum 14. Jahrhundert die Klosterkirche des Benediktinerkonvents St. Mary and St. Radegund, was sie als Collegekapelle einzigartig macht. Sie ist damit die älteste Collegekapelle in Cambridge. Ursprünglich war es eine große normannische Kirche. Der Bau begann im Jahr 1157 und wurde um 1245 fertiggestellt. Damals war sie die größte Kirche in Cambridge, etwa 58 Meter lang und hatte ähnliche Proportionen wie eine Kathedrale. Im Jahr 1277 und erneut 1313, stürzte der ursprünglich sehr hohe Glockenturm ein. Im Jahr 1376 zerstörte ein Brand einen Großteil des umliegenden Klosters, verschonte jedoch die Kirche selbst weitgehend. Als das College 1496 von Bischof John Alcock gegründet wurde, waren umfangreiche Bauarbeiten erforderlich, um die ehemalige Klosterkirche für ihre neue Nutzung anzupassen. Teile der Kirche wurden abgerissen und der Rest wurde drastisch verändert. Vor der Kirche eine Plastik aus Metall des Bildhauers Eduardo Paolozzi (1924-2005) von 1994. Einer der Durchgänge im Osten, zum Außenbereich des Colleges. Der Durchgang mit Kielbogen neben der Kapelle in den Klosterhof bzw. Cloister Court. Der Klosterhof ist der einzige Hof, der auf allen vier Seiten von Gebäuden umgeben ist. Details des Durchgangs mit zwei farbig bemalten Wappen in den Ecken, rechts der schwarze Hahn des Jesus College. In den Gebäuden um den Klosterhof haben sich noch Fachwerk und alte Räumlichkeiten erhalten. Treppe in die obere Etage. Wenige gotische Arkadenbögen haben sich erhalten. Dahinter befinden sich jetzt moderne Räume. Der Klosterhof wurde im 18. Jahrhunder mit ihren heutigen offenen Bögen (anstelle von Fenstern) wiederaufgebaut. Blick vom Klosterhof auf die südlich liegende Kapelle mit ihrer Vierung und dem Turm mit Zinnen. Durchgänge und Bögen mit Wappen in den Ecken, haben sich rund um den Klosterhof erhalten. In einem Innenraum an der Wand das königliche Wappen mit Löwe und Einhorn. Der Durchgang mit Kielbogen, der vom Klosterhof in den First Court bzw. ersten Hof führt. Der nördliche Gebäudeflügel, bewachsen von Blauregen. Auf dem Rasen im Hof wachsen viele kleine weiße Pilze, ggf. Hutpilze. Blick auf den südlichen Gebäudeflügel, in dem die Porters Lodge liegt. Der Torturm wurde bei der Gründung des Colleges errichtet, als die verfallenen Prioratsgebäude umgebaut und mit dem heutigen hellroten Backstein verkleidet wurden. In Durchgang haben sich an der flachen Decke aus Holz geschnitze Wappen erhalten. Auf der Außenseite des Torturms, hier befindet sich der Durchgang zur Jesus Lane. Im Süden des Colleges, sind über dem Torbogen die Wappen zusehen. Es sind die Wappen von König Heinrich VII., der die Gründung des Colleges genehmigte, sowie die der Diözese Ely und des College-Gründers Bischof Alcock. In der Nische darüber, unter einem gotischen Baldachin, befindet sich eine neuere Statue von Bischof Alcock. Blick in den Master's Garden neben dem Torturm. In dem südlichen Gebäudeflügel haben sich ebenfalls historische Räumlichkeiten und Baudetails erhalten. Hier steinerne Türrahmen. Treppe in die obere Etage, in der sich Wohnungen für Professoren befinden. Der Treppenaufgang umgeben von Fachwerk. Blick in einen der Flure. Vom Chapel Court gibt es einen Durchgang zur Kapelle. Hier befindet sich ein kleiner Garten, in direkter Nachbarschaft zum Master's Garden. Blick auf Turm und Vierung der Kapelle. Eichhörnchen in einem Maulbeerbaum, eine Maulbeere knabbernd. Blüte des Akanthus. Blaue traubenartige Früchte an einem Baum. Mispel Schuhschaber in Form eines Hasen und eines Dackels. Außenbereich des College mit einer Wiese mit Wildblumen. Mohnblume mit Biene. Südlich des Jesus College in der Jesus Lane die All Saints Church. 1863-1870 im neugotischen Stil errichtet. Der Vorgängerbau wurde abgerissen. Architekt war George Frederick Bodley (1827-1907), ein Schüler von George Gilbert Scott. Zwischen 1869 und 1871 wurden der heutige Turm und die Turmspitze hinzugefügt. Wasserspeier Hinter dem Eingang zur Kirche in der Jesus Lane liegt der Eingangsbereich des Westcott House. Gebäudeflügel mit dem Eingang zum Westcott House. Es ist ein 1881 gegründetes anglikanisch theologisches College. Lageplan, links der Eingangsbereich von der Jesus Lane. Blick durch das Eingangstor in den dahinter liegenden Old Court mit einem Garten. Hauswand mit Hinweisen auf einen Treffpunkt der Quäker. University Pitt Club: ein privater Mitgliederclub der University Cambridge. Erst seit 2017 sind hier auch Frauen zugelassen. 1835 gegründet und zu Ehren von Premierminister William Pitt dem Jüngeren benannt. Seit 1866 befinden sich die Räumlichkeiten des Clubs in diesem Gebäude. Es wurde 1863 als römisches bzw. türkisches Bad von Sir Matthwe Digby Wyatt (1820-1877) entworfen. Sie existierten hier allerdings nur ein halbes Jahr. 1868 erbautes Eingangsgebäude des Whewell's Court Trinity College in der Sidney Road. Details der Fassade: Löwe am Ende des Spitzbogens über der Tür aus Holz mit schmiedeeisernen Beschlägen. Wappen oben an den Zinnen des Daches und an der Ecke der Oberkörper eines betenden Mannes. Etwas weiter rechts ein achteckiger Turm mit neugotischen Formen. Schaufenster einer Konditorei mit Macarons und Torten. Bridge Street mit farbigen Häusern, Läden und einem gelben Bus. The Round Church oder Church of the Holy Sepulchre: sie ist eine von 4 Rundkirchen in England, die noch benutzt wird. Die Kirche wurde um 1130 erbaut und ist damit die zweitälteste Kirche der Stadt. Sie besteht aus einem runden Kirchenschiff, das von einem Umgang umgeben ist. Diese Form ist von der Rotunde der Grabeskirche in Jerusalem inspiriert. Sie hat einen Altarraum mit Nord- und Südschiffen und eine Sakristei im Norden. Über dem Kirchenschiff befindet sich ein Obergeschoss mit einem kegelförmigen Turm. Ein achteckiger Glockenturm steht im Norden der Kirche. Ihre Erbauer war die Bruderschaft vom Heiligen Grab, vermutlich aus Austin. Im 13. Jahrhundert wurde sie zu einer Pfarrkirche. Zu dieser Zeit wurden auch bauliche Veränderungen vorgenommen. Im 15. Jahrhundert wurden die normannischen Fenster durch größere gotische Fenster ersetzt. Über dem Kirchenschiff wurde ein polygonales Glockengeschoss errichtet. Im Jahr 1643, während des Bürgerkriegs wurden zahlreiche Bilder und Skulpturen zerstört. 1841 stürzte ein Teil des Chorumgangs ein. Mit den umfangreichen Reparaturaufgaben und Veränderungen am Bauwerk wurde im 19. Jahrhundert Anthony Salvin (1799-1881) beauftragt. Normannisches Westportal mit drei Säulenreihen, die mit muschelförmigen Kapitellen und Zickzackmustern sowie Zinnen in den Keilsteinen verziert sind. Die Tür aus Holz mit schmiedeeisernen Beschlägen. Der kegelförmige Turm. Kopf aus Stein unter dem mit Metall gedeckten Dach. Fachwerkbau in der Bridge Street 16 a Blick auf den Turm der Parish Church of St. Clement in der Bridge Street. Die heutige Kirche wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und steht vermutlich an der Stelle eines früheren Gebäudes. Die Wände bestehen aus Bruchsteinen mit einigen Ziegeln und Sandsteinverkleidungen. Der von Charles Humfrey entworfene Turm ist aus Zementputz und hatte ursprünglich eine Turmspitze, die 1928 entfernt wurde. Inneres: die Kirche hat die Form einer Basilika, da sie aus 3 flach Schiffen besteht, die beiden Seitenschiffe sind niedriger. Alle 3 Schiffe sind flach gedeckt. Der heutige, aus Ziegeln errichtete Altarraum wurde 1726 hinzugefügt und ersetzte einen früheren, der 1568 abgerissen wurde. Er enthält an der Ostwand ein Wandgemälde von Frederick Laech (1837-1904) von 1872. Es zeigt Christus in der Glorie, umgeben von Engeln und Heiligen. Am Übergang zwischen Bridge Street und Magdalene Street, führt eine Brücke über den Fluss Cam. Rechts die Quayside mit dem Verleih von Booten, sogenannten Flachbooten, „Punt“ genannt, mit denen man sich über den Fluss staken lassen kann. Am gegenüberliegenden Ufer das Magdalene College. Es wurde 1428 als Herberge der Benedikiner gegründet. Details der Gebäude des Magdalene College, die am Fluss liegen. Schmalseite eines Gebäudes aus Backsteinen mit einem Erker und einem Schwan mit Wappen oben am Dach. Giebel mit schachbrettartigem Muster und Wappen, dahinter zwei Schornsteine. Blick von der Brücke in südliche Richtung mit den flachen Booten, die gestakt werden. Blick auf die Magdalene Brücke und den Fluss Cam von der Quayside aus. Die älteste urkundliche Erwähnung dieser Brücke unter dem damaligen Namen „Grantebrycge“ gehen auf das Jahr 875 zurück. Die heutige Brücke wurde 1823 errichtet und 1982 wieder neu erbaut. Lastkraftwagen mit Werbung für „Bidfood“. Sie besteht aus einer Landschaft ganz aus Lebensmitteln, wie Käse, Knäckebrot, Oliven, Himbeeren, Brokkoli und Kapern. Schaufenster einer Schneiderei. Laden „Pocket Watch and Petticoats“ in der St. John's Street 16. Mode und Accessoires aus den fünfziger Jahren. Kleider im Schaufester und ein mit Blumen geschmückter Eingang. Sonnenbrillen in der Form von Herzen im Schaufenster. Blick in die St. John's Street mit dem Eingangsbereich des St. John's College. Dieses College ist eines der reichsten Colleges und hat bisher 11 Nobelpreisträger hervorgebracht. Das College wurde 1511, 2 Jahre nach ihrem Tod, von Lady Margaret Beaufort, der Mutter von Heinrich VII. gegründet. Das Torhaus mit den zwei Türmen wurde 1516 fertiggestellt.. Wappen des Colleges und auch Wappen von Margaret Beaufort. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die Old Divinity School des St. John's College, die alte Theologieschule. Das üppig dekorierte Backsteingebäude wurde 1878–1879 von Basil Champneys (1842-1935) erbaut. Der viktorianische Architekt ahmt hier die frühe Tudor-Architektur nach. Zahlreiche Statuen und helles neugotisches Maßwerk schmücken die Fassade. Heute befindet sich hier ein großer Saal für Tagungen, mehrere Lehr- und Tagungsräume, sowie ein Hörsaal für 180 Studierende. St. John's College: farbig bemaltes Fächergewölbe mit Tudor-Rose und Fallgitter in den Schlusssteinen im Torhaus von 1516. Blick in den ersten Hof auf den, dem Torhaus gegenüberliegenden Gebäudeflügel, erbaut 1511. In diesem Hof befinden sich Wohnungen, Küchen und die Bibliothek. Der Durchgang mit Kielbogen, Tudor-Rose und Fallgitter in den dahinter liegenden zweiten Hof. Über dem Durchgang eine Statue der Gründerin Lady Margaret Beaufort. Links an dem Fallrohr aus Metall ein Kopf aus Sandstein. Im Norden des Hofes die Kapelle des Colleges. Ihr Chor reicht bis an die St. John's Street und ist dadurch die nördliche Begrenzung des ersten Hofes. Das Torhaus von 1516 vom ersten Hof aus gesehen. Kapelle: Die zwischen 1866 und 1869 erbaute neugotische Kapelle befindet sich im Norden des First Court und wurde vom Architekten Sir George Gilbert Scott (1811-1877) entworfen. Sie steht an der Stelle einer mittelalterlichen Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert. Es wurde weißer Sandstein aus dem Norden Frankreichs verwendet. Über der Vierung ein 50 m hoher Turm. Blick auf den Chorabschluss der Kirche von der St. John's Street aus gesehen. Die Westfassade der Kapelle vom Chapels Court aus gesehen. Das Eingangsportal von ersten Hof. Blick auf die Südseite und das Kirchenschiff der Kapelle. Details der Südseite mit Fenstern und Blendarkaden darunter. An den Strebepfeilern jeweils mit Baldachinen überdachte Nischen mit Statuen von historischen Personen. Im Tympanon über den zwei Türen der thronende Christus, flankiert von zwei Engeln mit Weihrauchgefäßen. Links die Statue des heiligen John Fisher (1469-1535), einer der Männer, die an der Gründung des Colleges beteiligt war und späterer Märtyrer. Rechts eine Statue von Lady Margaret Beaufort. Inneres: Man betritt die Kirche im südlichen Querschiff mit Blick durch die Vierung zum nördlichen Querschiff. Sitzende Statue aus Marmor für James Wood (1760-1839), einem der Wohltäter des College. An der Wand dahinter Epitaph für den Dichter Henry Kirke White. Gemälde mit der Kreuzabnahme von Anton Raphael Mengs (1728-1779) von 1777. Am Übergang zum nördlichen Querschiff das Grab von Hugh Ashton, gest. 1522. Sein Grab hat die Form des „Memento mori“, auch Doppeldecker-Grab genannt. Oben die Darstellung des Toten zu Lebzeiten, unten als Gerippe oder verwesende Leiche. Informationstafel. Blick in den Chorraum, abgeteilt durch einen neugotischen Lettner. Chorgestühl, Hauptaltar und ein oktogonaler Chorabschluss. An der Decke Kreuzrippengewölbe und Malereien mit Darstellungen von Heiligen. Die farbigen Glasfenster, einige wenige noch aus dem 15. Jahrhundert, die meisten wurden jedoch um 1869 in den Glasmalerei-Werkstätten wie Clayton and Bell, Hardman & Co. und William Wailes hergestellt. Im Chorabschluss Blendarkaden mit musizierenden Engeln im Spitzbogen. Blick in die Decke des quadratischen Vierungsturms. Farbige Glasfenster im Kirchenschiff. Das große Fenster im Westen mit der Darstellung des jüngsten Gerichts. In der Mitte wiegt der heilige Michael die Seelen der Toten und schickt sie in den Himmel links oder in die Hölle rechts. Ganz oben der thronende Christus umgeben von Engeln. Oben links Heilige und Märtyrer. Rechts Patriarchen, Propheten und Könige. In der Mitte musizierende Engel. Chapel Court, an der Westfassade der Kapelle gelegen. Hier gibt es einen Mix aus verschiedenen Baustilen. Links ein Gebäudeflügel aus der Zeit der Tudors. Gegenüber der Kapelle mit einem modernen Vorbau, ein viktorianisches Gebäude. Hinter dem modernen Vorbau der Eingang zu Bibliothek. Zweiter Hof: südlich vom Chapel Court und westliche des ersten Hofes. Erbaut 1599-1602. Blick auf den Südflügel des Hofes. Detail des oktogonalen Erkers am Südflügel. Blick in die nordöstliche Ecke des Hofes. Von hier sieht man den Turm der Kapelle. Im Westen des Hofes der Shrewbury Tower, benannt nach der Countess of Shrewbury, die half den Bau zu finanzieren. Über dem Durchgang eine Statue von ihr mit ihrem Wappen darunter. Daneben wieder die Tudor-Rose und das Fallgitter. Er ist das Durchgangstor zum dritten Hof, der direkt am Fluss Cam liegt. Komplexes Gewölbe im Durchgang des Shrewbury Towers. Blick in den dritten Hof. Bis aus den Nordflügel sind die Gebäude 1669-1672 entstanden. Der nördliche Flügel rechts, entstand 1624 und beherbergte die Old College Library. Torhaus zum Fluss Cam bzw. zur gedeckten Bridge of Sighs. An der Fassade wieder verschiedene Wappen. Geht man durch den Durchgang im Süden, gelangt man auf die Kitchen Bridge, die über den Cam führt. Schon von hier hat man einen guten Blick auf den New Court auf der anderen Seite des Flusses und auf die 1831 erbaute Bridge of Sighs oder Seufzerbrücke. Rechts der New Court und die weite Parkanlage des St. John's Meadow.. Blick über eine Wiese mit Wildblumen zurück zur Bridge of Sighs. Blick über eine Wiese mit Wildblumen zurück zur Kitchen Bridge. New Court: Entwurf von Thomas Rickman (1776-1841) und Henry Hutchinson, 1831 vollendet. Die Formen des Gebäudes um den Hof sind neugotisch. Vor allem die Kuppel über dem zentralen Gebäude sorgte für den Namen „Hochzeitstorte“ bzw. „Wedding cake“. Erbaut um den gestiegenen Bedarf nach Wohnraum zu decken. An drei Seiten stehen neugotische Gebäude. Im Süden zwei Kolonnadengänge, die an einem Tor zusammentreffen. Blick Richtung Süden über den weiten Park. Im Hintergrund die Trinity Bridge vom Trinity College. Blick von der Kitchen Bridge Richtung Trinity College. Im Süden des New Court ein Flügel der aus Kolonnaden besteht, die nach außen neugotische Fenster hat, oben Zinnen und am Tor oben Fialen. Davor bunt bepflanzete Blumenbeete. Schräg hoch gewachsene weiß blühende Pflanze. Blick in die Kolennaden. Fächergewölbe im Durchgang zum New Court. Blick auf das dreigeschossige Hauptgebäude des New Court. Detail des unteren Bereichs des Erkers im Hauptgebäude mit zahlreichen Wappen und einem Streifen mit floralen Motiven. Blick auf den Ostflügel des New Court, der direkt am Fluss liegt. Blick von innen auf den Kolonnadengang, der wie ein Kreuzgang wirkt. Blick von innen auf das Eingangstor Richtung Park. Blick vom River Court auf den Fluss und einen Teil des westlichen Gebäudeflügels. Im Hintergrund der Turm der Kapelle. In einem der Durchgänge das Nest einer Mehlschwalbe. Durchgang zu einem Restaurant, flankiert von 2 Säulen mit Wappen und bekrönt von den Widdern aus den königlichen Wappen bzw. zwei Säulen mit Adlern. Straßenverkäufer mit Fell von verschiedenen Tieren, Ledergürteln und anderen Produkten aus Leder. Eingangstor zum Trinity College in der Trinity Street, die die Verlängerung der St. John's Street Richtung Süden ist. Das Tor entstand Anfang des 16. Jahrhundert und hat über dem Durchgang die Statue von Heinrich VIII., dem Gründer des Colleges. Blick in die Trinity Street Richtung Süden. Fachwerkbau mit einem Laden für Bekleidung, Trinity Street 14. Schaufenster mit Handtaschen. Fahrt von Cambridge nach Canterbury: Landschaft mit Feldern Dartford Crossing: Überquerung der Themse auf der M25 östlich von London. Neben zwei Tunneln gibt es eine Schrägseilbrücke „Queen Elizabeth II. Bridge“. Es ist die letzte Überquerung der Themse vor der Mündung. Da die beiden Tunnel für das hohe Verkehrsaufkommen nicht mehr ausreichten, wurde 1988 mit dem Bau einer, parallel dazu verlaufenden Brücke begonnen. 1991 durch Königin Elisabeth II. eröffnet, war sie mit einer Spannweite von 450 Metern die längste Schrägseilbrücke Europas. Zusammen mit den Zugangsviadukten auf beiden Seiten hat sie eine Gesamtlänge von 2852 Metern. Blick auf die Themse.
-
Canterbury: Die Stadt im Südosten Englands hat etwas 65.000 Einwohner. Sie liegt am Fluss Stour in der Grafschaft Kent und ist Sitz des Erzbischof von Canterbury und daher Zentrum der Anglikanischen Kirche. Canterbury soll der Sage nach 900 v. Chr. von Rudilibas angelegt und von den alten Briten Caerther oder Caerkent = Stadt von Kent, genannt worden sein. Ab 43 n. Chr. entstand an ihrer Stelle ein römisches Fort, das sich zu einem Verwaltungszentrum entwickelte und das größte römische Theater Britanniens besaß. Ab 200 n. Chr. wurde die Stadt mit einer Stadtmauer umgeben. Aethelberht von Kent, der ab 568 n. Chr. regierte, machte Canterbury zu seiner Residenz und nannte sie Cantwarabyrig. Nach dem Übertritt der Angelsachsen zum Christentum wurde die Stadt Sitz des geistlichen Oberhaupt der Kirche von England und der anglikanischen Kommunion. Seit dem Bruch mit der katholischen Kirche durch Heinrich VIII., wird der Erzbischof von Canterbury vom englischen bzw. britischen König bestimmt. Die Stadt blieb über lange Zeit weitgehend unverändert, wurde aber im 2. Weltkrieg durch die deutsche Luftwaffe 1942 stark beschädigt. Weil viele historische Bauwerke erhalten blieben, konnte der mittelalterliche Charakter des Stadtkerns bewahrt werden. Stadtplan Im Süden und Osten der Stadt haben sich noch große Teile der Stadtmauer mit Türmen erhalten. An verschiedenen Stellen gibt es kleine Durchgänge durch die Stadtmauer, so zum Beispiel im Osten der Kathedrale. Das einzige erhaltene Stadtor liegt im Nordwesten der Stadt. Von Osten führt die Straße Burgate in die Mitte der Stadt. Ein alter Fachwerkbau, Burgate 10 b. Links daneben ein Haus von 1550. Details der Fassade, geschnitzte Balken und eine Art Satyr oder Teufel als Stütze eines Balkens. Straßenbeleuchtung an einer Hauswand. Tower of St. Mary Magdalen: Von der Kirche aus normannischer Zeit (12. Jahrhundert) ist nur der Turm erhalten geblieben, der allerding von 1500-1503 stammt. Die niedrige Gartenmauer die ihn umgibt, ist der Rest des ehemaligen unteren Stockwerks der ursprüntlichen Kirche. 1866 wurde die Kirche für Gottesdienste geschlossen und 1871 abgerissen, bis auf den Turm. Hinter Glas steht das Denkmal für John Whitfield (1635-1691). Gemäß der Inschrift auf dem Denkmal soll er die Feuerspritze erfunden haben. Das Denkmal ist ganz typisch für den flämischen Stil der Bildhauer Artus Quellinus (1609-1668) und Grinling Gibbons (1648-1721). Informationstafel Detail der alten Kirchenmauer. St. Thomas of Canterbury, benannt nach Thomas Becket. 1874-1875 in neugotischen Stil erbaut. Architekt war John Green Hall (1835-1887). Sie ist die einzige römisch-katholische Kirche in Canterbury. Details der Fassade. Eingang zur Kirche mit einem eigenen kleinen Giebel. Über der Tür die Tiara und gekreuzte Schlüssel – Symbol des Vatikanstaates. An der Wand befestigtes altes Flachrelief mit einem Bischof. Inneres der dreischiffigen Kirche, Blick auf den Altarraum. Die Seitenschiffe sind durch Spitzbogen abgeteilt. Historische Häuser auf der anderen Straßenseite, Burgate 15 a Schaufenster des Ladens „Violet Elizabeth“ in der Burgate 47. Eine alte Singer Nähmaschine im Schaufenster und Ketten aus Teilen von Eierkartons als Dekoration. Innen Bekleidung, bunte Pantoffeln aus Stoff und Beutel aus Stroh. Königliches Wappen an einer Fassade. Historisches Haus Burgate Ecke Butchery Lane. Im Erdgeschoss noch Ständer aus Holz, darüber zwei vorspringende Etagen mit mehreren Erkern. Butter Market oder Buttermarkt: wurde in den letzten 500 Jahren mehrfach umgebaut. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war es als „Bull Stake“ bekannt, weil hier Stiere an einen Pfahl gebunden wurden und von Hunden „geködert“ wurden. Man dachte, daß dadurch das Fleisch zarter werden würde. 1664 wurde hier eine Markthalle mit Lagerräumen und einem Theater über einem offenen Raum mit Gewölbe errichtet. Nach zahlreichen Umbauten entstand zuletzt in der Mitte ein Denkmal für die gefallenen Soldaten des 1. Weltkrieges aus Doulting-Stein. Um den Platz viele Fachwerkbauten. Auf einem Schild von einem Pub eine der historischen Fassungen der Markthalle. Am Buttermarkt steht auch das Christchurch Gate, das Tor zum Geländer der Kathedrale von Canterbury. Verlängerung der Burgate ist die Sun Street, die auf der Westseite um die Kathedrale herum führt. Historische Häuser. „Sun Hotel“ in einem historischen Fachwerkbau. Unterkunft im „Dog and Duck Inn“, einem Freizeitpark mit vielen fahrbaren Häusern bzw. Tiny Häusern, gelegen im Südosten Endlands am River Stour. Zum Freizeitpark gehört ein Restaurant und Pub mit Garten.. Landschaft beim Freizeitpark um den Fluss Stour, mit vielen kleinen Booten und einem mit Reet gedeckten Backsteinhaus am Ufer.
-
Reculver Village: dieses Dorf liegt etwa 5 km östlich des Ortes Herne Bay in der Grafschaft Kent, direkt am Meer. In der Antike stand hier ein Kastell für Hilfstruppen und im Mittelalter ein Kloster. Im 19. Jahrhundert gingen die Bauten durch Erosion der Küste verloren. Heute ist hier nur noch die Ruine der später erbauten Marienkirche zu sehen. Das originale Dorf Reculver existiert nicht mehr. Blick entlang der Küste. In der Nähe der Kirchenruine sind Maßnahmen zum Künstenschutz ergriffen worden. Auf den Felsen liegen dicke Schichten aus angespülten Algen, vor allem Blasentang (Fucus vesiculosus). Silbermöwe im Jugendgefieder. Informationstafel zu dem römischen Kastell „Regulbium“, welches von etwa 200-407 von Soldaten besetzt war. Im 7. Jahrhundert wurde in den Ruinen des Kastells ein Kloster errichtet. Auf den Grundriss des ehemaligen Lagers sieht man die Lage der Kirche und wie viel des Geländes bereits in das Meer abgerutscht ist. Blick auf die Westfassade der mittelalterlichen Kirchenruine. Die hohen Türme der Fassade wurden im 12. Jahrhundert errichtet. Details der Fassade. Die Mauern bestehen aus unterschiedlichsten Steinen. Auf der Innenseite der Westfassade eine steinerne Informationstafel von 1819, die darauf hinweist, daß die Türme eine gute Landmarke für die Navigation der Schiffe darstellt. Details der verwendeten Steine. Durchblick von einem Turm zum anderen Turm hinter der Fassade. Der Giebel der Fassade und der südliche Turm. Blick über angrenzende Ruinen (Badehaus und Quartiere der Offiziere) und die dahinter liegende Küste. Man kann gut die Nähe der Abbruchkante sehen. Eine Gedenktafel an einem der Pfosten des Zauns. Blick auf das Meer in der Nähe der Mündung der Themse, mit Containerschiffen und Windrädern. Informationstafel zu römischen Siedlungen in der Region der Isle of Thanet. Informationstafel zu den Festungsmauern des römischen Kastells. Die Reste der römischen Festungsmauer, überwuchert von Vegetation. Hummel auf einer violetten Blüte. Samenstand einer Gespenst-Gelbdolde. Wilde Malve (Malva sylvestris). Informationstafel zur Hauptgebäude des römischen Kastells. Einige wenige Grabsteine auf der Wiese, Mitte des 18. Jahrhunderts. Blick zurück entlang der Küste. Vor dem Restaurant ein Wegkreuz. Kleine moderne Windmühle Fassadenmalerei, Graffito auf einer Backsteinwand mit der Rettung eines Seehundes aus einem Fischernetz.
-
Margate: noch weiter nach Osten, bis fast an die Spitze der Isle of Thanet. Die Stadt hat über 65.000 Einwohner und wurde 1254 gegründet. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt zu einem der führenden englischen Seebäder. Durch die Nähe zu London und die schönen Sandstrände, hat sich der Tourismus zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige entwickelt. Blick über die Bucht. Altes Hotel direkt an der Küste. Blick von oben auf die Strandbars mit dem dahinter liegenden Strand. Auf der anderen Seite der Bucht das Museum 2011 eröffnete Kunstmuseum Turner Contemporary. Architekt war David Chipperfield (1953-). Benannt ist es nach William Turner, der in Margate zur Schule ging und die Stadt regelmäßig besuchte. Leuchtturm am Ende Mole. Zwei neugotische Kirchen in der Northdown Road. St. Michael and St. Bishoy Church, eine koptisch-orthodoxe Kirche und die anglikanische Kirche St. Pauls. -
Broadstairs: Ein Badeort an der Ostküste der Isle of Thanet mit mehreren Sandstränden. Hier wurde 1916 der Premierminister Edward Heath geboren. Auch Charles Dickens war häufiger Gast im Ort. Blick über die Viking Bay. Der Ort liegt einige Meter über dem Strand und ist über Treppen und einen Fahrstuhl erreichbar. Zahlreiche Umkleidekabinen ziehen sich an den Klippen entlang. Eine kurze Straße mit einigen Parkplätzen und einem Restaurant ist in das Meer hinaus gebaut. Blick auf einige Häuser an der Straße am Strand, darunter etwas oberhalb die Unterkunft von Charles Dickens. Statue eines Schotten auf dem Balkon eines Hauses. Der „Scotsman“ wurde 1869 vom 854 Tonnen schweren Lastkahn „Highland Chief“ geborgen. Bleak House, welches früher Fort House genannt wurde, wurde 1801 als privates Wohnhaus erbaut und 1901 erweitert. Charles Dickens wohnte hier während seiner Aufenthalte in Broadstairs. Angler auf der Brücke in die Nordsee. Blick auf die Küste mit den zum Teil mit Beton befestigten Klippen.
-
Sandwich: der kleine Ort mit ca. 5000 Einwohnern, liegt in der Nähe der Mündung des Flusses Stour in die Nordsee, heute 5 km von der Küste entfernt. Zur Zeit der Angelsachsen befand sich der Ort direkt am Meer und hatte einen bedeutenden Hafen. Die Isle of Thanet mit den Orten Margate und Ramsgate war eine Insel und Sandwich lag der Insel gegenüber am Meer. Auch die Römer hatten hier bereits einen Hafen „Rutupiae“. Im Mittelalter war Sandwich einer der Haupthäfen für die Schifffahrt zum europäischen Kontinent. So benutzten ihn die englischen Könige häufig als Abfahrtspunkt für ihre Expeditionen gegen Frankreich. Die Heringsfischerei und der allgemeine Handel der Stadt blühten. Unweit nördlich der Stadt wurde im Ersten Weltkrieg der geheime Militärhafen Richborough Port eingerichtet. Stadtplan Restaurant „The Red Cow“ in der Straße Moat Sole. Im Ort haben sich zahlreiche historische Gebäude erhalten. Sandwich-Guildhall: Das Gildehaus und Rathaus ist ein städtisches Gebäude und steht auf dem ehemaligen Viehmarkt. Das Gebäude von 1579 wurde aus Backsteinen und Fachwerk errichtet und 1973 erweitert. Hier befindet sich auch die Touristen-Information. Im Inneren kann man noch einen erhaltenen Raum aus der Tudor Zeit mit farbigen Glasfenstern, den Ratssaal, Gerichtssaal und das Wohnzimmer des Bürgermeistern besichtigen. An dem vorspringenden Giebel eine extra Erker für eine Uhr und einer kleinen Glocke darüber. Market Street Ecke King's Street mit dem Kirchturm der St. Peters Kirche im Hintergrund. Die Market Street ist das Zentrum des Ortes seit der angelsächsischen Zeit. Historische Häuser aus Backsteinen in der New Street mit Verzierungen aus Backsteinen in den Giebeln der Gauben. St. Peter's Church: Es wird angenommen, dass die St. Peters-Kirche während eines französischen Überfalls im Jahr 1216 zerstört wurde. Danach wurde sie von Karmelitermönchen aus der Normandie wieder aufgebaut. Der größte Teil des Gebäudes stammt aus dem 14. Jahrhundert, obwohl einige normannische Fragmente erhalten sind. Beim Einsturz des Turms im Jahr 1661 wurde das Südschiff völlig zerstört. Der Turm wurde von flämischen Flüchtlingen aus Ziegeln aus dem Schlamm des Hafens wieder aufgebaut und mit einer Kuppel im flämischen Stil überragt. Informationstafel zur Kirche. Gesamtansicht der Kirche von Westen mit dem Kriegerdenkmal davor. Vor der Kirche ein Kriegerdenkmal, welches von Omar Ramsden (1873-1939) entworfen wurde. Ein Flachrelief aus Bronze zeigt den heiligen Georg mit seinem Drachen. Das Denkmal ist den toten Soldaten aus Sandwich gewidmet, die in beiden Weltkriegen, dem Koreakrieg und dem Falklandkrieg gestorben sind. Nordseite mit Strebepfeilern und gotischen Fenstern. Südseite mit einem Anbau mit Giebel aus Backsteinen. An den Wänden aus Natursteinen sieht man noch ehemalige spitzbogige Fenster und Durchgänge. Gut erkennbar der ab einer gewissen Höhe wieder aufgebaute Turm aus Ziegeln aus Schlamm des Hafens. Aaron-'Stab vor einem alten Grabstein. Maßwerk eines gotischen Fensters mit Rahmen, aufgestellt auf dem Gelände um die Kirche als Denkmal für Tapferkeit. Davor zwei Kränze aus künstlichen Mohnblumen, den englischen Remembrance Poppies. Blick vom Kirchengelände auf die umliegenden Häuser und den Garten mit Oleander. Früchte der Eberesche (Sorbus aucuparia). Historisches Haus, Facherkbau, in der Market Street 15. 3 Giebel und 2 obere, vorkragende Etagen. Auf Postamenten an der Fassade mehrere geschnitze Figuren. Details der erstem Etage und der Figuren. Blick in die schmale Gasse The Butchery mit mehreren historischen Fachwerkbauten. Drache aus Ton auf einem Dach. Großer Fachwerkbau in der Strand Street. Als Sandwich noch ein bedeutender Hafen war, war die Strand Street der Strand und lag direkt am Kai. Das ursprüngliche mittelalterliche Straßenmuster weist eine Reihe kleiner Gassen auf, die ins Stadtzentrum und hinunter zum Ufer führen. Am Ufer des Flusses Stour mit zahlreichen Booten. Zwei bunt bemalte Haustüren. Strand Street 33 mit Blumen in Hängeampeln. Bayze House in der Love Lane, Fachwerkbau. Weitere Fachwerkbauten, genannt „The Sandwich Weaver's“ stehen in der Strand Street. Die Häuser wurden von niederländischen Flüchtlingen, die im 16. Jahrhundert ankamen, als Wohnhaus und Werkstatt erbaut. Einige der ursprünglichen mittelalterlichen Fenster sind noch mit ihren Holzsprossen erhalten. Detail des Fachwerks mit sichtbaren Reparaturen. Weitere Details und ein Flachrelief aus Holz über der Tür, mit Wappenschild und feuerspeiendem Drachen. Informationstafel. Three King's Yard. Diese kleine Gasse führt direkt zum Kai und geht von der Strand Street ab. Hinter einem Torbogen beim Haus Nr. 8 befindet sich eine zerstörte Pfarrkapelle, die um 1250 als kleines normannisches Kaufmannshaus erbaut wurde. Später wurde daraus eine Kapelle, nach der Auflösung verfiel sie jedoch. Die Strand Street mündet in die High Street. Gegenüber das Bell Hotel in einem Haus aus Backsteinen im edwardianischen Stil. Stadttor „The Barbican“: es liegt direkt am Fluss Stour und an einer Brücke. Das Stadttor stamt aus dem 15. Jahrhundert und wird auch Davis Gate genannt. Die vier Haupttore der ehemaligen Stadtbefestigung wurden im 18. Jahrhundert abgerissen. Die Tradition, für die Überquerung des Flusses eine Gebühr zu erheben, geht auf König Knut zurück, der im frühen 11. Jahrhundert erstmals den Mönchen von Christchurch in Cambridge eine Erlaubnis zum Betrieb einer Fähre erteilte. Die Erhebung der Brückenmaut endete erst 1977. Historisches Foto vom Stadttor auf einem Schild für ein Restaurant, welches seit 1491 hier existiert. Blick zurück zum Bell Hotel und der Einmündung der Strand Street. Rechts an der Ecke das Restaurant „The Admiral Owen“ in einem Fachwerkbau. Das Stadttor „The Barbican“ von der Seite des Flusses. Auffällig das karierte Ziermauerwerk im Erdgeschoss. Blick auf den Fluss Stour Richtung Osten. Hier liegt ein altes Boot der US Navy. Seine Aufgabe bestand darin, Teil der alliierten Abschreckung zu sein und die Expansion der russischen Armee von Ostdeutschland nach Westen nach dem Ende des 2. Weltkriegs zu verhindern. Es wurde von den Amerikanern betrieben und 1958 wurden alle Schiffe an den ehemaligen Gegner, die deutsche Armee übergeben, um diese wichtige Arbeit fortzusetzen. Hier können auch Bootstouren über den Fluss gebucht werden. Restaurant direkt am Fluss an der Brücke. Blick nach Westen über den Fluss. Wandmalerei, Graffito an einer weißen Wand mit einem Mädchen mit Luftballons. Erinnert an ein Graffito von Banksy. Silbermöwe vor einem Haus aus Backsteinen. Häuser an der Landstraße, warscheinlich mit kleinen Windkraftanlagen auf dem Dach. Kleines historisches Haus aus Backstein und Fachwerk mit Reetdach. Westlich von Minster der „Thanet Pet Cemetery“, ein Friedhof für Tiere. Blick über den Friedhof mit zahlreichen Grabsteinen. Details verschiedener Grabsteine für Tiere, meist Hunde.
-
Canterbury: St. Martin's Church: Die dem heiligen Martin von Tours geweihte Kirche geht auf das späte 6. Jahrhundert zurück und ist somit die älteste Kirche im englischen Sprachraum, die ununterbrochen als Kirche genutzt wird. Die Kathedrale von Canterbury ist eigentlich eine Tochterkirche der Church of St. Martin. Beide Kirchen sind UNESCO Weltkulturerbe. Die Kirche steht mitten in einem bereits seit der Antike genutzten Friedhof mit ca. 900 Gräbern, gut 1 km östlich des Stadtzentrums, also außerhalb der römischen und mittelalterlichen Stadtmauer von Canterbury. Um das Jahr 580 heiratete die fränkische Prinzessin Bertha, die Urenkelin von Chlodwig, den heidnischen König Aethelberht (-794). Sie war Christin und ihr Mann akzeptierte ihren christlichen Glauben und ließ einen spätrömischen Kirchenbau restaurieren. Der vom Papst zur Bekehrung der weitgehend heidnischen Bevölkerung nach England gesandte und später heiliggesprochene Augustinus von Canterbury, ließ die Kirche kurz nach seiner Ankunft im Jahr 597 umbauen. Die rechteckige kleine Saalkirche besteht aus römischen Ziegeln und Feuersteinknollen. Trotz vieler Umbauten in den folgenden Jahrhunderten, ist das Kirchenschiff nach wie vor mit einer Holzsparrenkonstruktion gedeckt. Glockenturm und Spitzbogenfenster wurden später ergänzt. Informationstafel. Eingang und Grabsteine, die die kleine Mauer, die den Bereich umgiebt, überragen. Informationstafeln Grabsteine rechts und links vom Weg, der zum Eingang in die Kirche unterhalb des Turmes führt. Grabsteine, viele davon noch mit keltischen Kreuz. Nordseite der Kirche. Südseite der Kirche. Vom Friedhof hat man einen guten Blick auf den hohen Turm der Kathedrale, die westliche der Kirche liegt. Inneres: Blick durch das Kirchenschiff der Saalkirche und an die Decke mit der Holzsparrenkonstruktion mit Ausfachungen. Die im Osten liegende Apsis mit dem Altar ist schmaler als das Kirchenschiff und endet gerade. Rechts vom Eingang steht ein aus mehreren Steinringen zusammengesetztes Taufbecken aus romanischer Zeit. Geschmückt ist es mit einem Flachrelief aus ineinander verschlungenen Kreisen und Bögen. Mittelalterliche Kassette Moderne Statue der Königin Bertha in der überwölbten Nische, daneben eine keltisches Kreuz. Farbiges Glasfenster mit dem heiligen Martin, darüber Ritter vor einer Burg. Weitere farbige Glasfenster Farbiges Glasfenster mit der Geschichte des heiligen Martin. Blick in die Apsis mit 3 spitzbogigen farbigen Glasfenstern und dem Altar. Zwei alte Sarkophage mit einem geschnitzten Holzkreuz darauf. Sie stehen in einer mit Rundbogen überwölbten Nische vor einer unverputzten Wand. Sie befindet sich links am Beginn der Apsis. Hier sind noch die einzigen römischen Mauerreste aus der Zeit um 300. Blick durch das Kirchenschiff nach Westen zum Eingang. Reihenhäuser aus Backsteinen von 1657 in der Straße Longport 44. Das „County Goal and House of Correction“ von 1808, das alte Gefängnis von Canterbury. Das Gelände gehört heute zur Canterbury Christ Church University. Stadtplan mit der Kathedrale im Westen und der außerdhalb der Stadtbefestigung liegenden St. Augustin's Abbey und der noch weiter östlich liegenden St. Martin's Church. Alle drei Orte sind Bestandteil des Pilgerweges Via Francigena. Lady Wootton's Green: Lady Wootton’s Green bildet eine physische und historische Verbindung zwischen der Kathedrale, der St. Augustine’s Abbey und der St. Martin’s Church, die 1988 gemeinsam zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Im Jahr 580 heiratete Bertha, wie wir bei der St. Martins Kirche erfahren haben, den Gründer der fränkischen Monarchie, Prinz Aethelberht von Kent. Er war 601 zum Christentum konvertiert und stellte Erzbischof Augustinus die Mittel zur Verfügung, um seine Kathedrale in der Stadt und die Abtei, die seinen Namen trägt, zu bauen. Die Abtei liegt außerhalb der Stadtbefestigung und war die Begräbnisstätte der zukünftigen Erzbischöfe von Canterbury und Könige von Kent. Diese Grünanlage wurde so Teil eines zeremoniellen Weges zwischen der Stadt und der Abtei. Informationstafeln. Statue von Königin Bertham, als sie Aethelberht die Nachricht von der Mission des Heiligen Augustinus überbringt. Die Kleidung entspricht den archäologischen Funden. Im Hintergrund einer der Türme des nördlichen Eingangstores zur Abtei. Statue von König Aethelberht. Im Hintergrund der Turm der Kathedrale. St. Augustine's Abbey bzw. Saint Augustine: Die Abtei St. Augustinus wurde etwa 597 von Augustinus von Canterbury gegründet. Es ist damit das erste Kloster in Südengland und die erste Gründung der Benediktiner außerhalb Kontinentaleuropas. Es gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Als Gregor I. Papst geworden war, erreichte ihn die Bitte von König Aethelberht, Missionare zu ihm zu senden. Gregor gab darauf Augustinus und weiteren Mönchen der Benediktinerabtei St. Andreas den Auftrag, nach England zu ziehen, wo sie 597 ankamen. Für die begleitenden Mönche ließ Æthelberht eine Peter und Paul gewidmete Kirche errichten, die dann dem neu gegründeten Kloster gehörte. Das Kloster wurde zur Grablege der Könige von Kent und der Erzbischöfe von Canterbury. Im Jahr 978 wurde die Kirche und damit das Kloster dem inzwischen heiliggesprochenen Gründer und ersten Erzbischof von Canterbury Augustinus gewidmet. Zur Zeit der Reformation wurde das Kloster 1538 aufgelöst. Neben dem Abt gab es zu dieser Zeit noch 30 Mönche. Der letzte Abt widersetzte sich nicht der Auflösung, sondern versuchte stattdessen, mit Thomas Cromwell eine möglichst gute Übereinkunft zu finden, die seine Mönche und ihn bestmöglich versorgte. Gebäude auf dem Gelände des Klosters an der Monastery Street, die an der Westseite der St. Augustine's Abbey vorbeiführt. Die Gebäude gehören heute zur King's School und wurden in viktorianischer Zeit um 1840 errichtet. Das südliche Eingangstor zum Kloster. Es hat 2 oktogonale Türme mit Zinnen. Über den Durchgang zwei Fenster und darüber ebenfalls Zinnen. Blick auf das nördliche Eingangstor, das Fyndon's Gate: Es liegt am Ende von Lady Wootton's Green liegt. Es wurde von 1301-1309 von Abt Fyndon wieder aufgebaut. Über dem Tor befinden sich Staatsgemächer. Das Tor hat zwei oktogonale Türme, die kunstvoll mit Statuen verziert waren und mit Zinnen geschmückt sind. Das Tor wurde im 2. Weltkrieg beschädigt und musste repariert werden, was zu den Farbunterschieden im Stein geführt hat. Es ist auch Eingang zur King's School, die an das Gelände des Klosters angrenzt. Informationstafel und Lageplan des Geländes der Abtei. Links oben das nordliche Eingangstor, links unten das südliche Eingangstor. Im Zentrum die Grundmauern der Kirche St. Peter und Paul. Zwischen Langhaus und dem Chor im Osten, liegt Wulfrics Rotunde. Nördlich davon, also weiter oben, der königiche Palast und daneben der ehemalige Kreuzgang. Noch weiter nördlich die Küche. Am Ende des Chores im Osten die Lady Chapel oder Marienkapelle und ganz rechts die St. Pancras Church. Blick über einen Hof der King's School, hinten die Häuser, die an der Monastery Street stehen. Blick über das Gelände Richtung Osten. Links die Ruine des königlichen Palastes, rechts daneben, überdacht die ältesten Grundmauern des Langhauses der Kirche St. Peter und Paul. Das Haus hinten links gehört zur King's School. Südseite des königlichen Palastes aus Backsteinen, der sich auf der Nordseite des Langhauses befindet. Errichtet zur Zeit von König Heinrich VIII.(1491-1547). Details der Südwand des königlichen Palastes. Informationstafeln zur Geschichte der Kirchen, die hier einst standen. Rekonstruktionen der ersten Kirche. Dann Rekonstruktionen des angelsächsischen Klosters, bevor es von den Normannen zerstört wurde. Dann die normannische Kirche, die um 1100 entstanden ist und in etwa so groß war wie die Kathedrale von Canterbury. Ferner ein Grundriss beider Kirchen, die es möglich machen die Grundmauern besser zuzuordnen. Informationstafeln zur Geschichte in deutscher Sprache. Blick über die Grundmauern des Langhauses Richtung Nordosten. Links wieder die Südfassade des königlichen Palastes. Blick von Westen durch die Grundmauern des Kirchenschiffs. Rechts Fundamente von Säulen, hinten Wulfrics Rotunde. Informationstafel zur ersten Kirche und der Lage der Gräber. Überdachte Grundmauern an der Nordseite der Kirche, an denen sich Gräber der ersten Erzbischöfe von Canterbury befanden. Justus, 4. Erzbischof von Canterbury, gest. 634. Mellitus, 3. Erzbischof von Canterbury, gest. 624. Informationstafeln zu Wulfrics Rotunde. Krypta eines Turms, der die beiden angelsächsischen Kirchen verbinden sollte. Im 7. Jahrhundert hatte man eine kleine Kirche, die Maria geweiht war, im Osten der Kirche St. Peter und Paul erbaut. Um 1050 veranlasste Wulfric, einer der letzten angelsächsische Äbte des Klosters, den Bau dieser Rotunde, um die beiden Kirchen zu verbinden. Kurz vor der Vierung die Grundmauern von Wulfrics Rotunde. Informationstafel zum Kreuzgang Die Grundmauern des ehemaligen Kreuzganges. Die 2 Gebäude gehören zur King's School. Vor den modernen Gebäuden ganz hinten die Grundmauern der Küche. Informationstafel zum Lavarotium. Innenhof des ehemaligen Kreuzganges mit den Umrissen des Lavatoriums. Rechts die Innenseite der Wand vom königlichen Palast. Innenseite der Wand vom königlichen Palast. Blick in einen weiteren Hof der King's School. Blick auf eines der Gebäude der King's School. Links die Grundmauer der Nordwand des Kreuzganges. Rechts die Grundmauern der Küche. Informationstafel zum Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, welches sich hier befand. Informationstagel zum Kapitelhaus. An der Ostseite des Kreuzganges befand sich das im frühen 12. Jahrhundert erbaute Kapitelhaus, in dem die Entscheidungen des Klosters getroffen wurden. Blick von den Ruinen auf den Kreuzgang mit dem zentralen Brunnen, links die Grundmauern der Kirche und die Ruine des königlichen Palastes. Blick auf die Ruinen des Chores und die Fundamente der Säulen der Krypta. Am Chorabschluss unter einem Rundbogen mit Gewölbe ein Altar. Infromationstafel. Auf der Nordseite des Chores eine kleine Kapelle, die dem Apostel Thomas geweiht ist. Bei Ausgrabungen der Kapelle Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Teile der Altarplatte lose gefunden. Blick auf die Südseite des Chorumgangs. Informationstafel 2 rekonstruierte Gräber von angelsächsischen Königen. Links Eadbald von Kent, gest. 640. Rechts Hlothhere, gest. 685. Blick in die Reste des südlichen Querschiffs Informationstafel Kapelle von Johannes dem Täufer, die im südlichen Querschiff Richtung Osten liegt. Ursprünglich war sie dem heiligen Martin geweiht. Museum: Im Museum läuft anhand einer Zeitschine eine animierte Geschichte der St. Augustin's Abbey. Deutlich kann man hier die baulichen Veränderungen an den Bauten erkennen. Mehrere der wichtigen kirchlichen Bestattungen in St. Augustine's waren mit einem nachgebildeten Bleikelch und einer Patene (liturgisches Gefäss) sowie einem Ring aus Kupferlegierung ausgestattet und nicht mit echten Gegenständen aus Edelmetallen. Hier auch eine Mitra. Informationstafel zu den königlichen Bestattungen. Skelett Einige Beuteile, die man bei Ausgrabungen gefunden hat. Details einer normannischen Steinmetzarbeit. Sie zeigt den Kopf eines Mannes mit zwei Tieren, die an seinem Bart zupfen. Signiert ist die Arbeit mit Robertus. Rekonstruierte Kleidungsstücke von König Aethelberht und Königin Bertha. Historische Häuser in der Broad Street. „The Victorian Fireplace“, Broad Street 93. Laden für Kamine und Öfen in einem historischen Haus aus Backsteinen. Hardys Original Sweetshop, High Street 1, Ecke Mercury Road. Laden mit Süßwaren. Über den Schaufenstern als Stützen für das hervorspringende obere Geschoss, geschnitze Faune oder Teufel aus Holz. Das historische Gebaude von „Queen Elizabeth's Guest Chamber“ in der High Street 43-45. Die oberste Etage ist mit bemaltem Stück dekoriert, der trinkende Putten zwischen Weinranken zeigt. Die beiden unteren Etagen sind Fachwerk oder mit Holz verkleidet. Hier befand sich vom 15. bis 18. Jahrhundert das „Crown Inn“. Königin Elisabeth I. empfing hier 1573 bei ihrem Besuch in Canterbury, den Herzog von Alençon. Heute befindet sich hier unter anderem „Nero's Café“. Detail des Fensters in der 1. Etage. Das Fachwerk des ersten Stocks ist mit Gips und Ziegeln im Fischgrätmuster ausgefüllt und trägt die Jahreszahl 1573, die sich vermutlich auf den Besuch von Königin Elisabeth I. bezieht Bearney House of Art and Knowledge, High Street 18. Das Gebäude ist heute das zentrale Museum, die Bibliothek und die Kunstgalerie der Stadt Canterbury. Vorher hieß es „Beaney Institute oder Royal Museum and Art Gallery“, wie auch im Giebel zu lesen ist. Das Gebäude wurde 1897 vom Architekten und Stadtvermesser AH Campbell entworfen im Tudor-Revival-Stil. Details der Fassade, Fenster, Erker und eine aus Holz geschnitzte Stütze für ein Vordach, in der Form eines Adlers. Farbiges Glasfenster mit einem Wapen. Im Inneren das Treppenhaus mit farbigem Glasfenster, zusammengesetzt zum Teil aus Scherben von anderen farbigen Glasfenstern. 2 Hochräder Gegenüber ein Hotel in der High Street 30-33, in den oberen Etagen als moderner Fachwerkbau ausgeführt. Am Ende der High Street befindet sich das West Gate. Informationstafel. Dieses 18 m hohe Stadttor im Westen, ist das größte noch erhaltene Stadttor Englands. Es wurde um 1379 aus Kent-Sandstein erbaut. Warscheinlich wurde das Tor königlichen Baumeister Henry Yvele (1320-1400) entworfen. Es ist noch immer gut erhalten und eines der markantesten Wahrzeichen der Stadt. Die Straße verläuft noch immer zwischen seinen beiden Türmen hindurch. Schon im 3. Jahrhundert befand sich hier ein Tor als Teil der römischen Stadtbefestigung. Heute befindet sich hier ein Museum. Direkt daneben steht die Canterbury Guildhall. ehemals Church of the Holy Cross, die seit 1978 als Sitzungsort des Stadtrats verwendet wird und damit auch das Rathaus der Stadt ist.. Die Kirche wurde 1381 in Auftrag gegeben. Sie hateinen quadratischen Turm, der in Richtung des Flusses Stour ausgerichtet ist. 1972 wurde die Kirche für überflüssig erklärt und entweiht. Seit 1978 Überquert man den Stour, hat man eine schöne Sicht auf den Turm und die umgebenden Blumenbeete. Auf dem Fluss kann man mit Booten fahren und Wohnhäuser als Fachwerkbauten und ein historisches Haus aus Backsteinen stehen direkt an der Uferstraße Westgate Grove. Blick auf das West Gate über die Blumenbeete, Wege am Ufer und die Brücke über den Stour. Zurück zur Einmündung der Mercury Lane auf die High Street. An der Ecke ein Laden mit Andenken. Davor steht eine lebensgroße Statue eines britischen Soldaten in einer historischen Uniform mit roter Jacke und Zylinger. Auf der Brust, Diestel, Rose und Kleeblatt, die floralen Symbole für Schottland, England und Irland. Am Schaufenster ein Bildnis von König Charles III. Am Schaufenster ein Plakat mit zwei Bildnisen von Königin Elisabeth II. mit Lebenjahren. Im Schaufenster Andenken, z.B. rote Telefonzellen, Polizist, Soldaten, rote Busse und König Charles III. Kathedrale von Canterbury oder Christ Church Cathedral: Nach der Gründung der Anglikanischen Kirche durch König Heinreich VIII., ist der Erzbischof von Canterbury das geistige Oberhaupt der Kirche. Er krönt die englischen Könige und die Kathedrale ist ein bedeutender Wallfahrtsort. Im Jahre 597 kamen Missionare aus Rom nach Canterbury. Der Benediktinermönch Augustinus führte die Missionare an und wurde später zum ersten Erzbischof von Canterbury. Die Reste der ersten Kathedrale fand man bei Renovierungsarbeiten 1993 unter den Bodenplatten, darunter sogar noch Reste aus römischer Zeit. Die erste Kirche brannte kurz nach der normannischen Eroberung 1067 ab. Danach entstand über mehrere Jahrhunderte hinweg die heutige Kathedrale. Es ist ein kompliziertes und von mehreren architektonischen Epochen geprägtes Gebäude. Man sieht romanische, frühgotische und spätgotische Formen und auch der Grundriss zeigt die komplizierte Baugeschichte. Begonnen wurde der Bau 1067 unter Erzbischof Lanfrank (1005-1089). Damals hatte die Kirche nur ein Querhaus und an den Chor schlossen sich 3 Apsiden an. 1096 wurde die Kirche im Osten unter Erzbischof Anselm von Canterbury (1033-1109) wesentlich erweitert. Der alte Chor wurde ersetzt durch einen Langhaus-Teil mit einem eigenen Querschiff und einem daran anschließenden langen Chorraum mit Chorumgang und Radikalkapellen. 1110-1130 wurde er über der Krypta erhöht. Zwei Türme im Westen und ein Vierungsturm kamen hinzu. 1130 fand die Weihe statt. Nur einige Teile dieses Baus sind bis heute erhalten, so zum Beispiel die Krypta und die beiden Flügel des östlichen Querschiffs. 1170 kam es in der Kathedrale zur Ermordung von Thomas Becket (1118-1170). Er gilt als einer der bekanntesten Morde der abendländischen Geschichte. Nach dieser Tat wurde Canterbury zum berühmtesten Wallfahrtsort des Landes. 1174 brannte der Chor von 1130 ab. Mit dem Neubau beginnt die Gotik in England. Aus der Normandie wurde der Baumeister der Kathedrale von Sens, Wilhelm of Sens (gest. 1180) herbeigeholt. Der Beginn der gotischen Baukunst in England wird allgemein mit diesem neuen Chorabschluss der Kathedrale von Canterbury im Jahr 1175 angenommen. Die Weiterentwicklung der englischen Gotik setzte dann mit dem Bau der Kathedrale vonWells ein. Am Ende der Mercury Lane wieder der Butter Market mit dem Christchurch Gate, dem Tor zum Geländer der Kathedrale von Canterbury. Wurde 2022 frisch restauriert wieder eröffnet. Das Tor wurde im Stil der Tudor-Gotik 1520 erbaut. Ursprünglich wurde es als zeremonielles Torhaus zur Feier der Hochzeit von Arthur, Prinz von Wales (der ältere Bruder von Heinrich VIII.), mit Katharina von Aragon im Jahr 1502 errichtet. Da Arthur kurz darauf starb, wurde das Tor erst 20 Jahre später fertiggestellt. Die äußere Fassade des Tores ist aufwändig dekoriert. In der Mitte eine Statue des die Besucher willkommen heißenden Christus von Klaus Ringwald (1939-2011) aus dem Jahr 1990.. Die originale Staute wurde während des Bürgerkrieges durch Parlamentstruppen zerstört. Das heutige Tor besteht aus einem steinernen Bogen und zwei darüber liegenden Stockwerken, flankiert von 2 oktogonalen Türmen, die oben Zinnen haben und mit blindem Maßwerk verziert sind. Zwei Streifen mit zahlreichen, heute wieder farbigen Wappen unterteilen das Tor optisch. Unterhalb der Füße von Christus das Wappen das königliche Wappen, gestützt vom walisischen Drachen und dem weißen Windhund von Edmund Tudor, dem Vater Heinrichs VII. Rechts die Tudor-Rose, links das Fallgiter von Beaufort. Links neben dem Fallgitter das Wappen des Prinzen von Wales und rechts neben der Tudor-Rose das Wappen von Katharina von Aragon. In der oberen Reihe halten Engel die farbigen Wappenschilde. Pilaster und Kapitelle stammen aus der Frührenaissance und zählen damit zu den ältesten im Land. Details der Fassade. Links neben der großen Durchfahrt gibt es noch einen kleineren Durchgang mit Tür. Darüber ein Kielbogen, Wappen und eine Mitra. Auch die große Durchfahrt konnte mit reich geschnitzten Türen aus Holz verschlossen werden. Oben Engel, ein Streifen mit floralen Motiven und unten Wappen. In der Durchfahrt oben ein Sterngewölbe, dessen Rippen wieder farbig sind. An den Kreuzungspunkten Wappen, zum Beispiel von Prior Goldwell und das des Erzbischofs von York. Hinter dem Tor der Blick auf die teilweise eingerüstete Kathedrale. Sie ist 160 m lang und die beiden Querschiffe sind 40 bzw. 48 m breit. Blick auf die wesentlich schlichtere Innenseite des Tores. In der Mitte über der Durchfahrt wieder das königliche Wappen, gehalten von einem Engel, Tudor-Rose und Fallgitter. Ganz oben ein weiterer Engel mit einem Wappen. Historisches Gebäude auf dem Gelände der Kathedrale, gegenüber der Westfassade. Lageplan der drei Orte des UNESCO Weltkulturerbes in Canterbury – Kathedrale – St. Augustin's Abbey und St. Martin's Church.
Grundriss der Kathedrale – Osten und Westen ist hier verdreht. Links der Chor mit Chorumgang und Radialkapellen, dann ein Teil des Langhauses und das östliche Querschiff – 1130 geweiht. Weiter rechts das westliche Querschiff und ganz rechts die Westfassade. Die Kathedrale weist als erste die insulare Besonderheit der zwei Querschiffe auf. Der Kreuzgang und das Kapitelhaus liegt hier nördlich der Kathedrale, auf dem Plan also unten. Blick auf die Kathedrale von Südwesten. Blick auf die eingerüstete Westfassade. Sie hat zwei Türme und ein großes Fenster. Der südliche Westturm kam in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hinzu, der nördliche erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Details der Fassade. Über dem spitzbogigen Eingang ein Streifen mit glatten Wappen. In Nischen mit gotischen Baldachinen stehen Statuen von Königin Elisabeth II. und Prinz Philipp. Diese besondere Ehre, noch zu Lebzeiten an der Fassade verewigt zu werden, geschah 2015 anläßlich des diamantenen Thronjubiläums der Queen. Weiter rechts eine ältere Statue von Königin Elisabeth I. Blick auf die Kathedrale von Südwesten. Der Turm auf der westlichen Vierung ist 72 m hoch und damit höher als die beiden Westtürme. Erbaut 1494-1504. Nach der in ihm aufgehängten großen Glocke wird er „Bell Harry“ genannt. Der Haupteingang befindet sich im Südwesten. Im Turm über dem Portal ist das Glockenspiel der Kathedrale mit 14 Glocken untergebracht. Details des Portals im Südwesten, das sogenannte Christ Church Portal, errichtet zusammen mit der Vorhalle 1505. In Nischen mit gotischen Baldachinen stehen Statuen von Erzbischöfen. Links neben der Tür König Aethelberht, rechts Königin Bertha. Südseite der Kathedrale mit den großen Fenstern zwischen den Strebepfeilern im südlichen Seitenschiff. Der 72 m hohe Turm auf der westlichen Vierung. Erbaut 1494-1505. Blick auf die Südseite mit dem südwestlichen Querschiff, welches in einem großen Fenster endet. Dahinter das ältere östliche Querschiff. Von 1378-1410 wurde das alte romanische West-Langhaus zusammen mit dem westlichen Querhaus neu gebaut. Blick von der westlichen Vierung Richtung Westfassade und das im Perpendicular Style ersetzte Langhaus. Blick auf die Vierung von Süden. Das große Fenster des südlichen Querschiffs und rechts die St. Michael Kapelle. Blick von westlichen Querschiff auf das östliche Querschiff. 1096-1126 wurde der Bereich um das östliche Querschiff erbaut. Das Langhaus zwischen westlichem und östlichen Querschiff, sowie die schräng, hinter dem östlichen Querschiff angesetzten Kapellen stammen ebenfalls aus dieser Zeit. In der Ecke ein Treppenturm. Details der Spitze des Treppenturms. Details des Abschlusses des südlichen Querschiffs mit zwei Fenstern und zwei Reihen Blendarkaden mit Rundbögen. Blick von Südosten auf das östliche Querschiff und die schräg davor gebaute St. Anselm Kapelle. Noch weiter östlich dann der 1179-1226 vom Architekten und Steinmetz William the Englishman (gest. ca. 1214) erbaute Ostchor. Am Ende des Chores eine zentrale Kapelle und rechts und links davon Treppentürme. Blick auf das Chorhaupt. Eine uralte Platane direkt hinter dem Chorhaupt. Memorial Garden auf dem Geländer der Kathedrale. Inneres: Sterngewölbe im Christ Church Portal im Südwesten, mit zahlreichen Wappen als Schlusssteine, errichtet 1505. Blick durch das dreischiffige Langhaus im spätgotischen Perpendicular Style. Es wurde ab 1378 auf den Fundamenten des alten romanischen Kirchenbaus errichtet. Blick in das Gewölbe des ersten Jochs, direkt hinter dem großen Fenster im Westen und den Beginn des Gewölbes vom Langhaus. Farbiges Glasfenster in der Westfassade. In drei Reihen übereinander sind Personen aus der Bibel (zum Beispiel Adam, Seth, Joseph) dargestellt. Darüber Heilige, in der dritten Reihe Könige. Insgesamt gibt es über 1200 qm farbige Glasfenster in der Kathedrale. Ganz oben in kleineren Fenstern wieder Heilige. Gleich hinter dem Eingang ein Taufbecken von 1639. Blick in das Gewölbe des Langhauses. Blick durch das Langhaus zurück zum großen Fenster im Westen. Eine Kanzel aus Holz aus dem Jahr 1898. Auf dem Kanzelkorb die Verkündigung und die Kreuzigung. Dazwischen Engel. Kleine Orgel im nördlichen Seitenschiff von 1980. Darunter mehrere Epitaphe und das Grabmal für William Edward Parry (1790-1855), Marineoffizier und Polarforscher. Epitaph für James George Bearney (1828-1891). Das Bearney House of Art and Knowledge ist nach ihm benannt, weil es von ihm gegründet wurde. Im Boden des Langhauses eine Kompass-Rose, ein Symbol der Anglikanischen Kirche. Entworfen wurde sie von Giles Blomfield (1925-2012) und wurde 1988 hier angebracht. Grabmal für Bischof William Broughton (1788-1853). Etliche Epitaphe und ein Kriegerdenkmal im nördlichen Seitenschiff an der Wand. Vierung beim westlichen Querschiff mit dem Altar und dem dahinter liegenden Lettner. Blick von innen in den 72 m hohen Vierungsturm mit seinem Gewölbe. Vor dem Gewölbe sind noch zwei Obergaden mit Fenstern. Im Gewölbe sind Wappen von Personen abgebildet, die zum Bau des Turmes beigetragen haben. Es sind insbesondere Kardinal John Morton und Prior Thomas Goldstone. Lettner aus dem frühen 14. Jahrhundert. Rechts und links vom Durchgang stehen in Nischen mit gotischen Baldachinen Statuen von Königen. Blick in das südwestliche Querschiff, an der Ecke ein Stand mit Andenken. Gewölbe und farbiges Glasfenster im südwestlichen Querschiff. Details des farbigen Glasfensters im südwestlichen Querschiff. St. Michaels Kapelle, Buffs-Kapelle oder Kriegerkapelle: Diese Kapelle ist an das südwestliche Querschiff angebaut. Sie hat starke historische Verbindungen zum Royal East Kent Regiment, das oft als Buffs bezeichnet wird. Diese Kapelle war unsprünglich normannisch und wurde 1439 wieder aufgebaut, um Lady Margaret Holland und ihren Ehemännern eine angemessene Ruhestätte zu bieten. Blick in die Kapelle mit dem großen Grabmal aus Purbeck-Marmor für 3 Personen in der Mitte. Weiter oben zahlreichen Regimentsflaggen, weitere Grabmäler an der Wand und ein großes, farbiges Glasfenster. Hinten rechts in der Ecke eine Büste mit Perücke von Admiral Sir George Rooke. Er eroberte Gibraltar für England 1703. Zu Füßen des Holland-Grabmals, unter einem kleinen Altar, befindet sich das Grab von Erzbischof Stephen Langton. Er starb 1228 und wurde vor dem Wiederaufbau der normannischen Kapelle beigesetzt. Als die neue Kapelle 1439 wieder aufgebaut wurde, musste Platz für das Holland-Grabmal geschaffen werden und so liegt er jetzt mit den Füßen außerhalb der Kapellenwand. Links in der Ecke das Denkmal für Lady Dorothy Thornhurst Links an der Wand kniet mit roten Hosen Oberstleutnand William Prude auf einem Kissen. Er wurde 1632 bei der Belagerung von Mastricht getötet. Daneben liegend das Grabmal von Thomas Thornhurst und seiner Frau, die neben ihm liegt. Er starb 1627. Blick Richtung Gewölbe und den Regimentsflaggen. Modell eines Segelschiffs. Romanische bzw. normannische Krypta: Der westliche Teil wurde um 1100 unter Prior Ernulf (1039-1124) fertiggestellt. Zahlreiche Details romanischer Kapitelle. Sie sind mit keltischen vorchristlichen Flachreliefs von Tieren, Vögeln, Greifen, Drachen, Monstern und Menschen verziert. Farbiges Grabmal eines Geistlichen in der Krypta, mit Liegefigur und gotischen Formen. Gotisches Maßwerk als Abtrennung. St. Gabriel Kapelle: Hier haben sich schwer zu deutende romanische Wandmalereien erhalten. Einige romanische Kapitelle in der Kapelle. Weitere Kapelle in der romanischen Krypta mit romanischen Kapitellen. In einer Nische mit Rundbogen eine farbige, geschnitzte, sitzende Figur eines Bischofs. Farbiges Glasfenster mit einem Kruzifix davor. Östliche Krypta: Nach seinem Tod 1170 lagen hier die sterblichen Überreste von Thomas Becket. Ab 1220 ruhten sie in der Trinity Chapel, bis diese 1538 auf Anweisung von Heinrich VIII. zerstört wurde. Diese Krypta ist fünfschiffig und wurde ehemals Ende des 11. Jahrhunderts als Unterbau für den romanischen Chor erbaut. Im Zuge der Erweiterungsbauten unter William dem Engländer (gest. 1214), wurde diese Krypta im gotischen Stil erweitert. Eine Rekonstruktion der östlichen Krypta, wie sie zwischen 1171 und 1180 ausgesehen haben könnte. Das Grab von Thomas Becket befand sich vor dem Altar. Heute befindet sich sein Grab in der Trinity Kapelle darüber. An dieser Stelle ist heute unter der Decke eine Figur aus Nägeln angebracht. Kapelle im Chorhaupt der östlichen Krypta mit einem Altar und kunstvoll bestickter Altardecke. Farbiges Glasfenster in der östlichen Krypta. Nordwestliches Querschiff: Von diesem Querschiff ist der Zugang zum Kreugang und zum Kapitelhaus. Zwei gotische Grabmäler unter einem großen Fenster. Links das Grabmal eines Bischofs mit einer Liegefigur aus dunklem Stein. Rechts das Grabmal von Erzbischof William Warham (1450-1532). Er war der letzte Erzbischof von Canterbury vor der Reformation. Auf dem Grab eine Liegefigur im bischöflichen Ornat. Auf dem Sarkophag unter anderem sein Wappen mit einem Zigenbock und 3 Muscheln. Sein Grab und Denkmal, das 1507, also 25 Jahre vor seinem Tod, errichtet wurde, waren die letzten großen erzbischöflichen Denkmäler Canterburys, zumindest bis zur Wiederbelebung dieses Stils im viktorianischen Zeitalter. Farbiges Glasfenster mit der Darstellung der königlichen Familie. Oben Königin Elisabeth II. mit Prinz Philipp und den Kindern Charles und Anne. Darunter ihre Eltern König Georg VI. und Elisabeth Bowles-Lyon (Queen Mum) mit den Töchtern Elisabeth und Margaret. Am nordwestlichen Querschiff befindet sich Richtung Osten die Chapel of Our Lady of Martyrdom, jetzt The Dean's Chapel. Erbaut 1445 mit einem frühen Beispiel eines Fächergewölbes und mehreren Grabmälern der Dekane der Kathedrale nach der Reformation. Im südlichen Seitenschiff, kurz vor dem südöstlichen Querschiff, haben sich romanische Blendarkaden erhalten. Darüber ein farbiges Glasfenster mit der Darstellung der Flucht nach Ägypten und der Taufe von Jesus durch Johannes. Weiteres farbiges Glasfenster. Blick vom südlichen Seitenschiff Richtung Osten. Rechts geht das südöstliche Querschiff ab.Die beiden östlichen Querschiffe sind 1096-1126 entstanden und gehören mit zu den ältesten Bauteilen der Kathedrale. Grabmal von Sir Thomas Neville (ca. 1429-1460). Darunter romanische Blendarkaden. Blick in das südöstliche Querschiff, an dem sich Richtung Osten zwei Kapellen befinden. Zwei moderne farbige Glasfenster im unteren Bereich des Abschlusses des Querschiffs. Oben ein rundes farbiges Glasfenster mit den 12 Aposteln und den Symbolen der Evangelisten. Weiteres rundes farbiges Glasfenster. Farbiger Schlussstein in einem Kreuzrippengewölbe mit dem Lamm Gottes und 4 Engeln. Östliche Vierung: Blick in den frühen gotischen Chorraum, der sich hinter dem Lettner befindet, mit seinem Chorgestühl und einem goldfarbenen Lesepult mit Adler. Nach dem Brand 1174 wurde der Chor im gotischen Stil wieder erbaut. Er gilt als das erste gotische Bauwerk in England und war, zusammen mit der Kathedrale von Lausanne, einer der ersten gotischen Bauten außerhalb Frankreichs. Blick durch den gotischen Chorraum mit seinem Kreuzrippengewölbe Richtung Westen mit dem Lettner und im Hintergrund die westliche Vierung und das Gewölbe des Langhauses. Blick zum Hauptaltar im Chor und der dahinter liegen Trinity Chapel im Osten. Die typische drei geteilte Wandgestaltung mit Obergaden, Triforium und dem spitzbogigen Untergaden mit dem dahinter liegenden Chorumgang. Blick vom Chor auf das Grabmal von Erzbischof Henry Chichele (1362-1443): es handelt sich um ein Momento-Mori-Grabmal. Oben liegt der Bischof in seinem bischöflichen Ornat, flankiert von 2 Engeln und 2 Mönchen. Im Sockel des Grabes ein Abbild des abgemagerten Leichnams. Das Grabmal wurde schon zu Lebzeiten des Erzbischofs angefertigt. Rechts und links der Liegefigur oktogonale Säulen, die von oben bis unten mit Nischen und gotischen Baldachinen versehen sind. In ihnen stehen Statuen von Heiligen, Bischöfen und einem König. Blick vom nördlichen Chorumgang auf das Grabmal. Weiteres gotisches Grabmal, allerdings ohne Namen. Gotisches Grabmal von Erzbischof Johannes Stratford (ca. 1275-1348). Vitrine mit großen Osterkerzen. Grabmal von Eduard of Woodstock, genannt der „Schwarze Prinz“.(1330-1376). Geboren als Prince of Wales und Aquitanien hieß er eigentlich Eduard Plantagenet. Er war der Sohn von Eduard III. und Thronfolger bis zu seinem frühen Tod mit 45 Jahren an der Ruhr. Da er sich seines Sterbens bewusst war, legte er in seinem Testament seinen Bestattungsort mit genauen Bestimmungen zur Gestaltung seines Grabes fest. Auf dem Grab eine Liegefigur aus vergoldeter Kupferlegierung mit einer sehr detailierten Rüstung. Auf dem Sarkophag mehrere Wappen. Das Denkmal steht innerhalb eines hohen, schützenden Eisentors und unter einem Wappenschild, das einst seine heraldischen Errungenschaften enthielt . Über den Grab Kopien von heraldischen Kleidungsstücken. Farbige Glasfenster, dem Grab gegenüber. Weitere farbige Glasfenster im südlichen Chorumgang. Achtteiliges Kreuzrippengewölbe mit teilweise vergoldetem Schlussstein und Mondsichel. Grabmal, Sarkophag von Erzbischof Hubert Walter (gest. 1205), Justitiar und Lordkanzler. Auf dem Deckel des Sarkophages 4 Köpfe, unten Blendarkaden. Teil eines farbigen Glasfensters über dem Sarkophag. Farbiges Glasfenster. Corona: dies ist das östliche Ende der Kathedrale und ist nach der abgeschlagenen Krone von Thomas Becket benannt, für dessen Schrein sie errichtet wurde. Becket wurde am 29. Dezember 1170 im nordöstlichen Querschiff der Kathedrale ermordet. Vier Jahre später zerstörte ein verheerender Brand das östliche Ende der Kirche. Nachdem Wilhelm von Sens den Chor wieder aufgebuat hat, fügte Wilhelm der Engländer diese Kapelle hinzu. Die Einnahmen der Pilger, die Beckets Schrein besuchten, der als Ort der Heilung galt, finanzierten größtenteils den späteren Wiederaufbau der Kathedrale und der dazugehörigen Gebäude. Die drei farbigen Glasfenster der Corona. Blick in das Gewölbe, das Triforium und Ober- und Untergaden der Corona. Blick Richtung Westen, die Corona im Rücken. Vorne die Trinity Chapel mit zwei weiteren Grabmälern. In der Mitte die Rückseite des erzbischöflichen Throns, die östliche Vierung, dahinter der Chor mit dem Chorgestühl, Lettner und im Hintergrund das Gewölbe des Langhauses. In der Mitte der Trinity Chapel eine einzelne brennende Kerze. Sie symbolisiert den einstigen Standort des prächtigen Schreins von Thomas Becket, bis er auf Befehl Heinrichs VIII. im Jahr 1538 zerstört wurde. Erhalten blieb das in den Boden eingelegte Opus Alexandrinum-Pflaster aus dem 12. Jahrhundert. Grabmal eines Geistlichen, knieend vor einem Altar dargestellt. Grabmal aus Alabaster von Dekan Nicholas Wotton (1497-1567). Das Grab zeigt Wotton, wie er in akademischer Kleidung vor einem Schreibtisch kniet. Zahlreiche Motive der Renaissance umgeben ihn, wie zum Beispiel ein Obelisk und korinthische Säulen. Der Künstler ist unbekannt. Weitere farbige Glasfenster. Trinity Chapel und das in den Boden eingelegte Opus Alexandrinum-Pflaster aus dem 12. Jahrhundert. St. Andrew's Chapel: Die St. Andreas Kapelle, gehört genauso wie die St. Anselm Kapelle zu den beiden schräng vor dem Chorhaupt erbauten Kapellen aus der Zeit 1096-1126. Innen haben sich noch einige Wandmalereien erhalten. Nordöstliches Querschiff: Blick auf das Seitenschiff im Norden des Chores und das rechts liegende nordöstliche Querschiff. Das nordöstliche Querschiff entstand ebenfalls 1096-1126. Hier wurde Thomas Becket ermordet. Blick in das Gewölbe, das Triforium und auf das runde farbige Glasfenster. Grabmal eines Erzbischofs im nordöstlichen Querschiff. Im Hintergrund weitere Grabmäler in der östlichen Vierung und das südöstliche Querschiff ganz hinten. In der östlichen Wand zwei Kapellen. Details der beiden Kapellen mit jeweils einem farbigen Glasfenster. Blick Richtung östlicher Vierung und südöstlichem Querschiff. Wandmalereien, darüber romanische Rundbögen. Oben Menschen in einem Kessel in der Form eines Stieres über dem Feuer. In der Mitte ein Fluss mit mehreren Booten, flankiert von mehreren Personen. Untern der heilige Hubertus mit Pferd und Hunden, der vor dem Hirsch kniet. Wasserturm: Im Norden der Kathedrale, vom nordöstlichen Querschiff aus erreichbar, liegt zwischen der Bibliothek und der Howley Bibliothek der runde Wasserturm, der im unteren Geschoss noch romanisch ist. Blick in das Innere mit farbigen Glasfenstern mit Heiligen und einigen Wappen. Zurück in der Kathedrale im nordöstlichen Seitenschiff – farbige Glasfenster. In einem Fenster unter anderem das letzte Abendmahl, in dem anderen Fenster die Geburt Jesu mit den heiligen 3 Königen. Blick nach Westen durch das Langhaus zum großen Westfenster, kurz der der westlichen Vierung. Grabmäler in nördlichen Seitenschiff: Das Hales-Memorial aus Alabaster, für 4 Mitglieder der Familie Hales. Unten kniet die Ehefrau von Sir James Hale. Er starb auf See nach dem Angriff auf Cadiz im Jahr 1589, als bewaffnete Gestalt von einem Segelschiff aus ins Wasser gelassen wird. Ganz unten sein knieender Sohn. Grabmal von Sir John Boys (gest. 1612) mit ihm halb liegend in der Kleidung eines Gelehrten. Seine beiden Frauen knien unterhalb der liegenden Statue. Flankiert wird er von zwei Säulen, oben sein Wappen. Kriegerdenkmal und mehrere Epitaphe. Darunter das Grabmal mit Liegefigur von Erzbischof John Bird Sumner (1780-1862) Grabmal für William Edward Parry (1790-1855), Marineoffizier und Polarforscher. Kriegerdenkmal mit Kranz aus Rememberance Poppies (künstlichen roten Mohnblumen) Neugotisches Grabdenkmal für William Rowe Lyall (1788-1857), Dekan von Canterbury. Kreuzgang: 1396–1420 wurde auf der Nordseite des Langhauses der Kreuzgang mit dem rechteckigen Kapitelsaal angelegt. Man erreicht den gotischen Kreuzgang vom nordwestlichen Querschiff. Südliche Galerie des Kreuzganges mit der Tür zur Kathedrale. Westliche Galerie des Kreuzganges. Details des Sterngewölbes mit zahlreichen Schlusssteinen mit Wappen und floralen Motiven. Blick über den Hof des Kreuzganges zur Fassade des Kapitelhauses mit dem großen Fenster. Blick auf die nordwestliche Ecke des Kreuzganges mit einem dahinter liegenden Gebäude. Details des Gewölbes mit Schlusssteinen, die Gesichter zeigen. Kleine Tür in der östlichen Galerie, die aus dem Kreuzgang heraus führt, direkt neben der Tür zur Kathedrale. Daneben Sitzbänke aus Stein. Östliche Galerie mit dem Zugang zum Kapitelhaus. Details des Sterngewölbes in der östlichen Galerie mit zahlreichen Wappen als Schlusssteinen. Blick über den Hof des Kreuzganges Richtung Westen zu den Türmen der Kathedrale. Blick über den Hof Richtung Nordwesten. Im Hof sieht man einige Grabsteine. Chapterhouse, Kapitelhaus: Der Kapitelsaal, der größte in England, war von der Zeit des ersten normannischen Erzbischofs Lanfranc (1070-1093) bis zur Auflösung der Klöster unter Heinrich VIII. im Jahr 1540 der tägliche Treffpunkt der Benediktinermönche. Blick durch den Saal in Richtung auf das große farbige Glasfenster im Osten. Auf der Ostseite der Thron des Priors, der auf beiden Seiten von Bänken aus Stein flankiert wird, die sich auf beiden Seiten um die Mauern fortsetzen. Details des farbigen Glasfensters von 1896. In der unteren Reihe 2. von links König Heinrich VIII., rechts Königin Victoria und einige Äbte. Darüber weitere Äbte und Könige. Ganz oben links Königin Bertha und der 3. von links König Aethelberht und am oberen Ende Wappen. Details des Gewölbes, ein sogenanntes Wagengewölbedach. Es ist aus irischer Eiche aus dem frühen 15. Jahrhundert. Blick durch den Saal nach Westen zum großen farbigen Glasfenster von 1903, mit Darstellungen aus der Geschichte der Kathedrale. 2. Reihe von unten ganz links zum Beispiel die Ermordung vonThomas Becket. Tür zur Bibliothek in der östlichen Galerie. Nördliche Galerie Blick von der nördlichen Galerie auf das Langhaus der Kathedrale, links die Fassade des Kapitelhauses. Blick von der nordwestlichen Ecke des Kreuzganges auf den Vierungsturm der Kathedrale und die Fassade des Kapitelhauses. Links daneben der Giebel der Bibliothek. Details des Sterngewölbes mit Wappen als Schlusssteinen. Tor aus Metall zum Garten des alten Bischofspalastes. Historisches Gebäude der Erzdiakonie mit Ruinen von Gewölben. Oktogonaler, romanischer Wasserturm im Norden des nordöstlichen Querschiffes von außen. Buntes Plakat als Werbung für die Kathedrale von Canterbury.
-
Rückfahrt mit der Fähre von Dover. Die weißen Kreidefelsen sind teilweise über 100 Meter hoch. Fährhafen mit den Kreidefelsen. Blick auf die Kreisefelsen mit Wiesen und Wegen mit Spaziergängern. Fähre von DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab) mit schwarzem Rauch am Fährhafen. Autoschlange. Blick von der Fähre auf die Auffahrt zur Fähre. Details der Hafenanlage Arbeiter an der Festmacherstrosse an einem Poller am Hafen. Fähre der Irish Ferries an der Mole. Die Fähre legt ab. Blick zurück zum Hafen. Hafenmolen mit den Kreidefelsen dahinter. Hafen mit einer Fähre von P&O, dahinter die Küste mit den Kreidefelsen. Blick zurück auf den Hafen mit der irischen Fähre und 2 Kreuzfahrtschiffen. Häuser und ein Kirchturm auf den Kreidefelsen. Links neben dem Kirchturm ein römischer Leuchtturm. Hinten rechts das Dover Castle. Mole Möwe im Flug vor den Kreidefelsen. Kreidefelsen mit mehreren Sendemasten. Silbermöwe im Flug. Auf den Kreidefelsen weiter östlich St. Margarets Bay mit dem Oberlisk des Patrol Memorial im Hintergrund. Boot der britischen Grenzkontrollen vor den Kreidefelsen. Leuchtturm auf den Kreidefelsen. Segelboot vor der Künste mit einem kleinen Ort Dover Castle, die Kirche und der römische Leuchtturm von Weitem. Mond am blauen Himmel. Dünkirchen oder Dunkerque von Weitem. Leere Containerschiffe im Kanal. Landschaft um Dunkerque Segelboot vor der Küste. Hafenanlagen
Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.