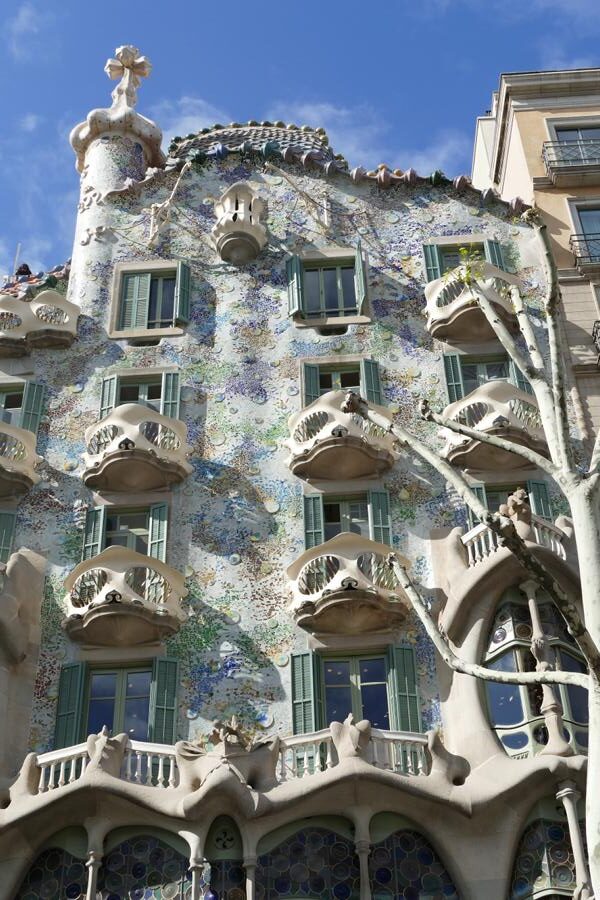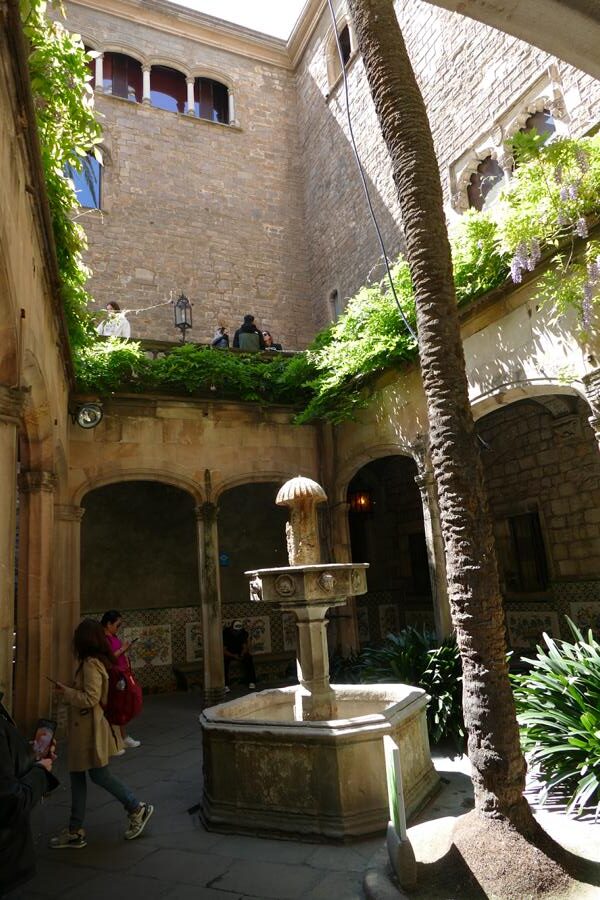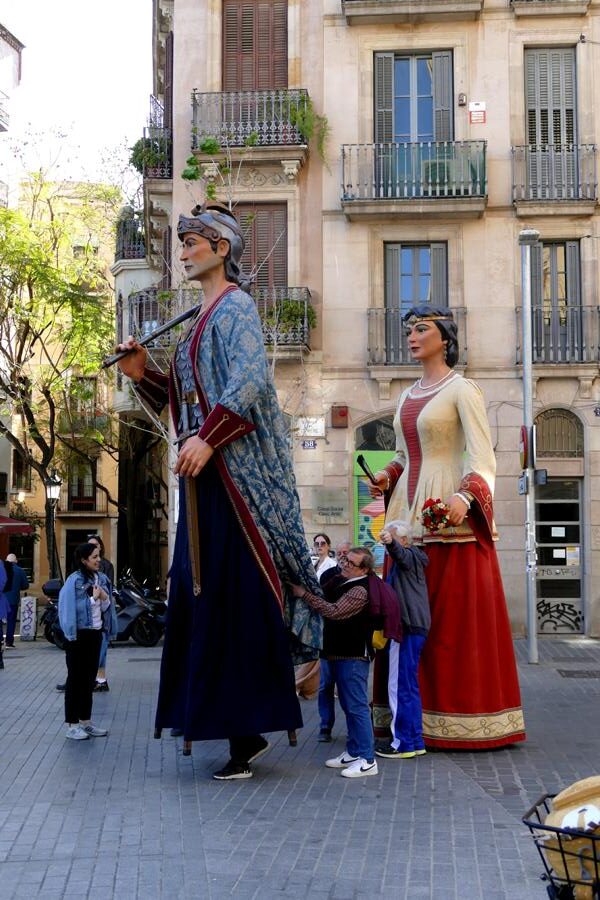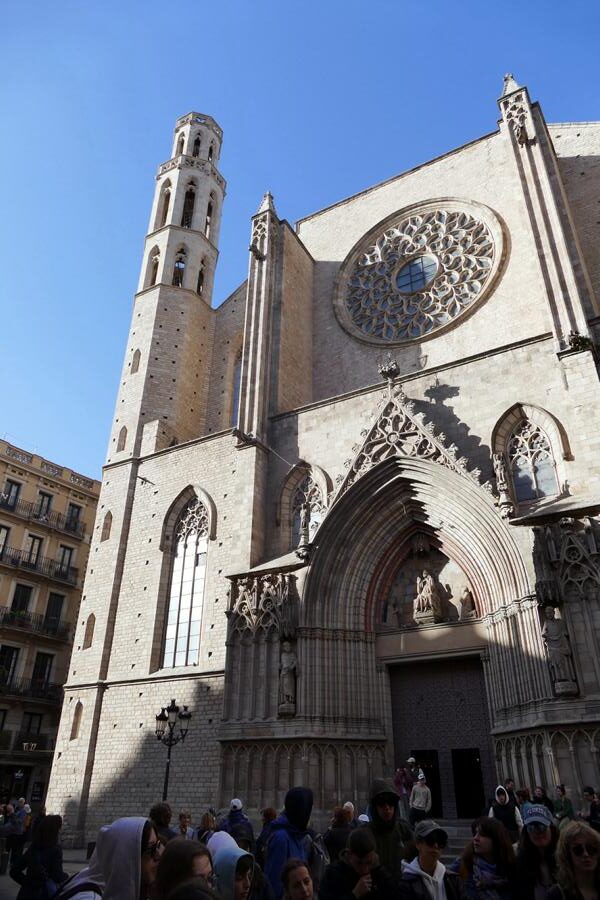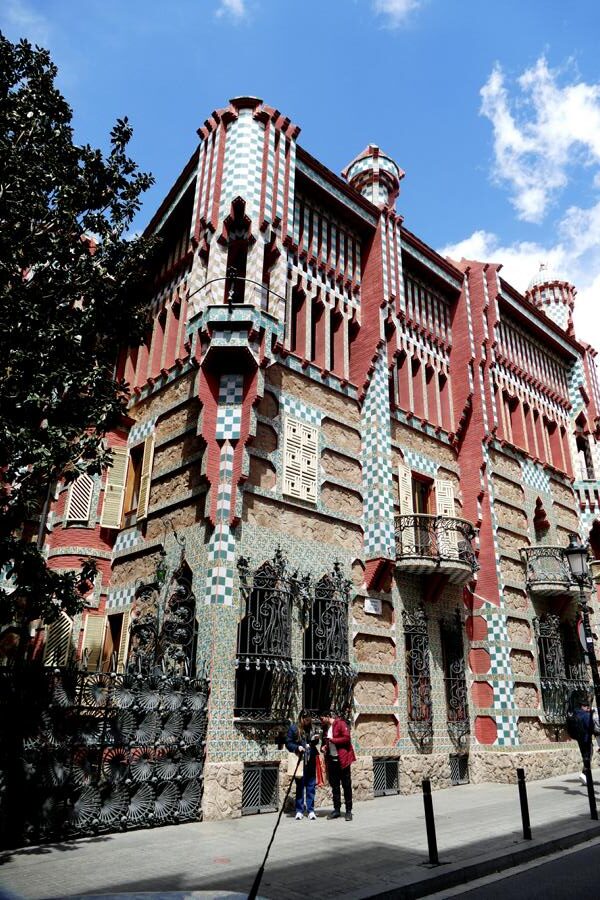Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.
Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular
Barcelona 16.-23.04.2024
-
Flug mit der spanischen Fluggesellschaft Vueling. Ein lustiger Spuckbeutel.
Luftaufnahmen: Schneebedeckte Berge in den französischen Alpen.
Pyrenäen
Hafen von Barcelona
Der Fluss El Llobregat. Der zweitlängste Fluss Kataloniens mündet gleich neben dem Flughafen in das Mittelmeer. -
Barcelona: Barcelona ist mit fast 2 Millionen Einwohnern, die zweitgrößte Stadt Spaniens und die Hauptstadt Kataloniens. Sie liegt am Mittelmeer und ist nur 120 km von den Pyrenäen und der französischen Grenze entfernt. Mit jährlich mehr als sieben Millionen Touristen aus dem Ausland zählt Barcelona zu den drei meistbesuchten Städten Europas.
Über die Ursprünge von Barcelona ist nur wenig bekannt. Man fand Artefakte aus der Jungsteinzeit und der Kupfersteinzeit. Im 3. und 2. vorchristlichen Jahrhundert war die Gegend von den Laietani, einem iberischen Volk besiedelt. Auch eine kleine griechische Kolonie namens Kallipolis hat in dieser Gegend existiert. 218 v. Chr., am Beginn des Zweiten Punischen Krieges, wurde die Gegend von den Karthagern unter der Führung des Vaters von Hannibal, Hannibal Barkas, erobert. Diese militätrische Eroberung wird als die Gründung Barcelonas angenommen. Es gibt nur wenige Erkenntnisse über die Zeit zwischen 218 vor Christus und der Zeitenwende. Obwohl sich die Römer in „Barcino“ niederließen, ein Name der am Ende der Herrschaft von Augustus beschlossen wurde, war es eher nur ein Militärlager, ein „castrum“. Das Forum, heute die Plaça de Sant Jaume, befand sich an der höchsten Erhebund des Barri Gòtic, dem heutigen Gotischen Viertel. Im 2. Jahrhundert war die Stadt zu einem richtigen „oppidum“ geworden, mit 3500-5000 Einwohnern, die von der Kultivierung der Umgebung und dem Weinbau lebten.
Die ersten christlichen Gemeinschaften in der Provinz Tarragonas wurden während des dritten Jahrhunderts gegründet. Die christliche Gemeinde von Barcino scheint in der späteren Hälfte des 3. Jahrhunderts aufgebaut worden zu sein. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts, unter Diokletian, wurden die Christen verfolgt, bis Kaiser Konstantin 313 mit dem Edikt von Mailand den Christen Religionsfreiheit gewährte. Unter des Westgoten begann im 5. Jahrhundert der Verfall des weströmischen Reiches.
Die Truppen der Mauren erreichten die iberische Halbinsel im Jahr 711. Nach der Zerstörung Tarragonas im Jahr 717 ergab sich Barcelona und wurde dadurch vor größerer Zerstörung bewahrt. Die Herrschaft der Mauren in Barcelona dauerte weniger als ein Jahrhundert. Die Kathedrale wurde in eine Moschee umgewandelt. Der Sohn Karls des Großen, Ludwig der Fromme, eroberte 801 Barcelona. Die Stadt war die südlichste seiner Eroberungen von den Mauren.
Diese Grenzregion wurde als Spanische Mark bezeichnet. Sie wurde von mehreren Grafen verwaltet, die vom König eingesetzt wurden. Barcelona wurde zum Sitz eines Grafen. Die ersten karolingischen Grafen Barcelonas waren nur wenig mehr als königliche Beamte, doch im Lauf der Zeit gewann ihr Status an Macht und Unabhängigkeit von der Zentralgewalt und den schwachen karolingischen Königen. Durch den Ehevertrag zwischen Ramon Berenguer IV., Graf von Barcelona, und der erst einjährigen Petronella, Erbin der Krone Aragoniens, entstand 1137 aus Aragonien und den im 12. Jahrhundert mit Katalonien weitgehend identischen Ländern der Grafen von Barcelona eine Staatsgemeinschaft, die als „Krone Aragonien“ bekannt ist.
Die Hochzeit von Ferdinand II. von Aragonien mit Isabella I. von Kastilien im Jahr 1469 vereinigte die zwei Königsgeschlechter Spaniens. Dadurch verlagerte sichdas politische Zentrum nach Toledo und später, unter dem Habsburger Philipp II. nach Madrid, und degradierte die einstige Krone Aragonien zur Provinz. Darüber hinaus musste Barcelona, wie viele spanische Städte am Mittelmeer, einen gewaltigen Handelsrückgang und Bedeutungsverlust durch die Entdeckung Amerikas hinnehmen.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Stadt einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung und wurde ein Zentrum der industriellen Entwicklung Spaniens, wodurch Reichtum und politischer Einfluss in die Region zurückkehrten. -
Fahrt mit dem Shuttle-Bus in die Innenstadt von Barcelona:
Gebäude aus Backsteinen, schuppig wirkenden Wänden und einem Glockenturm.
Fassade eines Mietshauses im Stil des Modernisme. Der Modernisme ist eine kulturell-gesellschaftliche Erneuerungsbewegung im katalanischsprachigen Raum, die unter anderem auch in der Architektur ihren Ausdruck fand. Der Modernisme war Teil einer Strömung, die ganz Europa erfasste. Ér entsprang dem Überdruss an der historisierenden Ästhetik des 19. Jahrhunderts, mit ihren neugotischen und neuromansichen Formen. Architektonisch entwickelte sich diese Bewegung möglicherweise zur am weitesten fortgeschrittenen Form des Jugendstils oder Art Nouveau. Im weiteren wird der Begriff Jugendstil bei der Architektur verwendet.
Las Arenas: In der ehemaligen Stierkampfarena wurde ein Einkaufszentrum eingebaut.
Fassade eines Mietshauses im Jugendstil, angestrahlt bei Nacht.
Details der Balkone.
Detail des Giebels.
Restaurant „2254“ von Nuncio Cona: Titelseite der Speisekarte, Blick in das immer gefüllte, sehr gute Restaurant.
Spaghetti werden in erhitztem Käse gewälzt.
Blick in die kleine Bar „Pink Corner“, in der uns das Frühstück serviert wurde.
An der Kreuzung Carrer de Balmes, Ecke Carrer del Consell de Cent das Gebäude der Philosophischen Fakultät der Ramon-Llull-Universität.
Kinder aus einem Kindergarten, überqueren einen Zebrastreifen.
Orchideenbaum (Bauhinia variegata) an der Straße mit rosa Blüten.Ungewöhnliche Briefkästen in einem Mietshaus.
Blick von der Carrer de Balmes auf den, nördlich der Stadt liegenden Tibidao. Der Berg ist 532 m hoch. Auf seinem Gipfel, inmitten eines Vergnügungsparks, steht die 1961 erbaute Kirche Sagrat Cor. Sie stammt vom Architekten Enric Sagnier (1858-1931) und weist gotisierende Formen auf.
Laden mit spanischem Schinken und anderen Spezialitäten.
Fassaden von Mietshäusern im Jugendstil in der Carrer de Balmes. Detail einer Eingangstür.
Fassade eines Mietshauses von 1894 mit zahlreichen Erkern aus Glas.
Casa Jaume Satlló an der Kreuzung Carrer D’Aragó / Rambla de Catalunya. Jugendstil. Details des Eingangs, der Erker aus Glas und der floralen Balkongitter.
Museum Fundacio Antoni Tapies an der Carrer d’Aragó 255. 1984 von dem Künstler Antoni Tàpies gegründet. Es ist auch ein Kulturzentrum, das für das Studium der modernen Kunst gebaut wurde. Das Gebäude eines früheren Verlages stammt vom Architekten Lluís Domènech i Montaner (1849-1923) und wurde aus Backsteinen zwischen 1880 und 1881 im frühen Stadium des katalanischen Modernisme bzw. Jugendstil gebaut.
Details der Gitters aus Metall in der Form eines Adlers vor den Kellerfensters.
Daneben ein Haus mit Erkern aus Glas und Balkonen mit Gittern aus Metall. Jugendstil.Weitere Fassade eines Hauses in der Carrer d’Aragó mit Erkern aus Glas und Balkonen mit Gittern aus Metall. Jugendstil.
Detail der Pflastersteine auf dem Bürgersteig mit Formen des Jugendstils bzw. Modernisme.
Aufgespannter Regenschirm als Verkaufsfläche für Ohrringe.
Blick auf die Straßenecke mit den Fassaden der Casa Batlló und die daneben stehende Casa Ametller.
-
Casa Batlló:
Passeig de Gràcia 43. Das im Jahr 1877 errichtete Gebäude wurde für den Textilindustriellen Josep Batlló i Casanovas in den Jahren 1904 bis 1906 im Stile des Modernisme von Antoni Gaudí (1852-1926) von Grund auf umgebaut. Gaudí arbeitete dabei mit Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949) und Joan Rubió i Bellver (1871-1952) zusammen. Die farbenfrohe Fassade gibt die Legende des Heiligen Georg – hier Sant Jordi – wieder, des Schutzheiligen Kataloniens. Das Dach stellt die Schuppen des Drachens dar, gegen den der Heilige Georg kämpft, das Kreuz auf dem Dach ist seine Lanze. Die schmiedeeisernen Balkone stehen für Totenköpfe und die Galerie im ersten Stock für das Maul des Drachens. Seit 2005 wurde die Casa Batlló zusammen mit anderen Werken Gaudis in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Heute gehört das Gebäude der Familie Bernat (Gründer von Chupa Chups).Die Fassade und Details der Fassade.
Blick auf das Dach mit den Dachziegeln, die wie Schuppen wirken, die oberen Balkone und den kleinen Turm mit dem Kreuz auf dem geschwungenen Dach.
Die Balkone in den unteren Etagen und die bunte, mit Teilen von Fliesen und Glas verzierte Fassade. Gaudí war ein Meister und Pionier des Recycling.
Der große, verglaste Galerie in der 1. Etage.
Detail der Brüstung der Galerie in der 1. Etage.
Eingangstürem im Erdgeschoss.
Inneres:
Der Schwerpunkt des von Gaudí 1904 begonnenen Umbaus des vorhandenen Hauses, orientierte sich an der Bedürfnissen der Bewohner. Der Keller wurde Kohlenlager und Abstellfläche für die Hauptwohnung in der 1. Etage, das Erdgeschoss sollte als Garage dienen. Hier befanden sich auch die Aufgänge zu den 8 Mietwohnungen. Als Abschluss wurde ein Dachbogen und eine Dachterrasse errichtet.
Fliesen aus Keramik in blauen Tönen kleiden den Eingangsbereich und den Innenhof aus.
Eingang der Familie Batlló mit einem eigenen Foyer.
Gemeinschaftsfoyer mit der Treppe zu den Wohnungen.
Fenster der Pförtnerloge.
Große Keramiktöpfe mit floralen Motiven auf Füßen aus Metall stehen unter der Treppe die zur Wohnung des Eigentümers führt.
Detail des Treppengeländers.
Eingangsbereich. Die Gitter aus Schmiedeeisen und das Glas sorgen für Sicherheit und Tageslicht im Foyer.
Deckenleuchte.
Blick vom Fahrstuhl in den Innenhof mit den hellblauben Fliesen.
Deckenleuchte im Fahrstuhl.
Ende der Treppe in der ersten Etage. Die Oberlichter haben ovale Formen. Die Treppe und die Türen sind aus Holz.
Blick in den zentralen Innenhof. Gaudí erweiterte ihn, um das ganze Haus mit Licht und Luft zu versorgen, was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Er ist 13 m lang, 4 m breit und 26 m hoch.
Wohnung der Familie Battloó. Sie war mit 400 qm die größte Wohnung im Gebäude. Bunte runde Glasscheiben schmücken die Türen, die zum Wohnzimmer führen.
Wohnzimmer mit abgehängter Decke in der Form eines Strudels. Die Fenster zeigen zum Passeig de Gràcia. Da es mittels Falttüren mit zwei kleineren Räumen verbunden war, konnten hier gesellschaftliche Veranstaltungen stattfinden. Im oberen Bereich der Fenster wieder bunte, runde Glasscheiben
Die Decke in Form eines Strudels mit einem Kronleuchter in der Mitte.Details der Fenster von innen.
Durchgang mit Falttüren zu den Nebenräumen, die ebenfalls Kronleuchter an der Decke haben.
In einem extra Raum hatte Herr Battlò sein Büro eingerichtet, der über einen Kamin verfügt. Gaudí schuf einen pilzförmigen Hohlraum in der Wand, in dem er einen organisch gestaltenen Kamin mit zwei Sitzbänken einfügte. Der Bereich ist mit braunen Fliesen ausgestattet.Raum mit einer kleinen Bühne.
Tür aus Holz mit Türspion.
Deckenleuchten.
25 qm große Esszimmer im hinteren Teil der Wohnung. Die Fenster gehen raus zum privaten Innenhof, der durch eine Tür mit innen befindlichen Doppelsäulen zugänglich ist.
Deckenleuchte im Esszimmer. Die Deckeform soll Wassertropfen zeigen, um das Meeresambiente des ganzen Hauses zu unterstreichen.
Die Tür weist ein organisch gestaltetes Relief auf.
2 zusammenhängende Stühle, eine Doppelsitzbank aus Eschenholz vor einem Fenster im Esszimmer.
Blick auf den privaten, 230 qm großen Innenhof, der gerade restauriert wird.
Treppe aus Holz. Ab und zu hört man den Drachen von Barcelona, wie er die Treppen nach oben steigt.
Einer der Räume, die auf den Innenhof rausgehen.
Eines der 32 Fenster, die in unterschiedlicher Größe auf den zentralen Innenhof zeigen. Der obere Teil diente dem Licht und der untere Teil zeigt Luftöffnungen für die Belüftung.
Modell der Casa Battló vor einem Fenster.
Blicke in den Innenhof.
Gestaltung eines Treppenhauses mittels zahlreicher hängender Ketten, die zu Mustern gefügt sind.
Dachboden, konzipiert als rein funktionelle Konstruktion, die den gemeinschaftlichen Servicebereich beherbergte. Gaudí entwarf eine selbsttragende Sturktur, die mit Hilfe von Kettenbögen die Gewölbe stützen.
Blick von oben in den Innenhof, hier mit dunkelblauen Fliesen, darüber ein lichtdurchlässiges Dach. Das gewellte Geländer und die gewellten Glasscheiben zum Innenhof erinnern an die Wellenbewegung des Meeres.
Blick in die Waschküche im Dachboden.
Treppen hinauf auf die Dachterrasse.
Ausstellungsraum mit Fotos von der Restaurierung
Dachterrasse, der zur damaligen Zeit kaum Beachtung geschenkt wurde. Hier konnte Gaudí seiner Kreativität freien Lauf lassen. 4 Schornsteingruppen und Belüftungsschächte, sowie ein weiterer kleiner Dachboden machen diese Ebene zu einer Fantasielandschaft. In der Mitte der 300 qm großen Terrasse befindet sich ein Oberlicht – das lichtdurchlässige Dach des zentralen Innenhofes.
Mit Scherben von Fliesen verzierte Belüftungsschächte.
Gruppe von Schornsteinen bzw. Kaminen.
Detail des Dachfirstes.
Blick von dem Café über die Dachterrasse.
Blick von oben auf die Restaurierungsarbeiten an der privaten Dachterrasse.
Ein Weg führt rund um das Oberlicht über die Dachterrasse.
Blick auf den Kreuz auf dem Dach.Blick auf die umliegenden Häuser.
Blick nach Süden auf den Palau Nacional auf dem Montjuïc.
Blick über die Dächer der umliegenden Häuser.
Modernistische kleine Kuppel auf einem Haus in der Nähe.
Detail einer Kuppel mit bekrönender Plastik eines Menschen und eines Vogels. -
Casa Ametller:
Passeig de Gràcia 41. Das Wohn- und Geschäftsgebäude stammt aus dem Jahr 1875, wurde aber kulturhistorisch erst bedeutend durch den Umbau im Stil des Modernisme, Jugendstil in den Jahren 1898-1900 durch den Architekten Josep Puig i Cadafalch (1867-1956). Das Haus befindet sich direkt neben Antoni Gaudis Casa Batlló und gehört zum Gebäudeensemble, das als „Häuserblock der Zwietracht“ oder „Zankapfel“ bekannt ist. Die beiden Häuser stehen an der Kreuzung Carrer Aragó / Passeig de Gràcia. Der Passeig de Gràcia war im damaligen Neubaugebiet Eixample enstanden und entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem edlen Boulevard. Das katalanische Bürgertum hatte es durch die industrielle Revolution in Barcelona zu Ansehen und Wohlstand gebracht, wodurch sein erstarktes Selbstbewusstsein in luxuriösen Stadtresidenzen zum Ausdruck kam. Der Modernisme erschien den Bürgerfamilien als angemessenes Ausdrucksmittel, da er besonders regionaltypisch für Katalonien war und dabei Modernität mit den Idealen der Renaixança, der katalanischen Renaissance, verknüpfte.
Der Schokoladenfabrikant Antoni Amatller i Costa kaufte sich hier ein Mehrfamilienhaus und ließ es im Stil des Modernisme, Jugenstil umbauen. Die zahlreichen Steinplastiken stammen von den Bildhauern Alfons Juyol i Bach (1862-1917) und Eusebi Arnau i Mascort (1863-1933). Der von seiner Frau geschiedene Ametller zog mit seiner Tochter in die 1. Etage, die Beletage, die Wohnungen darüber wurden vermietet. Im Dachgeschoss befand sich das private Fotoatelier von Ametller.
Cadafalch ließ die komplette Fassade des bestehenden Hauses abreißen und durch eine horizontal asymmetrische, dreigeteilte Fassade ersetzen. Die drei Fassadenteile haben alle eine unterschiedliche Höhe und jedes Geschoss hat eine unterschiedliche Anzahl von Fenstern bzw. Türen.
Das Erdgeschoss ist nur in Teilen dekoriert und wurde aus Montjuïc-Stein erbaut. Der Eingang ist dekoriert mit Steinplastiken von Eusebi Arnau i Moascort (1863-1933), die die Legende vom Drachentöter Sant Jordi zeigt.
Den vier Wohnetagen darüber, setzte Cadafalch eine mit ocker-farbenen Sgraffiti dekorierte, quadratische Fassade vor, die an ein Stück Schokolade erinnern soll.
In der Beletage links neben einem Fenster, mit an Gotik erinnernden Maßwerk, die Statue einer Frau mit Blüten im Arm.
Daneben 3 bodengleiche Fenster zu einem Balkon mit Tierskulpturen, die auf den Beruf und die Hobbys Antoni Amatllers hinweisen.
Noch weiter rechts in der Beletage ein kleiner Balkon mit einem neugotischen Erker des Bildhauers Alfons Juyol i Bach. Am Dach des Erkers befinden sich Chimären, wie man sie von gotischen Kirchen kennt. Dort ist auch der Buchstabe A als Initiale des Nachnamens des Hausbesitzers zu erkennen.
Auch in der 2. Etage befindet sich ein kleiner Balkon mit bodengleichen Fenstern.
Für das Dachgeschoss wählte Cadafalch einen mit Fliesen verzierten, abgestuften Giebel, der an die Architektur Flanderns erinnert. Gleichzeitig wird durch die dreieckige Form einmal mehr die Initiale A angedeutet.
Details der Fenster und Verzierungen an der Fassade.
Casa Lleo Morera: Passeig de Gràcia 35. Im Stil des Modernisme bzw. Jugendstil entworfen vom Architekten Lluís Domènech i Montaner. Die Besitzerin Francesca Morera i Ortiz gab 1902 den Auftrag für die Umgestaltung der vorheringen Casa Rocamora. Ihr Sohn gab dem Gebäude nach Fertigstellung 1905 seinen Namen – Albert Lleó i Morera. Es ist eines der drei Gebäude, errichtet von den großen Architekten des Modernisme – Gaudí, Puig i Cadafalch und Domènech i Montaner – die zusammen mit der Casa Batlló und der Casa Amatller den berühmten Komplex Mansana de la Discòrdia oder Block der Zwietracht bilden. Von diesen dreien ist die Casa Lleó i Morera das einzige. welches 1906 den Jahrespreis der Stadt Barcelona für das künstlerisch wertvollste, im Vorjahr fertiggestellte Gebäude erhielt.
Das Gebäude steht auf einer unregelmäßigen Grundfläche. Um die Asymmetrie zwischen den beiden Teilen der Fassade zu verbergen und platzierte der Architekt im 1. und 2. Obergeschoss Balkone und einen Erker an der Ecke.
Straßenlaternen am Passeig de Gràcia. Die Laternen sind mit Sitzbänken kombiniert und wurden von Pere Falqués (1850-1916) entworfen. Der Passeig de Gràcia ist ein weiterer Prachtboulevard in Barcelona. Er ist 1,5 km lang und führt durch den Stadtbezirk Eixample.
Passeig de Gràcia 27. Mietshaus von 1908 im Stil des Modernisme, der katalanischen Variante des Jugendstils.
Vögel und florale Elemente stürzten als Konsolen den Balkon und die Erker in der 1. Etage.
Blick zum blau dedeckten Dach mit einer schmiedeeisernen Plastik und einem Drachen an der Wetterfahne auf dem kuppelartigen Walmdach.
Blick auf das Dach von Passeig de Gràcia 26, mit Formen des Modernisme und einem Drachen.
Passeig de Gràcia 24. Detail einer Fassade und eines Hufeisenbogens, ganz im maurischen Stil.
An der Kreuzung mit der Gran Via de las Corts Catalanes steht der Palau Market, in dem sich seit 1960 ein Kino befindet. Das im eklektistischen Stil von 1887-1890 errichtete, ehemalige Wohnhaus, war von 1936-1941 ein Theater. Die abgeschrägte Fassade zeichnet sich durch drei Wandabschnitte aus, die deutlich durch Pilaster mit Steinquadern unterschieden werden. Architekt war Tiberi Sabater i Carné (1852-1929).
Details der Fassade mit Fackeln und Masken.
Gegenüber an der Ecke das Gebäude Edificio Generali, die ehemalige Banco Vitalicio de España. Es war einer der ersten Wolkenkratzer in Barcelona und galt bis Mitte der 1970er Jahre als das höchste Gebäude der Stadt. Die ersten Pläne stammen aus dem Jahr 1935, doch der Bürgerkrieg stoppte den Bau. Der Graf von Gamazo investierte im Januar 1950 in den Bau als neuer Hauptsitz der Banco Vitalicio. Das Gebäude hat 21 Stockwerke und über der abgeschrägten Ecke, der Fase, einen Turm.
Detail eines Rundbogens über der Tür aus Metall mit den Initialen der Bank „BVE“.
Die Wallace-Brunnen sind öffentliche Trinkwasserspender in Form von gusseiserner Frauen bzw. Karyatiden, die eine Kuppel über ihren Kopf halten. Sie sind benannt nach dem Engländer Richard Wallace, der ihre Errichtung zuerst in Paris finanzierte.
LEGO-Store: riesiger Landen mit Sehenswürdigkeiten Barcelonas, wie den Häusern am Eingang des Park Güell und der Sagrada Família.
Cases Rocamora: drei Häuser am Passeig de Gracia, sind einheitlich im neugotischen Stil mit modernistischen Details, nach einem Entwurf des Architekten Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó von 1914-1917 gebaut worden. Auftraggebern war Antoni Rocamora, Sohn eines Millionärs, der in Kuba reich geworden war. Zurück in Spanien, führte er die Geschäfte seines Vaters weiter und wurde zum größten Seifenhersteller Spaniens. Das Dach wird von einer mittelalterlich anmutendenden konischen Kuppel mit orangefarbigen Keramiken dominiert, die je nach Lichteinfall ihre Tönung ändern. An der abgeschrägten Hausecke, der Fase, erhebt sich ein Turm mit hoher zylindrischer Spitze.
- Der Passeig de Gracia mündet im Nordosten auf der Plaça de Catalunya:
Der 5 Hektar große Platz liegt im Zentrum von Barcelona, am nordwestelichen Ende von La Rambla und am nördlichen Ende des Altstadtviertels Barri Gòtic. Unter dem Platz liegen von mehreren Seiten zugänglich ein Verkehrsknotenpunkt der Metro und Eisenbahnlinien, die innerhalb der Stadtverkehren, sowie eine Tourismus-Information.
Charakteristisch für diesen großzügig gestalteten Platz ist sein als sternförmiges Muster aus blauen, roten und grauen Fliesen gestalteter Boden und die Verkehrslärm abschirmende Bepflanzung mit Springbrunnen. Rundherum haben Banken ihren Sitz, an der Ostseite das mächtige Gebäude der Telefónica. An der Nordseite des Platzes steht das riesige, erst 1962 eröffnete Kaufhaus El Corte Inglés.
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich die Stadt mit ihren damaligen Mauern auf die heutige Altstadt und platzte aus allen Nähten. Die Erweiterung bestand darin, dass die Stadtmauern abgetragen und die angrenzenden Orte einzugemeinden, wie z.B. Gracia im Norden, unterhalb des heutigen Parc Güell.
Über die Bebauung der großen neu hinzugekommenen Fläche zwischen Barcelona und diesen Orten, entbrannte im Rahmen eines Architektur-Wettbewerbs ein Streit zwischen Antoni Rovira i Trias (1816-1889) und Ildefons Cerdà (1815-1876). Die Pläne von Cerdà sahen ein rechtwinkliges Straßennetz vor, wie es auch auf Wunsch des Königshauses realisiert wurde. Die Pläne von Rovia sahen ein sternförmiges Straßennetz vor, die auf der heutigen Plaça de Catalunya zusammengelaufen wären. Die Bevölkerung hatte eigentlich diesen Plan bevorzugt.
Es wird aber ersichtlich, dass diese Stelle schon vor der Errichtung des Platzes als Zentrum des neuen, erweiterten Barcelona angesehen werden kann. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde begonnen, die Grundstücke, auf denen sich heute der Platz befindet, zu enteignen. Der Platz entstand in den Jahren 1902-1929 nach Plänen des Architekten Francesc Nebot bzw. Francesc de Paula Nebot i Torrens (1883-1865) und wurde 1927 von König Alfons XIII. eingeweiht.
Relief zur Orientierung auch für Blinde. Unten der Hafen, darüber das Barri Gòthic, links der Berg Montjuïc, oben der Tibidao und in der Mitte der Verkehrsknotenpunkt Plaça de Catalunya.
Blick auf den Platz mit dem Gebäude von Telefónica und dem Leben auf dem Platz.
„Dia de Sant Jordi“ naht, ein Verkaufsstand mit Rosen.
Endlose Reihen von parkenden Motorrollern – Park and Ride. Große Brunnen alle ohne Wasser..
Das modernistische Occident-Gebäude an der Einmündung der Passeig de Gràcia.
Riesige Straßenlaternen, im Hintergrund das Kaufhaus El Corte Inglés.
Details der modernistischen Straßenlaterne. Eine Säule aus Stein mit bekrönendem Oktogon aus Glas und ionischem Kapitell aus Metall. Weiter unten Engel und Barken, als Halterungen für Laternen.
An der nordöstlichen Ecke des Platzes eine Treppenanlage, die im Bogen um den Sechs Putten Brunnen bzw. Font dels sis Putti von Jaume Otero i Camps (1888-1945) führt. Die Skulpturengruppen auf dem Platz wurden zwischen 1927 und 1929 für die Weltausstellung 1929 in Barcelona geschaffen .
Details der Anlage mit Putten aus Metall, die Blütenranken halten.
Statue der Personifikation von Tarragona von Jaume Otero i Camps (1888-1945). Die Gruppe besteht aus einem sitzenden Mann, einem Teenager-Mädchen mit einem Obstkorb und drei Frauen.
Statue der Personifikation von Montserrat von Eusebi Arnau i Mascort (1863-1933). Das Werk stellt einen halbnackten alten Mann dar, wahrscheinlich den Einsiedlermönch Joan Garí, der in seiner rechten Hand ein Bild der Jungfrau von Montserrat hält.
Statue des Herkules von Antoni Parera i Saurina (1868-1946).
Die nackte Frau mit einem Boot in der Hand, auf einem Pferd, ist die Allegorie auf die Stadt Barcelona, vom Bildhauer Frederic Marès i Deulovol (1893-1991).
Ein gelb blühender Strauch, die Geflügelte Kassie (Senna didymobotrya).
Detail der Blüten.
Violett blühender Strauchiger Salbei (Salvia leucantha).
Blick über das bunte Pflaster mit Menschen, die die zahlreichen Tauben füttern. Im Hintergrund ein neoklassizistisches Gebäude. Ehemals Sitz der Banco Español de Crédito, heute ein Nobelhotel der Kette Iberostar.
Plaça de Catalunya, an der Ecke zur Straße La Rambla steht das mit Kuppeln bekrönte Gebäude von Primark.
Vor dem Kaufhaus Afrikaner, die Taschen und Gürtel verkaufen.
Kaufhaus El Corte Inglés:
Fan-Shop des FC Barcelona im Kaufhaus
Spielwaren-Abteilung.
Lampe mit Gingko-Blättern
Schuh-Abteilung.
Blick vom Selbstbedienungsrestaurant im obersten Stock, auf den Platz und die Stadt Richtung Montjuïc im Westen der Stadt. Das Gebäude mit der Uhr auf dem Turm ist das Gebäude von Telefónica. Rechts ein neoklassizistische Gebäude mit großem Turm. Hier befindet sich jetzt ein Nobelhotel der Kette Iberostar. Früher war es der Sitz der Banco Español de Crédito.
Auf dem Platz große runde Brunnen, die aufgrund der Wasserknappheit momentan kein Wasser führen. In der Mitte der Boden aus Fliesen in der Form eines Sterns.
Blick auf die Mündung der Straße Passeig de Gràcia, die nach Norden führt. Im Hintergrund der Berg Tibidao. Vorne die Dächer einiger prächtiger Bauten des Modernisme. Diese Straße ist eine der elegantesten und eindrucksvollsten Straßen im Norden der Plaça de Catalunya.
In nordöstlicher Richtung kann man im Hintergrund die Sagrada Familia sehen.
Blick in das Selbstbedienungsrestaurant. - Barri Gòthic oder Gotisches Viertel:
Der Stadtteil erstreckt sich vom Hafen im Süden bis zur Kathedrale und von dem Rambles im Westen bis zur Via Laietana. Es ist der älteste Teil der Stadt und die Architektur ist überwiegend von der Gotik geprägt. Zu dieser Zeit war Barcelona neben Genua und Venedig die wichtigste Handelsstadt im Mittelmeerraum. Die Wurzeln reichen allerdings zurück bis in die Römerzeit, von der sich neben Teilen der Stadtmauer auch zahlreiche Überreste erhalten haben – diese allerdings meist im Untergrund.
Südöstlich der Plaça de Catalunya, in der Nähe der Placa Nova vor der Kathedrale, verläuft die Avenida del Portal de l’Àngel mit der Font de Santa Anna. Dieser älteste Brunnen der Stadt, wurde im Jahre 1356 als Pferdetränke erbaut. Er ist an den Palau del Comtes de Pignatelli (Palast der Grafen von Pignatelli) angebaut, der heute der Reial Cercle Art de Barcelona ist. Es könnte sein, daß er ursprünglich achteckig war. Bei der Renovierung 1918 wurden farbige Keramikfliesen mit Wasser tragenden Frauen, floralen Motiven und zwei Engeln angebracht.
Laden mit flauschigen Stofftieren, hier Küken von Pinguinen, Modeschmuck und Traumfängern.
Gasse Richtung Kathedrale mit Laden für Spezialitäten, wie spanischem Nougat.
Laden mit Devotionalien, wie Mariendarstellungen und Kruzifixen.
Ab P1420822
Gebäude des Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) an der Plaça Nova.
An der Plaça Nova liegt auch der Palau Episcopal oder Palau del Bisbe, der Bischofspalast von Barcelona. Der Gebäudekomplex ist um einen großen zentralen Innenhof herum angeordnet ist. Auf der Nordseite grenzt er an die Reste einer römischen Mauer mit zwei quadratischen und einem halbkreisförmigen Turm. Der halbkreisförmige Turm gehörte zur Porta Decumana. Die Fassade zur Plaça Nova wurde erst 1784 fertiggestellt. Im Mittelteil wird sie von einem dreieckigen Giebel dominiert. Sie wird durch den Rhythmus und die Symmetrie ihrer Fenster- und Balkonöffnungen und einfache Zierleisten unterteilt.
Relief an der Fassade mit dem Wappen des damaligen Bischofs.
An einer Stelle hat sich noch ein Gemälde von Fransciso Plá, genannt El Vigatá (1743-?) erhalten.
Blick auf den halbrunden Turm der ehemaligen Porta Decumana. Recht die Carrer de Bisba.
Geht man durch die Carrer de Bisbe, kommt man zur Fassade der Capella de Santa Llúcia. Die spätromanische Kapelle, erbaut zwischen 1257-1268, stößt mit ihrer Rückseite an den Kreuzgang der Kathedrale. Erbaut auf Initiative von Bischof Arnau de Gurb. Es hat einen Eingang vom Kreuzgang und von der Carrer de Santa Llúcia. Ursprünglich war sie die Kapelle des Bischofspalastes und war von der Kathedrale getrennt, die kleinere Ausmaße hatte. Der quadratische Bau, hat ein Portal mit vier Archivolten, Säulen und Kapitellen. Die kapitelle zeigen florale Motive, die Verkündigung und die Heimsuchung. Das Gemälde über dem Eingang stammt von Joan Llimona (1860-1926), Anfang des 20. Jahrhunderts.
Plaça de Garriga i Bachs. Hier befindet sich das Denkmal für die Helden von 1809. Es stellt fünf Märtyrer dar, die nach einem Aufstandsversuch gegen die französischen Truppen, während der Besetzung Barcelonas im Rahmen des Spanischen Erbfolgekreiges, im Jahr 1808 hingerichtet wurden. 1929 erhielt der Bildhauer Josep Llimona (1864-1934) den Auftrag für die 5 realistischen Plastiken aus Bronze. Die Tafel auf dem Sockel trägt die Namen der Aufständischen. 1941 wurde dem Denkmal ein Alabasterrelief mit Engeln von hinzugefügt. Es zeigt eine Reihe von Engeln und wurde von Vicenç Navarro geschaffen.
Über Keramikbänken an der Seite des Denkmals, sind Fliesen angebracht, die auf einen Stich von Bonaventura Planella i Conxello (1772-1844) basieren. Sie zeigen den Einzug der napoleonischen Truppen in die Stadt.
Blick auf die neugotische Brücke über die Carrer de Bisbe. Sie verbindet die Casa dels Canonges mit dem großen Gebäudekomplex des Palau de la Generalitat de Catalunya, der mit seiner Hauptfassade zur Plaça de Sant Jaume liegt. Die Brücke wurde 1928 von Joan Rubió i Bellver (1871-1952), einem Schülern von Gaudí, im Rahmen der Umgestaltung des Viertels errichtet.
Zurück zur Carrer de Santa Llúcia bei der Capella de Santa Llúcia. Hier steht die Casa de l’Ardiaca, die ehemalige Residenz des Erzdiakons. Errichtet um das 12. Jahrhundert, unter Verwendung von Teilen der römischen Stadtmauer. Ende des 15. Jahrhunderts ließ der Erzdiakon Lluís Desplà i d’Oms (1444-1524) es im gotischen Stil mit einigen Renaissance-Elementen wieder aufbauen. Im 19. Jahrhundert wurden von den verschiedenen Besitzern Änderungen vorgenommen und seit 1924 befindet sich hier das Stadtarchiv.
Im Hof des Hauses steht eine Palme, die bereits im späten 19. Jahrhundert gepflanzt wurde. Daneben gibt es einen Brunnen an dem an Fronleichnam (60 Tage nach Ostersonntag) das traditionelle Fest „l’ou com balla“ (das Ei wie es tanzt) gefeiert wird. Der Brunnen wird mit Blumen und Früchten verziert und unter den Wasserstrahl ein Ei gelegt; das Ei fällt nicht um, sondern dreht sich und tanzt mit dem Wasser.
Bunte Fliesen mit floralen Motiven von Josep Roig umgeben den Innenhof.
In Vitrinen einige Wappenbücher aus dem Bestand des Archivs. Die heraldischen Handschriften zeigen zahlreiche Wappen, hier der Familien Prades, Lull und Pontons. Dieses Archiv ist eines der wichtigsten Archive des Landes.
Historische Fotografie der Bibliothek. Diese Bibliothek ist heute eine der größten Spezialbibliotheken zum Thema Barcelona.
Heraldische Motive aus den Beständen des Archivs, vor Resten der alten Stadtmauer. Das alte Barcino war seit seiner Gründung eine ummauerte Stadt. Wir kennen die ursprüngliche Höhe der ältesten Mauer, die noch aus der Zeit von Kaiser Augustus stammt nicht, aber sie muss mindestens 9 Meter hoch gewesen sein und hatte eine variable Tiefe von 1,5 bis 2 Metern. Sie bestand aus römischem Beton und war innen mit Quaderblöcken verkleidet. Im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts wurden 76 Türme hinzugefügt und die dem Meer zugewandte Fassade deutlich verstärkt. Die neuere Mauer wurde dann bis zu 4 m dick und verwendete teilweise die Materialien früherer Gebäude.
Auch Reste des alten Montacada-Aquädukts findet man im Untergeschoss der Casa de l’Ardiaca. Das Aquädukt war 11,3 km lang und hatte ein Gefälle von 1,6 Metern je Kilometer.
Blick vom Innenhof in die 1. Etage und die Treppe.
Kapitelle mit Darstellung von Tieren und Fantasiegestalten.
Von der Terrase in der oberen Etage Blick auf die Seitenwand mit Wasserspeiern und den Turm der benachbarten Kathedrale.
Details der Wasserspeier.
Detail eines Reliefs über einer Tür mit einem Wappen, welches von Engeln gehalten wird.
Detail eines Fensters mit gotischem Maßwerk. Oben halten geflügelte Löwen mit Frauenköpfen ein Wappen.
Folgt man der Carrer de Santa Llúcia weiter, kommt man zu dem großen Platz vor der Kathedrale, der Placita de la Seu. Gegenüber der Einmündung der Straße liege die Casa de la Pía Almoina. Hier befindet sich heute das Diözesanmuseum.
Eine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 935, als sie als Unterkunft der Domherren des Augustinerordens erbaut wurde. Das originale Gebäude wurde 1400 abgerissen und einige Jahre später für eine wohltätige Stiftung neu erbaut. Man kann zwei Bauteile erkennen. Ein gotischer Teil von 1435 und die 1546 erbaute Erweiterung aus der Renaissance.
Detail eines Wasserspeiers an der Casa de la Pía Almoina.
Die schmale Gasse an der Nordseite der Kathedrale, die Carrer dels Comptes, führt zur Plaça de Sant Iu. Im Hintergrund ein Eckturm des Archivs der Krone von Aragón.
Blick in den Innenhof des Museu Frederic Marès. Es enthält eine Sammlung von spanischen Plastiken vom 12. bis 19. Jahrhundert. Untergebracht ist es im ehemaligen Palast der Inquisition, gleich neben der Kathedrale.
Eingangstür zum Museu Frederic Marès, flankiert von Säulen und einem Giebel mit Wappenschild darüber.
Details von Kapitellen an einem Eingang.
Plaça de Sant Iu mit einem Bogengang und der Ecke mit kleinem Turm vom Archiv der Krone von Aragón.
Läuft man um den Chor der Kathedrale herum, stößt man auf das gotische, ehemalige Domherrenhaus.
Detail eines Fensters mit Medaillons und Verzierungen aus der Renaissance. - La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia: Nach einer frühchristlichen Basilika aus der Zeit der Westgoten, folgte eine romanische Vorgängerkirche. Vom 13. – 15. Jahrhundert entstand die gotische Kathedrale. Die Westfassade und der Mittelturm stammen von 1886-1913. Nachdem sie 599 unter dem Patrozinium des Heiligen Kreuzes stand, dem ältesten der christlichen Welt, kam 877 das Patrozinium der Heiligen Eulalia, der Stadtpatronin Barcelonas hinzu. Die Kathedrale ist außen 93 m lang und 40 m breit.
Blick auf die neugotische Westfassade und die umgebenden Bauten von der Plaça de la Seu. Die Fassade ist 40 m breit und wird von zwei 52 m hohen Glockentürmen mit Fialen bekrönt. Sie ist mit zahlreichen gotischen Stilelementen und einer großen Anzahl von Plastiken von Engeln und Heiligen dekoriert. Der 80 m hohe Mittelturm wurde vom Architekten August Font i Carreres entworfen und entstand 1906-1913.
Nordportal bzw. Portal des heiligen Ivo, bei der Plaça de Sant Iu. Dieses Portal war 500 Jahre lang der Haupteingang zur Kathedrale und ist das älteste Portal der Kathedrale. Hier blieben Inschriften als Relief erhalten, die an den Baubeginn 1298 erinnern. Über den Säulen gibt es musizierende Engel. Im Tympanon befindet sich unter einem Baldachin die Plastik der heiligen Eulalia aus dem späten 14. Jahrhundert. Sie wird der Schule Jaume Cascalls (gest. 1378) zugeschrieben. Auf beiden Seiten des Portals befinden sich noch Reliefs aus dem 12. Jahrhundert. Sie zeigen den Kampf des Menschen gegen wilde Tiere. Links ein Greif mit einem Lamm, daneben ein vollkommen mit Haaren bedeckter wilder Mann und ein als Soldat gekleideter Mann im Kampf mit einem Greif, als Symbol für den Kampf gegen den Teufel.
Rechts neben Samson, ein Hirschkalb unter Bäumen und dann eine Löwin mit drei Jungen.
Umrundung des Chores mit Blick auf den Glockenturm und Wasserspeier, zum Beispiel ein Einhorn und ein Elefant.
Zugewachsener Wasserspeier eines Reiters mit Pferd.
Das Chorhaupt, wo 1298 der gotische Bau begonnen wurde.
Chor am Übergang zum Kreuzgang mit einem zweiten Turm.
Fenster an der Südseite des Kreuzgangs.
Inneres:
Blick in das Kircheninnere Richtung Osten zur Chorschranke und dem dahinter liegenden Chor. Die Kathedrale besteht aus drei 28 m hohen Schiffen, 79 m lang und 25 m breit, wobei das Mittelschiff doppelt so breit ist wie die Seitenschiffe. Auf jeder Seite kommen noch einmal 6 m tiefe Seitenkapellen dazu.
Blick in die Kuppel des Mittelturm. Vom Boden bis zum Schlussstein 41 m.
Das Portal im Westen von innen.
Der Chor mit Chorschranke liegt in der Mitte der Kirche. Nach Vollendung des Chores, begann um 1519 Bartolomé Ordóñez (gest. 1520) mit der künstlerischen Gestaltung der Chorschranke. Es ist eine dorische Kolonnade mit je zwei Reliefs zwischen den Säulen, rechts und links vom Durchgang.
Blick in das Kreuzrippengewölbe des Hauptschiffs. Eine 1970 durchgeführte Restaurierung ermöglicht, die Vielfarbigkeit der Schlusssteine wieder zu entdecken, die im Laufe der Jahrhunderte verdunkelt worden war. Die Kathedrale hat insgesamt 215 Schlusssteine, von denen die größten diejenigen im Hauptschiff sind. Sie haben einen Durchmesser von 2 Metern und wiegen jeder etwa 5 Tonnen. Von oben nach untern: Schutzmantelmadonna (1379), Verkündigung (1379), Bischof mit Diakonen, der ewige Vater umgeben von Engeln (1418 vom Bildhauer Pere Joan).
Detail des Schlusssteins mit der Darstellung des ewigen Vaters von Pere Joan.
Blick auf den Chor im Zentrum des Mittelschiffs.
Das Ende des 14. Jahrhunderts von Pere Sanglada bzw. Anglada (Wirkungsdaten 1394-1406) geschnitzte Chorgestühl, gehört zu den wertvollsten Kunstwerken in der Kathedrale. Er reiste extra nach Flandern um dort das Eichenholz für das Chorgestühl zu kaufen. 1394-1399 entstand dieser Binnenchor. Das Chorgestühl zeigt Szenen des täglichen Lebens mit moralisierender und satirischer Absicht. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts schuf der deutsche Bildhauer Michael Lochner die Baldachine und Giebel aus Holz im gotischen Stil, die sich über dem Gestühl befinden. 1519 fand im Chorraum eine von Kaiser Karl V. einberufene Versammlung der Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies statt, um über die Ausdehnung des Osmanischen Reiches zu beraten. Aus diesem Anlass bemalte der elsässische Maler Joan de Burgunya (Wirkungsdaten 1510-1525) die Rückenlehnen mit den Wappen der Adligen des Ordens vom Goldenen Vlies.
Detail des für Kaiser Maximilian I. vorgesehenen Sitzes mit dem Habsburger doppelköpfigen Adler im Wappen.
Blick zurück zur Innenseite der Chorschranke und zur Kuppel im Westen.
Blick Richtung Chorhaupt mit dem Hauptaltar.
Am Ende des Binnenchores steht links die Kanzel, 1394-1396 ebenfalls von Pere Anglada.
Blick auf die Orgel im nördlichen Seitenschiff, über dem Portal Sant Iu. In einem Orgelprospekt von 1538, befindet sich eine Orgel von 1994 von der Orgelbaufirma Orgues Blancafort in Montserrat.
Blick in das Chorhaupt mit dem Hochaltar.
Kronleuchter aus Messing in gotischen Formen.
Hochalter mit dem dahinter liegenden Chorumgang. Der 1337 von Bischof Ferrer d’Abella geweihte Tisch des Hochaltars ruht auf zwei gewaltigen Kapitellen wahrscheinlich westgotischen Ursprungs aus dem 6. Jahrhundert, die aus der ersten Basilika stammen, die 995 schwer beschädigt wurde. An der Stelle des ehemaligen gotischen Altaraufsatzes, der jetzt in der Pfarrkirche San Jaime wieder aufgebaut wurde, steht jetzt seit 1970 ein aus Alabaster gefertigter Bischofsthron aus dem 2. Viertel des 14. Jahrhunderts. Man entsprach damit den Vorschriften des Zweiten Vatikanischen Konzils. Über dem Thron ein Bronzeguss des Gekreuzigten Christus, umgeben von sechs Engeln, von Frederic Marès i Deulovol (1893-1991) von 1976.
Gewölbe im Chorhaupt. Der Schlussstein zeigt den gekreuzigte Christus zwischen der Jungfrau Maria und dem Evangelisten Johannes mit den Symbolen von Sonne und Mond.
Blick vom Hochaltar Richtung Chor mit dem Chorgestühl.
Blick auf den Chor mit dem Zugang zur darunter liegenden Krypta der heiligen Eulalia, einer der Schutzheiligen der Kathedrale.
Über zwei zugemauerten Zugängen, die zu Seitenkapellen führten, befinden sich flache Bögen mit gemeißelten Köpfen. Wahrscheinlich stellen diese die Personen dar, die bei der Überführung der Gebeine der heiligen Eulalia anwesend waren.
Die Krypta entstand während der ersten Bauphase der gotischen Kirche und war 1339 fertig. Die Krypta wurde von dem mallorquinischen Baumeister Jaume Fabre bzw. Jaime Fabré (1296-1339) vollständig im gotischen Stil gestaltet. Von ihm stammt auch die architektonische Gestaltung des Chorhauptes.
Informationstafel zum Grabmal der heiligen Eulalia.
Der halbrunde Raum mit flacher Decke, wird von 12 Säulen gestützt, von denen Rippen ausgehen, die am Ende einen riesiegen Schlusstein tragen. Dort ist die heilige Eulalia, die von Maria und dem Jesuskind gekrönt wird dargestellt. Hinter dem schlichten Altar der gotische Sarkophag aus Alabaster. Er ist ein Werk von Lupo di Francesco aus Pisa, der von 1327-1339 in Barcelona tätig war. Er steht auf 8 unterschiedlichen Säulen aus Alabaster. Auf dem Sarkophag Plastiken von vier Engeln und die Jungfrau Maria mit Kind.
Sowohl auf dem Deckel, als auch an den Seiten des Sakophags wurden Szenen aus dem Martyrium der heiligen Eulalia und Teile der Zeremonie der Überführung dargestellt.
Gleich neben dem Eingang befindet sich links auf der nörlichen Seite die Taufkapelle mit dem Taufbecken, welches 1433 von Onofre Julià aus Florenz aus Carraramarmor geschaffen wurde. Dahinter unter einem gotischen Baldachin ein Flachrelief mit der Darstellung der Taufe Jesu. In dierser Kapelle wurden die ersten 6 Indianer getauft, die 1493 Kolumbus aus Amerika mitgebracht hatte.
Kapellen im nördlichen Seitenschiff:
Kapelle des heiligen Markus: Informationstafel.
Barocker Altaraufsatz. 1683-1692 von Bernat Vilar geschnitzt und von Francesc Vinyals vergoldet.
Kapelle des heiligen Bernhardin von Siena:
Informationstafel.
Die Kapelle wurde bereits 1349 fertiggestellt und bis 1431 von der Zunft der Schuhmacher benutzt. Als diese in die Markuskapelle zog, blieb sie einige Zeit ungenutzt und wurde dann 1459 von der Zunft der Flechter und Glasmacher übernommen und dem heiligen Bernhardin von Siena gewidmet. An dem vergoldeten, barocken Altar von 1783-1785 sind Plastiken des heiligen Bernhardin, des Erzengel Michael und des heiligen Antonius von Padua zu sehen. Der Künstler ist unbekannt. An der Spitze eine Plastik des heiligen Hieronymus von Stridon, da der Altar eine Stifung des Hieronymus de Magarola i Grau, Graf von Quadrelis war. In der Predella ein Relief mit der Verzückung der heiligen Teresa.
Kapelle der Jungfrau Maria vom Rosenkranz: Der vergoldete Altar aus der späten Renaissance, wurde 1619 vom Bildhauer Agustín Pujol (1585-1643) geschaffen. Er besteht aus zwei Reihen von je drei skulpturalen Reliefs übereinander, die durch Giebel strukturiert sind. In der Mitte steht ganz oben der heilige Laurentius, darunter folgt die Krönung Mariens, dann Mariä Himmelfahrt und unten die Statue Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz. Die linke Seite wird gekrönt vom Erzengel Michael, darunter die Geißelung Christi und darunter die Verkündigung an Maria. Und auf der rechten Seite steht ganz oben der heilige Hieronymus, darunter die Auferstehung Jesu und darunter die Geburt Christi. Der Altar ist eines der herausragendsten Werke der Kathedrale aus dieser Epoche.
Kapelle der heiligen Maria Magdalena, Bartholomäus und Elisabeth:
Informationstafel.
1401 wurden die Altarbilder vom Maler Guerau Gener (1369-1410) geschaffen. Sie sind in drei senkrechte Abschnitte gegliedert. In der Mitte ist oben die Durchbohrung der Seite des toten Christus am Kreuz dargestellt, darunter die Titularheiligen der Kapelle der heilige Bartholomäus und die heilige Elisabeth von Thüringen. Links oben ist der Exorzismus der Tochter des armenischen Königs Polymios dargestellt. Darunter das Martyrium des heiligen Bartholomäus und unten die Predigt des lebendig gehäuteten Apostels. Rechts das nächtliche Gebet der heiligen Elisabeth, darunter ein Besuch bei einem Kranken zur Nachtzeit und schließlich posthume Wunder, die sich an ihrem Grab ereigneten. In der Predella sind, von links nach rechts, die Verkündigung, die Geburt Jesu, die Jungfrau mit dem Jesuskind, umgeben links von Petrus und Paulus und rechts von den heiligen Philomena und Katharina, die Anbetung der heiligen drei Könige und die Darstellung Jesu im Tempel dargestellt.
Kapelle des heiligsten Herzen Mariä, des heiligen Sebastian und der heiligen Thekla:
Informationstafel
Der Altar von 1486-1496 geschaffene Altar, wurd vom Domherren Joan Andreu Sors bei Jaume Huguet (1414-1492) in Auftrag gegeben. Obwohl er ihn nicht selbst anfertigte, führte seine Werkstatt den Auftrag aus, insbesondere Rafael Vergós, Francesc Mestre und Pere Alemany. Auch dieser Altar ist in Bereiche gegliedert, wobei in der Mitte oben der Knabe Jesus unter den Schriftgelehrten im Tempel zu sehen ist und darunter die Titularheiligen Sebastian und Thekla. Auf der linken Seite sind, von oben nach unten, die heilige Thekla in der Löwengrube, die Heilige auf dem Scheiterhaufen und der heilige Nicasius zu sehen. Rechts verleugnet der heilige Sebastian vor Kaiser Diokletian die Symbole des römischen Kults, darunter das Martyrium des heiligen Sebastian und ganz unten der heilige Rochus.
In der Predella von links nach Rechts der Erzengel Michael, Maria Magdalena, Jesus als Ecce Homo, Johannes den Evangelisten und die heilige Barbara. Unten neben dem Altartisch links Johannes der Täufer und rechts der heilige Andreas.
Der Übergang zwischen den Seitenschiffen und dem Chorhaupt ist sehr schlicht gehalten und gehört wahrscheinlich zum ältesten Bereich der gotischen Kathedrale. An der nördlichen Seitenwand die Orgel und dann Gräber der Grafen von Barcelona kurz vor dem Zugang zum Chorumgang. Die Sarkophage stammen von Frederic Marès i Deulovol (1893-1991), aus dem Jahr 1990. Links Alfons III. von Aragón und rechts seine Frau Konstanze von Sizilien. An der älteren Mauer darüber kann man verschwommen noch einzelnen Zeichen von Steinmetzen sehen.
Kapellen im nördlichen Chorumgang:
Kapelle der Mercedarier:
Informationstafel
Die Kapelle ist auch dem heiligen Pedro Nolasco, dem Ordensgründer, gewidmet. Sie besitzt einen barocken Altar des Bildhauers Joan Roig des Älteren (1630-1697) aus dem Jahr 1688. Das große Zentralrelief zeigt die Gründung des Ordens der Mercedarier im Jahr 1218. Der kniende Pedro Nolasco empfängt das Gewand des neuen Ritterordens aus der Hand Raimund von Penyaforts in Anwesenheit von König Jakob I. von Aragón und und Bischof Berenguer II. de Palou. Darüber wohnt Unsere Liebe Frau von der Barmherzigkeit symbolisch der Zeremonie bei. Links ein Relief mit dem heiligen Petrus als ersten Papst und rechts den heiligen Papst Silvester.
Kapelle der heiligen Klara und der heiligen Katharina von Alexandria:
Informationstafel
Der Altar dieser Kapelle wurde von Miquel Nadal (gest. 1457) begonnen (von ihm stammt die Predella) und dann durch Pere García de Benabarre (gest. 1496) 1456 vollendet. Auf dem Hauptaltar sind über den Bildern der beiden Titularheiligen die Kreuzigung Christi und seitlich Szenen aus dem Leben der beiden Heiligen zu sehen. Auf der Predella ist unter anderem die Beweinung Christi dargestellt. Die Kapelle war früher dem heiligen Stephan gewidmet, welches an den Gemälden an den Seitenwänden deutlch wird.
Kapelle des heiligen Simon Petrus, Martin von Tours und Ambrosius von Mailand:
Informationstafel
Der Altar ist den beiden heiligen Bischöfen Martin von Tours und Ambrosius von Mailand gewidmet. Er wurde 1415 von Joan Mates (1370-1431) aus Girona in einem fränkisch-flämischen Stil angefertigt. Er präsentiert acht Gemälde auf Holztafeln in Temperamalerei: im Uhrzeigersinn oben die Kreuzigung auf dem Kalvarienberg; die Mantelteilung des heiligen Martin vor den Toren von Amiens; die Bischofsweihe des heiligen Martin; den wundersamen Traum des heiligen Martin; die Weihe des heiligen Ambrosius zum Bischof von Mailand 374; die Predigt des heiligen Ambrosius; die Geburt des heiligen Ambrosius und das Wunder des Bienenschwarms und zentral die beiden Titularheiligen. Da an den Seitenwänden der Kapelle Gemälde vom heiligen Petrus hängen, ist sie auch nach Petrus benannt.
Blick zurück in den nördlichen Chorumgang.
Blick in des Kreuzrippengewölbe des Chorumgangs.
Kapelle des Erzengel Gabriel und der heiligen Helena:
Informationstafel
Hier befindet sich das Retabel des Erzengels Gabriel, das um 1400 von Lluís Borrassà (1380-1424) geschaffen wurde. In der Mitte die Verkündigung mit Maria und dem Erzengel. Oben die Kreuzigung, im Seitenflügel rechts oben die Heiligen Drei Könige, liegend in einem Bett, die drei Altersstufen des Mannes darstellend. Die Kapelle befindet sich in der Mittel der Kapellen des Chorumgangs.
Kapellen im südlichen Chorumgang:
Kapelle von Johannes dem Täufer und dem heiligen Josef:
Informationstafel
Dies ist die Kapelle der Bruderschaft der Schreiner, deren Patron der heilige Josef ist. Zusätzlich ist sie Johannes dem Täufer gewidmet, dessen Plastik als Hauptfigur in dem anonymen Renaissancealtar von 1577 steht. Die Altarflügel stammen von Joan Mates (1370-1431) und stellen die vier Evangelisten dar. Der gesamte Altar hat vier Ebenen in fünf Kolumnen, die folgende Szenen darstellen (von links oben nach rechts unten):
links außen: die Ankündigung der Geburt des Johannes an Zacharias, die Gefangennahme Johannes des Täufers, das Gebet Jesu am Ölberg
links innen: die Geburt Johannes des Täufers, Jesus wird mitgeteilt, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, die Geißelung Christi
in der Mitte: die Taufe Jesu durch Johannes, die Plastik des Johannes, die Plastik des heiligen Josef mit dem Jesuskind
rechts innen: der Besuch Marias bei Elisabeth, das Gastmahl des Herodes Agrippa, die Dornenkrönung Christi
rechts außen: die Predigt des Johannes am Jordan, Salome wird das Haupt des getöteten Johannes gereicht, Jesus fällt unter dem Kreuz
Kapelle der Verklärung Christi:
Das Altarbild der Verklärung Christi, ein Werk in Temperamalerei von Bernardo Martorell ( ca. 1400-1452). Der Altar ist eines der bedeutendsten Kunstwerke in der Kathedrale und der katalanischen, gotischen Malerei. Es entstand im testamentarischen Auftrag des Bischofs Simó Salvador in der Zeit zwischen 1445-1452. Dargestellt ist von links oben nach rechts unten die bei der Verklärung schlafenden Jünger, die Vermehrung von Brot und Fischen, die Kreuzigung, den verklärten Jesus mit Moses und Elija, sowie Petrus, Jakobus und Johannes, die Ermahnung Jesu an die Apostel, von der Verklärung zu schweigen, und die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana.
In der Predella sieht man von links nach rechts das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, die Kreuzabnahme Jesu, die Austreibung eines Dämons und die Heilung der blutflüssigen Frau.
An der linken Wand eine Bogennische mit Grab, ein Arkosolium, mit dem Grabmal von Ponç de Gualba, der von 1303-1334 Bischof von Barcelona war. Die Liegefigur, bzw. der Gisant war einst vergoldet.
Kapelle der Heimsuchung Marias und des heiligen Georg:
Informationstafel (deutscher Titel auf Informationstafel falsch)
Im Auftrag des Chorherrn Nadal Garcés entstand zwischen 1466-1475 dieser Altar eines unbekannten Künstlers. Die Anordnung der drei Tafeln erfolgte willkürlich in späterer Zeit. Das Bild in der Mitte zeigt Maria und Elisabeth, davor kniet der Stifter in betender Haltung. Links der Evangelist Lukas, recht der heilige Sebastian.
An der linken Wand eine Bogennische mit Grab, ein Arkosolium, mit dem Grabmal von Bischof Berenguer II. de Palou. Davor eine Plastik des heiligen Georg mit dem Drachen zu seinen Füßen.
Kapelle des heiligen Antonius Abbas:
Informationstafel
Diese Kapelle war diejenige der Zunft der Fuhrleute und ihr Barockaltar stammt aus der Zeit von 1690-1712. Die Plastiken werden Joan Roig dem Älteren (1630-1697) und seinem Sohn zugeschrieben, die Vergoldung Joan Moixi. Die Schnitzarbeiten umfassen mehrere Plastiken: ganz oben der heilige Dominikus (auf dem Foto nicht zu sehen). Im mittleren Bereich links der heilige Antonius, in der Mitte der heilige Antonius Abbas und rechts der heilige Franziskus von Assisi. In der unteren Reihe Reliefs, links das Eselwunder des heiligen Antonius von Padua, in der Mitte die Versuchung des heiligen Antonius Abbas und rechts ein Wunder des heiligen Franziskus.
Rückseite des Binnenchores: Anfang des 16. Jahrhunderts arbeitete Bartolomé Ordóñez an der Rückseite des Binnenchores und schuf gotische Bögen ohne Durchgang mit menschlichen Oberkörpern.
An der südlichen Seitenwand, der Orgel gegenüber, am Übergang zwischen Chorumgang und Seitenschiff, befinden sich Sarkophage an der Wand. Es sind Grabmäler von Raimund Berengar I., Graf von Barcelons (1023-1075) und seiner Frau Almodis de la Marche. Sie sind die Begründer der romanischen Kathedrale.
Die Särge sind umgeben von illusionistischer Architekturmalerei des Portugiesen Enrique Fernandes aus dem Jahr 1545.
Rechts daneben der Zugang zum Kreuzgang mit einem Sterngewölbe darüber.
Kapelle im südlichen Seitenschiff:
Kapelle des heiligen Cosmas und Damian:
Informationstafel
Das Altarbild der heiligen Brüder und Ärzte Cosmas und Damian Berwurde von Bernardo Martorell ( ca. 1400-1452) begonnen und nach dessen Tod 1452 von seinem Schüler Miquel Nadal (gest. 1457) bis 1455 vollendet.
Kreuzgang:
Der aus vier Galerien mit Kreuzrippengewölbe bestehende Kreuzgang, wurde Ende des 15. Jahrhunderts vollendet, etwas mehr als ein Jahrhundert nach dem Beginn der Bauarbeiten an der neuen Kathedrale. Ungefähr hier befand sich auch der romanische Kreuzgang. Am Bau des gotischen Kreuzganges warem im 14. und 15. Jahrhundert mehrere berühmte Architekten beteiligt, wie Andreu Escuder und Bildhauer wie Vater und Sohn Claperós beteiligt. Der Bau vollzog sich in zwei Abschnitten, zunächst wurden die Flügel entlang der Basilika und am Portal de la Pietat im Osten errichtet. Erst nach dem großzügigen Testament von Bischof Francesc Climent Sapera konnten etwa 100 Jahre später die beiden anderen Flügel erbaut und 1448 der Kreuzgang vollendet werden. In der damals engen und durch eine Stadtmauer begrenzten Stadt, war der Kreuzgang damals eine der wenigen Grünzonen der Stadt und wurde der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht. Viele Menschen benutzten ihn als alternativen Weg durch die engen, vollen Gassen der Umgebung. Daher gibt es zwei direkte Zugänge von der Stadt. Die Tür Santa Eulàlia zur Carrer del Bisbe im Süden und die Tür Pietat zur gleichnamigen Straße im Osten. Drei der Galerien im Kreuzgang haben Kapellen, die den Schutzheiligen der Zünfte und großen Familien gewidmet sind.
Detail der Tür zum Kreuzgang mit Schnitzereien im Holz und Türklopfer.
Blick in den östlichen und nördlichen Flügel des Kreuzganges. In der Ecke des Gartens kann man den Brunnen des heiligen Georg sehen. Der nördliche Flügel führt an der Seitenwand der Kathedrale entlang.
Östlicher Flügel
Nördlicher Flügel
Brunnen des heiligen Gerog oder Brunnen Sant Jordi, der unter einem Pavillon steht. Es handelt sich um ein Werk von Andreu Escuder, der auch die Bauarbeiten an der Kathedrale von 1442-1463 leitete. Die kleine Plastik des heiligen Georg zu Pferd in der Mitte des Springbrunnens stammt vom zeitgenössischen Bildhauer Emili Colom (1924-2007) von 1970.
Blick in die Gewölbe einiger Seitenkapellen im Kreuzgang.
Neben dem Brunnen des heiligen Georg befindet sich auch ein kleiner Teich, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert.
An der Ecke des Beckens die Plastik eines Frosches und unter ihm an der Ecke Plastiken von Drachen oder Schlangen.
Hier leben 13 Gänse, lebendige Symbole der Stadt. Der Legende nach waren bei den Bauarbeiten im 14. Jahrhundert eine Schar Gänse anwesend, die durch ihr Geschnatter einen Einbruch gerade noch verhindert haben. Man dankte es ihnen und richtete dieses effektive Alarmsystem ein, das nunmehr seit mehr als 600 Jahren jeden Einbrecher abgeschreckt hat. Außerdem symbolisiert die Zahl 13 das Alter der heiligen Eulalia, als sie 303 von den Römern ermordet wurde.
Blick vom südlichen Flügel des Kreuzganges auf den Brunnen und einen Turm der Kathedrale.
Garten im Kreuzgang. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen hier Orangenbäume, Zitronenbäume und Zypressen. 1877 wurde der Garten vollständig umgestaltet und es wurden exotische Pflanzen wie Magnolien und Palmen gepflanzt.
Wasserspeier – Affe mit einer Frau und ein geflügeltes Fabeltier.
Grabmal von Antoni Tallander (1358-1446), auch Mossèn Borra genannt. Er war der Hofnarr von König Martin I. König von Sizilien (1376-1409) und Alfons V. von Aragonien (1396-1458).
Kapelle Santa Llúcia oder der Elftausend Jungfrauen: diese Kapelle befindet sich an der südwestlichen Ecke des Kreuzganges und ist von außen zugänglich. Sie wurde zwischen 1257-1268 als Kapelle des Bischofspalastes im Auftrag von Bischof Arnau de Burb (gest. 1284) im spätromanischen Stil Hier befindet sich nun auch sein gotisches Grabmal, welches lange Zeit verdeckt war und erst 1891 wiederentdeckt wurde.
Grabmal des Kanonikers Francesc de Santa Coloma aus dem 14. Jahrhundert auf der linken Seite der Kapelle. Über dem Sarkophag, der mit zwei Wappenschilden des Toten verziert ist, befindet sich ein Kreuzigungsrelief vor einem Hintergrund aus blauer Glasschmelze. Der Stifter erscheint als kniende Figur unter dem Kreuz.
Kapitell im westlichen Flügel des Kreuzganges.
Blick von westlichen Flügel des Kreuzganges in den Garten.
Gestell aus Metall mit Drachen für Kerzen.
Grabmal eines Geistlichen unter einem gotischen Kielbogen in einer Nische. Oberhalb des Sarkophages Reste von Fresken mit der Darstellung von Engeln und den Marterwerkzeugen Jesu.
Verschiedene Kapitelle aus dem Kreuzgang.
Laden mit Devotionalien im Kreuzgang.
Museum:
Im nördlichen Flügel des Kreuzganges befindet sich das Museum, in dem liturgische Objekte und Kunstwerke aus mehr als 1000 Jahren gezeigt werden.
Kasten aus Holz mit Intarsien und Reliefs aus Elfenbein.
Monstranz vom Ende des 14. Jahrhunderts, Detail der Monstranz.
Kruzifix dem Apostel Andreas in der Mitte und Darstellungen der Evangelisten als Emaillemedaillons.
Der neue Kapitelsaal im Museum: Erbaut zwischen 1436-1444, war dieser Bereich als Mehrzweckraum konzipiert und beherbergte im gesamten 15. Jahrhundert einen Speisesaal für die Armen und das Wirtschaftsarchiv. Im 17. Jahrhundert beschloss das Domkapitel, dort den neuen Kapitelsaal unterzubringen, den es noch heute nutzt.
Deckengemälde im neuen Kapitelsaal
Grabplatte des Erzdiakons Lluís Desplà (gest. 1524), Marmorrelief 1539 geschaffen von Girolamo Cristoforo.
Gotischer Altar mit Tafelmalerei.
Weitere Bilder von gotischen Altären. Unten die Predella eines Altares. Sie wurde von Bernardo Martorell (1400-1452) zwischen 1430-1435 gemalt.
Gemälde mit dem das Kreuz tragenden Jesus.
Tafel mit allen Heiligen. Sie wird dem Bildhauer Michael Lochner zugeschrieben, der in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Barcelona gearbeitet hat. - Augustus-Tempel: Der Zugang zu den Resten des Augustus-Tempels, befindet sich in der Straße Carrer Paradís Nr. 10, ganz in der Nähe des Chores der Kathedrale von Barcelona. Durch einen bogenförmigen Zugang betritt man einen kleinen Hof, der sich auf dem höchsten Punkt der Altstadt (nur 16,9 m über dem Meeresspiegel) befindet. Hier errichteten die Römer vor etwa 2000 Jahren die Siedlung Bardino, aus der sich später die Stadt Barcelona entwickelte. Auf dem höchsten Punkt des Hügels wurde der Augustus-Tempel errichtet, vom dem noch 4 Säulen erhalten sind. Das Forum der Siedlung Barcino befand sich direkt neben dem Tempel; an der Stelle, an der sich heute der Palau de la Generalitat befindet. Das Forum war das politische, religiöse und administrative Zentrum der Stadt. Es befand sich im Zentrum der Stadt, dort wo sich zwei Hauptstaßen kreuzten – die Decumanus maximus und die Cardo maximus.
Plan der römischen Stadt.
Rekonstruktionszeichnung des Forums mit Tempel und des Tempels.
Der Tempel, ein Ringhallentempel oder Peripteros, war ca. 35 m lang und 17,5 m breit. Er stand auf einem ca. 3 m hohem Podest. Ursprünglich besaß der Tempel 6 x 11 Säulen mit korinthischen Kapitellen. Mit der Christianisierung und dem Ende des Römischen Reiches verlor der Tempel an Bedeutung. Das Datum seiner Zerstörung oder seines Verfalls lässt sich nicht rekonstruieren. Im 11. Jahrhundert wurde es wahrscheinlich wegen seiner immer noch imposanten Präsenz als „das Wunder“ bezeichnet. Die Errichtung neuer Gebäude im Spätmittelalter begünstigte die Erhaltung der Überreste des Tempels, wenn auch in fragmentarischer Form innerhalb der Neubauten. Ab dem 15. Jahrhundert erregten die in den Häusern zu sehenden Säulen und Kapitelle große Aufmerksamkeit, was zu vielfältigen Interpretationen über deren Herkunft führte. Zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde oft die Frage aufgeworfen, ob die Säulen freistehend in der Mitte des öffentlichen Raums stehen oder in dem ursprünglichen mittelalterlichen Gebäude, in dem sie untergebracht waren, erhalten bleiben sollten. In der Zwischenzeit kaufte der Wanderverein Katalonien das Gebäude und bat den Architekten Lluís Domènech i Montaner (181849-1923) um Hilfe. Er schuf von 1904-1905 den Innenhof, von dem aus man heute den Tempel sehen kann.
Blick auf die 9 m hohen Säulen auf dem 3 m hohen Podest.
Detail des korinthischen Kapitells. - Durch die Carrer del Veguer oder der Baixanda de Santa Clara, gleich neben dem Archiv der Krone von Aragon – Palau del Lloctinent – erreicht man die Plaça del Rei, im Osten der Kathedrale. Es ist der historische Sitz der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragonien.
Die rechteckige Form des Platzes, die noch heute erhalten ist, erhielt der Platz im Zuge der Stadtentwicklung während der Herrschaftszeit von König Martin I. (1356-1410) genannt „der Humane“. Im Zuge dieser Umgestaltung wurde der Markt, der dort traditionellerweise stattgefunden hatte, an einen anderen Ort verlegt und die Durchführung von Turnieren ermöglicht. Der Platz ist an allen Seiten von gotischen Gebäuden und Bauten der Renaissance umgeben.
Lageplan des Platzes, die Nordseite ist hier links. Hier steht der Palau Reial Major, der Königliiche Haupt-Palast. Er hat eine gotische Fassade und den Mirador del Rei Marti, den Turm Martins I. Rechts führt eine Treppe zum Saló del Tinell und der Santa-Àgata-Kapelle, die den Platz auf der nordöstlichen Seite abschließt. Auf der südöstlichen Seite befindet sich die Casa Padellàs, der Verwaltungssitz des historischen Museum der Stadt. Der Königliche Hauptpalast und die Santa-Àgata-Kapelle gehören zum Historischen Museum.
Blick von der Carrer del Veguer auf den Platz. Links die Ecke des Gebäudes vom Archiv der Krone von Aragón (Palau del Lloctinent).
Oben an der Ecke Reliefs mit Engeln die ein Wappenschild halten.
Die schmale Gasse Baixanda de Santa Clara mit Blick auf den Platz. Links wieder das Archiv der Krone von Aragón. Im Hintergrund der Turm der Kapelle von Santa-Àgata.
Die Kapelle Santa Ágata wurde 1302 als königliche Kapelle erbaut. Der Bau erfolgte auf Anordnung von König Jakob II. (1267-1327) und der regierenden Königin Blanca d’Anjou (1280-1310).
Blick auf den Übergang zwischen der Kapelle mit ihrem Turm und der anschließenden Casa Padellàs.
Blick auf den achteckigen Turm und die Eingangstür zur Kapelle. Die Tür aus Holz hat schmiedeeiserne Beschläge. Darüber ein Spitzbogen mit kleinen Kapitellen mit jeweils einem Gesicht.
Blick auf den Platz Richtung Norden.
Links die dem Platz zugewandten Fassade des 1549-1557 von der katalanischen Gereralität, unter Kaiser Karl V. (1500-1558), erbauten Archivs der Krone von Aragón – Palau del Lloctinent. Der Architekt Antoni Carbonell (ca. 1497-1557) erbaute es im Stil des Übergangs zwischen Spätgotik und Renaissance, als Residenz des Vizekönigs (Lloctinent) von Katalonien. Aus dieser Zeit stammt auch der sogenannte Mirador von König Martin, der dominante fünfstöckiger Turm auf rechteckigem Grundriss (1555) am Übergang zum Saló del Tinell. Später wurde es vom Kloster Santa Clara übernommen. Seit 1853 befindet sich hier das Archiv der Krone von Aragon mit Urkunden der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragón aus dem 9.-18. Jahrhundert sowie weitere Urkunden verschiedener ziviler und kirchlicher Gremien.
Ein zweiter Eingang befindet sich auf der Rückseite, von der Carrer dels Comptes aus. Schild am Eingang.
Informationstafel mit Grundriss.
Begrünter Innenhof nur Laubengang in der ersten Etage, dem Durchgang zwischen der Carrer dels Comptes und der Plaça del Rei.
Wasserspeier unterhalb des Daches vom Palau del Lloctinent.
Fenster des Palau del Lloctinent an der Carrer dels Comptes mit frivolen Kapitellen.
Blick von der Plaça del Rei auf den fünfstöckigen Mirador, ganz oben mit einem Widder, der wie ein Wasserspeier wirkt.
Die Fassade des Saló del Tinell mit der Treppe in der Ecke, dem Eingang zum Museum.
Gegenüber dem Saló del Tinell die Casa Padellàs, der Verwaltungssitz des historischen Museum der Stadt. Dieser gotische Palast stand ursprünglich an der Carrer Mercaders und wurde 1931 abgerissen und an diese Stelle wieder aufgebaut, da er sonst Bauarbeiten zum Opfer gefallen wäre. Die Fassade ist sehr schlicht. Links neben dem Eingang das Relief eines Wappenschildes, eine Straßenlaterne und in einer Nische hinter Glas die Figur eines Madonna.
Die Fenster unten zeigen einige Renaissance-Dekorationsmotive. Löwen halten e in Wappenschild und Köpfe oder geflügelte Wesen als Kapitelle.
Kapelle Santa Ágata, Inneres:
Blick durch das Kirchenschiff Richtung Altar.
Seitenkapelle
Der Chorraum mit gotischen farbigen Fenstern mit Wappen.
Dreikönigs-Altar von Jaume Huguet (1414-1492), entstanden im Auftrag des Königs 1464-1465. Nach dem katalanischen Bürgerkrieg 1462-1472 wollte der König seine Position stärken mit diesem prestigeträchtigen Motiv – der Darstellung der heiligen drei Könige vor der heiligen Familie.
Weitere Details des Altars. Oben die Verkündigung, die Kreuzigung und die Geburt Jesu. Unten mehrere Heilige.
Blick zurück durch das Kirchenschiff zum Eingang.
Luftbild vom Barri Gòthic oder Gotischem Viertel mit der rot markierten ehamaligen Stadtmauer der römischen Siedlung Barcino.
Teil eines Modells der römischen Siedlung Barcino mit dem Forum und dem Augustus-Tempel oben.
Plan der römischen Siedlung Barcino.
Historisches Foto der Plaça del Rei während der archäologischen Ausgrabungen.
Römischer Brunnenschacht
Weitere römische Ausgrabungen unterhalb des Museums.
Fragment einer Wandmalerei mit der Darstellung eines Reiters aus dem 4. Jahrhundert.
Fragmente von farbigen Bodenfliesen. Es war der Boden einer Fullonica, die Reinigungs- und Pflegedienste für Kleidung anbot. Es verfügte über einen Empfangsraum, der mit Marmor- und Schieferverkleidungen im Stil luxuriöser Häuser dekoriert war.
Cella Vinaria: Gebäude zur Weinherstellung aus der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts bis 4. Jahrhundert. Hier wurde Wein verarbeitet und reifte in den Gefäßen. Außerdem wurde in den in den Boden eingelassenen Gefäßen Honig und Meersalz aufbewahrt, welches dem Wein als Zutat zugesetzt wurde.
Grundriss des bischöflichen Palastes aus der Zeit vom 5.-7. Jahrhundert. Ab dem 5. Jahrhundert machten sich die Auswirkungen einer gewissen städtischen Destrukturierung bemerkbar. Das Forum verlor seine Nutzung, die römischen öffentlichen Gebäude wurden abgerissen oder für andere Zwecke genutzt. Die Straßen wurden verengt und umgeleitet, die Abwasserkanäle wurden nicht mehr genutzt. Das Christentum spielte eine Schlüsselrolle bei der Transformation des Stadtbildes, die die Bildung eines neuen Machtzentrums mit sich brachte. Im Norden des ummauerten Stadtgebietes entstand der bischöflichen Komplex und die Märyrerbasiliken und außerhalb verschiedene Klöster.
Rest eines Mosaiks vom Boden eines römischen Hauses, auf welches Teile des bischöflichen Palastes im 6. Jahrhundert gebaut wurde.
Auf einer unteren Ebene des bischöflichen Palastes, befinden sich die Überreste eines Peristyls oder umzäunten Gartens eines großen Domus oder Amtshauses.
Blick von oben in das ehemalige Peristyl.
Blick von oben auf große Vorratsbehälter.
Mehrere Vitrinen mit römischen Resten:
Terra Sigillata, eine hochwertige römische Keramik mit roter, glänzender Oberfläche. Die unverzierten oder mit Reliefbildern geschmückten Gefäße wurden in Großbetrieben als Massenware hergestellt. Ihre Formen und Größen sind genormt.
Kronen von Grabdenkmälern ehrenhafter städtischer Würdenträger aus dem 1. Jahrhundert
Korinthische Vase mit Darstellung einer Kampfszene, 3. Jahrhundert.
Links eine römische Porträtbüste, als Agrippina die Jüngere interpretiert, 1. Jahrhundert. Rechts eine römische Porträtbüste für ein Grabmal, 2. Jahrhundert.
Dekorative Figuren von einem Bestattungsbett, das bei einer Einäscherung verwendet wurde, 1.-2. Jahrhundert.
Plastiken der Köpfe verschiedener römischer Gottheiten, 1.-2. Jahrhundert.
Gegenstände aus dem Haushalt (Löffel, Öllampen) und Kinderspielzeug, 1.- 5. Jahrhundert.
Dekorative Applikationen, Scharniere und Nägel für Möbel, 1.-5. Jahrhundert.
Kellergewölbe, Übergang zu den mittelalterlichen Ausstellungen.
Krug, Apothekentöpfe und Keramikdeckel, importiert aus dem islamischen Osten und dem Maghreb, 12.-14. Jahrhundert.
Tragbarer Altar oder Reliquiar aus Holz und Knochen, 13. Jahrhundert.
Truhe mit Wappen und Blumenmotiven verziert, die Reste von Bemalung aufweisen, 14. Jahrhundert.
Wandgemälde mit Ritterthemen im linearen gotischen Stil, entdeckt in einem Turm eines mittelalterlichen Herrenhauses in der Carrer Basea, 13. Jahrhundert. Die ursprüngliche Komposition gliederte sich in zwei Streifen, die durch einen breiten Zwischenstreifen aus Lilienblüten und geometrischen Motiven getrennt waren. Der untere Streifen diente als Rahmen für eine Prozession von Rittern und einige befestigte Bauwerke. Der obere Streifen, bestehend aus Figuren, die verschiedene tadelnswerte menschliche Stereotypen verspotten, wie zum Beispiel den korrupten Mönch.
Saló del Tinell, früher Sala del Borboll: großer Saal im Königspalast und ein Beispiel für katalanische Gotik. Erbaut vom Baumeister Guillem Carbonell von 1359-1370 im Auftrag des Königs von Aragonien Peter IV. (1319-1387). Der Grundriss ist rechteckig. Sechs große halbkreisförmige Zwerchfellbögen tragen eine Balkendecke. Quer zu den Bögen befinden sich neben den Seitenwänden schmale Tonnengewölbe. Die Außenfassade zur Plaça del Rei stammt aus einer früheren Zeit.
Auf einer Seite der Innenwand befindet sich ein recht gut erhaltenes Wandgemlälde, welches die Eroberung Mallorcas darstellt
Modell der Stadt und das Barri Gòtic, wie es 1500 aussah. Die mittelalterliche Metamorphose 13.-15. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert war Barcelona nicht mehr nur die Bischofsstadt und Kreishauptstadt früherer Jahrhunderte. Die anhaltende wirtschaftliche Dynamik hatte jahrzehntelang zur Ausdehnung der Stadt und Bevölkerungswachstum geführt, und die Stadt war nun die Heimat einer immer komplexer werdenden Gesellschaft. Barcelona hatte auch eine politische Zentralität erlangt, weil die feudale Familie, die über die Stadt herrschte, zu einem Königshaus geworden war, das seine Herrschaftsgebiete gewaltsam vergrößerte, sogar in Richtung Meer. Darüber hinaus war die herrschende Elite dabei, mehr Einfluss und Autonomie bei der Verwaltung der Interessen der Stadt zu erlangen, indem sie mit dem König über die Schaffung des ersten Stadtregimes verhandelte.
Konsole mit den Plastiken von Köpfen eines adligen Mannes und einer adligen Frau aus der Carrer dels Templers aus dem 15. Jahrhundert.
Medaillon aus Stein mit der gekrönten Maria mit dem Jesuskind.
Kleine gotische Dose mit aufgemalten Heiligen.
Zurück auf der Plaça del Rei, wo eine Silbermöve des Rest einer Pizza verspeist.Mittelalterliches Haus mit dem Laden „Galeria de Sant Jordi“, in der Carrer del Veguer, die zur Plaça del Rei führt.
Die Tür aus Holz mit gotischen Formen und Beschlägen aus Eisen. Relief des heiligen Georg aus Metall.
Ein Frosch und ein Löwe mit Kopfhörern gemalt hinter einem Fenster.
Blick in den Laden mit Devotionalien, Fächern, Andenken, Tellern und Schmuck.
Südwestlich der Kathedrale, Straßen und Gassen:
Carrer del Pi 16, mit einem modernistischen Eingang aus Holz. Über der Tür ein Bogen geschnitzt mit floralen Motiven.
Carrer de Petritxol: diese schmale Gasse führt parallel zur La Rambla zur Plaçca del Pi. Hier befinden sich zahlreiche Läden und kleine Galerien. Kleine bemalte Fliesen an den Hauswänden, erinnern an die zum Teil berühmten Anwohner dieser Straße.
Türklopfer
Carrer de Petritxol 18. Eine kleine Galerie deren Fassade mit Büchern und Engeln dekoriert ist.
Bemalte Fliesen an der Wand.
Carrer de Petritxol 13, ein Laden mit Hüten. Die Fassade des Landes ist expressiv mit Holz in geschwungenen Formen verkleidet.
Detail eine Türgriffs bzw. einer Türklinke in modernistischer Form.
Mehrere bemalte Fliesen an den Hauswänden.
Haustür aus Holz in modernistischer Form.
Blick in einen Laden mit historischen Gebrauchsgegenständen und Spielzeug.
Schaufenster von einem der zahlreichen Süßwarenläden mit Schokolade.
Schaufenster eines Juweliers mit einem Drachen – Barcelona ist die Stadt der Drachen.
Skulpturen aus Holz, den Kampt zwischen Mensch und Hund darstellend.
Hauseingang mit Löwenkopf und Statue einer Madonna.
Laden mit historischen Plakaten von Barcelona und anderen Andenken.
Bemalte Haustür von Nr. 3, zwei Männer auf einem Tandem.
Weitere bemalte Fliesen an den Hauswänden.
Flachrelief eines Pilger mit der Aufforderung Tiere und Pflanzen zu respektieren.
Laden mit Fächern und Borten.
Weitere bemalte Fliesen an den Hauswänden.
Historisches Gebäude in der Carrer del Cardenal Casañas, direkt vor der Kirche. - Santa Maria del Pi: sie liegt südwestlich der Kathedrale an der Plaça del Pi. Die gotische Kirche wurde zwischen 1319 und 1391 erbaut. Der Stil der Kirche war katalanische Gotik, mit einem einzigen Kirchenschiff fast ohne Verzierung. Peter IV, genannt der Zeremonielle (1319-1387) finanzierte den Bau des Glockenturms. Unter der Leitung von Bartomeu Mas wurden die Arbeiten von 1460-1497 durchgeführt. 1428 verursachte ein Erdbeben schwere Schäden vor allem an der Fassade. Weitere Schäden erlitt die Kirche 1714 während des Spanischen Erbfolgekrieges und durch die Explosion eines Munitionslagers. Das Presbyterium stürzte ein, das Bild des Hauptaltars und sämtliche Verzierungen wurden zerstört. 1717 begannen Reparaturen und von 1863 bis 1884 wurde die Kirche restauriert, 1915 eine erneute Restaurierung. 1936 wurde die Kirche durch ein Feuer zerstört, das Anarchisten gezielt gelegt hatten, um das Gebäude zu zerstören. Nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde die Kirche wieder aufgebaut.
Blick auf das Chorhaupt von außen.
Blick auf die Nordseite mit einem Portal. Hier haben sich Kapitelle aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten.
Wasserspeier
Vor dem nördlichen Portal haben mehrere Künstler ihre Stände mit Gemälden aufgestellt.
Westfassade: Die Vorderfassade verfügt über ein großes Rosettenfenster, das eine originalgetreue Reproduktion aus dem Jahr 1940 des Originalfensters ist, welches beim Brand von 1936 zerstört wurde. Darunter befindet sich der gotische Bogen des Haupteingangs.
Detail von wohl erhaltenen historischen Köpfen unterhalb der Spitzbogen an der Westfassade.
Inneres:
Grundriss
Blick in das Kirchenschiff mit Seitenkapellen zwischen den Stützpfeilern. Länge 54 m, Breite 16,5 m, Höhe 28,5 m
Blick in das Gewölbe.
Chor mit Apsis und Hauptaltar.
Die modernen bunten Glasfenster im Chor.
Hauptaltar aus Alabaster von 1967, ist ein Werk von Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988).
Informationstafel.
Die Statue der Santa Maria del Pi. Nach einer Überlieferung aus dem 16. Jahrhundert wurde die Statue „Unserer Lieben Frau von Pi“ von einem Fischer in einem Kiefernstamm in der Nähe der römischen Mauern von Barcelona gefunden, an der gleichen Stelle, an der sich die heutige Kirche befindet. Diese Tradition wurde besonders bis 1714 im Gedächtnis behalten, als das Renaissance-Altarbild, das die Statue umgab, während der Bombardierung der Belagerung von Barcelona am Ende des Spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714) zerstört wurde. Die Statue, die man jetzt sieht, ist eine im gotischen Stil sehr verbreitete Darstellung aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Möglicherweise ist sie ein Werk eines Nachfolgers vom Bildhauers Pere Moragues. Früher stand die Statue viele Jahre im Tympanon des Hauptportals, bis sie restauriert wurde und auf den Hauptaltar zurückkehrte.
Chorgestühl im Stil des Rokoko von Josep Mas i Dordal (-1808) von 1771. Wiederhergestellt 1986. Das zwischenzeitlich existierende neugotische Chorgestühl von 1868, wurde bei einem Brand 1936 zerstört.
Blick durch das Langhaus Richtung Eingang mit Rosettenfenster und den südlichen Seitenkapellen.
Seitenkapellen mit Altären im Süden.
Seitenaltar im Südwesten der Kirche.
Seitenkapellen mit Altären im Süden.
Buntglasfenster in der Südwand der Kirche. Die ursprünglichen Buntglasfenster sind nicht erhalten. Die ältesten noch existierenden stammen aus dem Jahr 1718. Das Fenster mit der Anbetung der Heiligen drei Könige links, ist ein Werk von Antoni Viladomat (1678-1755).
Details der bunten Glasfenster.
Blick in das Museum der Kirche.
Gewölbe des Museums mit Schlussstein.
Informationstafel mit einem Stadtplan von Barcelona in der Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert. Santa Maria del Pil liegt westlich der von den Römern ummauerten Altstadt in der Höhe der Porta de la Boqueria.
Informationstafel zu romanischen Konsolen an den Kirchenfenstern, die 2014 entdeckt wurden.
Kopie einer der romansichen Konsolen aus dem 11.-13. Jahrhundert.
Informationstafel
Informationstafel zur Geschichte der Stadt im 14. und 15. Jahrhundert.
Mittelalterlicher Sarkophag auf zwei Löwen in einer Nische der Wand.
Details der Reliefs auf dem Sarkophag. Wappen und gotischer Schrift.
Historische Schutzschilder.
Gotische Monstranz von 1587, vergoldetes Silber.
Detail der Monstranz mit dem heiligen Petrus und Paulus und zwei Engeln.
Monstranz aus Silber mit Edelstein.
Gotische Monstranz aus vergoldetem Silber.
Informationstafel zur Architektur der Kirche.
Miniaturdarstellungen der Gemeindearbeit von Santa Maria del Pi im frühen 18. Jahrhundert.
Informationstafel zu den militärischen Figuren.
Kleine Figuren mit Darstellungen der militärischen Obersten von verschiedenen Bataillonen von Barcelona und ihren Flaggen aus der zeit des Spanischen Erbfolgekrieges 1713/14.
Altarbild der zwei heiligen Johannes (Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist) aus dem späten 16. Jahrhundert. Aufgefunden in sehr schlechtem Erhaltungszustand auf dem Dachboden der Kirche. Inzwischen wurde im Archiv der Kirche ein Dokument aus dem 18. Jahrhundert entdeckt, welches die schematische Anordnung der Altarbilder der Kirche zeigen, darunter auch das der Kapelle des Heiligen Johannes.
Anonymes Kolumbarium auf dem Weg zu den Toiletten.
Plaça del Pi: Kleiner Platz, wieder mit einer Pinie bepflanzt, nach der die Kirche mit ihrer Gründungslegende benannt ist. Hier findet ein Markt statt. Im Hintergrund ein Haus mit einer mit Sgraffito verzierten Fassade.
Details vom Markt und seinen Waren: Laibe aus Käse, dekoriert mit Figuren von Ziege und Wolf.
Tüten mit Nüssen.
Schokolade und andere Süßigkeiten.
Schaufenster eines Ladens mit buddhistischen und tibetischen Gegenständen.
Laden mit spanischen Spezialitäten, wie zum Beispiel Schinken.
Schaufenster eines Ladens, der Fotografien der eigenen Iris vom Auge macht. Iris-Fotografie Eyepixx.
Bemalte Fliesen als Wandbild.
Wandmalereien in einer Gasse mit Fantasietieren.
Modernistische Fassade eines Hauses.
Bunte Haustür aus Holz mit Türklopfer.
Blick in den Innenhof der gotischen Casa Padellàs. Eine Treppe führt um den Innenhof herum. In der ersten Etage ist der Hof von gotischen Arkaden umgeben. Ursprünglich stand sie im östlichen Teil der Altstadt. Aufgrund des Baus der die Altstadt teilenden Via Laietana im frühen 20. Jahrhundert, wurde der Palast 1931 abgerissen und im westlichen Teil der Altstadt, dem Barri Gòthic an der Plaça del Rei wieder aufgebaut. Seit 1943 beherbergt es das Historische Museum der Stadt Barcelona.
Im Innenhof steht das große, ehemalige Uhrwerk der Kathedrale.
Skulpturen von Köpfen, Engeln und Fabelwesen neben einer Eingangstür.
Carrer de Ferran: Die Carrer de Ferran ist eine der geschichtsträchtigsten Straßen der Stadt. Sie wurde 1824 gebaut, um die Rambla mit der Zitadelle im Park Ciutadella zu verbinden. Allerdings wurde sie nur bis zur Plaça de Sant Jaume realisiert. Architekt war Josep Mas i Vilà (1779-1856), der mit dem geradlinigen Verlauf der Fußgängerzone, einen Kontrast zu den mittelalterlichen Gassen der Altstadt geschaffen hat. Sie führt in nordöstlicher Richtung durch das ehemalige jüdische Viertel. In der Höhe der Plaçca Reial die Jugenstil-Fassade vom Lennox the Pub.
Blick in die Straße.
Detail einer modernistischen Straßenlaterne.
Modernistische bzw. Jugendstil-Dekoration an der Ecke des Hauses Carrer de Ferran 21.
Iglesia Sant Jaume: Die heute katholische, ehemalige Klosterkirche, wurde auf den Überresten einer Synagoge errichtet. Das Kloster war die Gründung einer Bruderschaft jüdischer Konvertiten aus dem Jahr 1394. Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde dann hier ein Kloster des Trinitarierorden errichtet. Das Kloster wurde im 19. Jahrhundert aufgelöst und die Klostergebäude wurden abgerissen, um Raum für die Plaça de Sant Jaume zu schaffen, aber die Kirche ist geblieben und ist heute eine Pfarrkirche. Der einzige Überrest der Kirche aus dem 14. Jahrhundert ist die gotische Fassade mit dem Hauptportal. Es wurde 1398 von Ramon de la Porta und Bartomeu Gual in Auftrag gegeben. Das Relief im Tympanon stammt allerdings aus dem Jahr 1878 und ist ein Werk von José Santigosa. Es zeigt den Heiligen Jakobus auf einem Pferd. Zwischen den Fenstern ein Flachrelief mit Judenstern, Schwert, Hut und einem Buch mit lateinischer Inschrift, die übersetzt bedeutet: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Passatge del Crèdit: Diese halb überdachte Straße wurde zwischen 1875 und 1879 gebaut. Ihr Name bezieht sich auf die katalanische Kreditgesellschaft, die den Wohnungsbau entlang der Passage förderte. Sie verbindet die Carrer de Ferran mit der Baixada de Sant Miquel. Das Erdgeschoss ist für Gewerbeflächen vorgesehen und zeichnet sich durch die große Höhe und hohe Fenster aus. Die Brüstungen aus Metall vor den Fenstern in der 1. Etage, sind mit kleinen Figuren versehen, die sich teilweise erhalten haben.
An den Wänden zwischen den Türen moderne Kunst aus Metalldosen oder Wandmalereien. Übrigens im Haus Nr. 4 wurde Joan Miró geboren.
Blick in Läden mit Handtaschen, ein Laden mit Taschen und Rucksäcken aus Kork und Laden mit sich drehenden Dekorationen für die Decke.
Laden mit Fisch und Austern in der Carrer de Ferran. An der Decke ein umgedrehtes Ruderboot.
Kurz vor der Plaça de Saint Jaume, führt eine kleine Straße zur Plaça de Sant Miquel. Auf dem Platz eine riesige Kunstinstallation aus Stahlstäben von Antoni Llena (1942-). - Plaça de Saint Jaume bzw. Platz des heiligen Jakob: hier ist das historische und polititsche Zentrum Barcelonas. Er wurde 1823 in Betrieb genommen, nachdem man die Kirche Saint Jaume abgerissen hatte.
Fassade des Palau de la Generalitat. Hier sitzt die katalanische Regierung. Es ist ein prunkvoller Palast aus dem 15. Jahrhundert. Sein Eingang wird von 4 dorischen Säulen aus dem 2. Jahrhundert flankiert. Es ist kurz vor dem Tag des Nationalheiligen Jordi bzw. des Heiligen Georg – am 23. April – und so ist hier alles mit Rosen und einem Drachen dekoriert. Seit 1995 ist es auch Welttag des Buches und so sind auch Bücher Motive der Dekoration.
Vor der Kuppel die spanische und katalanische Flagge.
Über dem Eingang die Plastik des heiligen Georg.
Schmiedeeiserne Straßenlaterne.
Blick in die Carrer del Bisbe mit einer neugotischen Brücke – El Pont del Bisbe – zwischen dem Palau de la Generalitat und dem Wohnhaus der Kanoniker.
Schmiedeeiserne Straßenlaternen.
Schaufensterpuppen auf einem Balkon.
Gegenüber das Rathaus bzw. Ajuntament. Es steht bereits seit dem 14. Jahrhundert. Damals beschloss die Elite von Barcelona, der „Consell de Cent“, ein Empfangsgebäude am Ort des früheren Römischen Forums in der Stadt Barcina, wie Barcelona damals hieß, zu bauen. Während des spanischen Bürgerkrieges wurde das Rathaus schwer beschädigt, aber später wieder restauriert.
Links neben dem Rathaus an dem Gebäude eine große Plastik mit der Darstellung des heiligen Georg.
Blick in eine weitere Gasse.
Kleines Relief des heiligen Georg in einer Häuserwand.Fassade eines modernistischen Hauses in der Rambla de Catalunya 54. Sie verläuft parallel zum Passeig de Gràcia.
Details der Fassade mit dem Eingang zu einem Laden.
Eingangstür mit floralen Reliefs und Malereien mit Blumen.
Erker mit Glas und farbigen Butzenscheiben.
Fassade mit floralem Sgrafitto, Balkonen und Flachreliefs mit Blüten über den Balkontüren.
Wohnhäuser am nördlichen Ende des noblen Boulevards Passeig de Gràcia. Fassade im Stil des Modernisme oder Jugendstil, Passeig de Gràcia 74 mit Läden von Dior und Bulgari.
Details der Fassade und der Balkons.
Schaufenster des Ladens von Dior.
Detail der Fassade von Passeig de Gràcia 69 mit schmiedeeisernen Gittern am Erker und den Balkonen.
Straßenlaterne an der Passeig de Gràcia. Sie sind mit Sitzbänken kombiniert und wurden von Pere Falqués (1850-1916) entworfen.
Fassade des modernistischen Hauses Passeig de Gràcia 75, Ecke Carrer de Mallorca mit einem Laden von Rolex. Oben unter dem Dach Bilder aus Fliesen mit Lilien und anderen floralen Motiven. Ganz oben eine Dachterrasse, deren Mauer gotisierende Spitzbogen zeigt.
Details der Fassade
Passeig de Gràcia 86 mit Flachreliefs. Ein Motiv von 1835 mit den antiklerikalen Aufständen in Barcelona und ein Motiv von 1960.
Moderne Fassade des Hauses Passeig de Gràcia 83 mit einem Laden von Fendi. - Casa Milà oder La Pedrera: Passeig de Gràcia 92, an der Kreuzung mit der Carrer de Provença, kurz vor der Avinguda Diagonal. Es wurde als letzter Profanbau vom Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) von 1906-1912 für die Familie Milà errichtet. Zunächst hielt man in Barcelona nicht allzu viel von dem Haus mit der Fassade aus behauenem Naturstein, schnell wurde es unter dem Spottnamen „La Pedrera“ („Der Steinbruch“) bekannt. Diese Bezeichnung verdankt es seiner unregelmäßigen Fassade, mit abgerundeten Fensterleibungen, den vielen Vorsprüngen und seiner wuchtigen Masse, die schon von weitem ins Auge fällt.
Gaudí leistete mit diesem Gebäude Pionierarbeit. So machte seine durchdachte natürliche Belüftung Klimaanlagen überflüssig, in jeder Wohnung lassen sich die Wände individuell verändern, und auch eine Tiefgarage hat es schon gegeben. Die im Entwurf Gaudís bereits vorgesehene Aufzüge wurden allerdings erst sehr viel später eingebaut. Das Gebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion mit tragenden Säulen ohne tragende Wände und Stützmauern. Die schmiedeeisernen Die sich pflanzenhaft schlingenden Balkongitter sind improvisierte Unikate von Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949), der auch in anderen Projekten mit Gaudí zusammenarbeitete. Die geschwungene Dachlinie zeigt zahlreiche Kamine, die eher gestalterische, als funktionale Ankzente setzten. Oben an der Dachlinie ist das lateinische Ave-Maria-Gebet „Ave Gratia M Plena Dominus Tecum“ zu lesen, welches die Handschrift des Architekten Josep Maria Jujol trägt.
Es gibt 3 Innenhöfe, einer rund, zwei elliptisch, sind architektonische Elemente, die Gaudí immer wieder verwendete, um Räume mit ausreichend Licht und frischer Luft zu versorgen. Dies war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Die herrschaftlichen Zimmer gehen zur Straße oder zum Innenhof des Straßencarrées. Die Dienstbotenzimmer und Haushaltsräume zu den 2 Innenhöfen hin.
Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt mehr als 12.000 qm, jede Etage ist ohne die Innenhöfe allein 1.323 qm groß. Das Gebäude wurde 1984 von der UNESCO als erstes Gebäude des 20. Jahrhunderts zum Weltkulturerbe erklärt.
Details der Fassade und der Balkone mit den schmiedeeisernen Brüstungen. Für die Geländer an den Balkonen verwendete Gaudí Metallteile, die er auf Schrottplätzen sammelte, wie Platten, Stangen, Ketten und Rohre. Ungefähr 4.100 Schrauben und Nieten wurden verwendet, um aus den Einzelteielen die Geländer zusammenzubauen.
Inneres:
Im Erdgeschoss befindet sich ein Laden mit Andenken und Gegenständen im Design von Gaudí.
In der ersten Etage befindet sich heute ein Restaurant. Hier befanden sich früher Räumlichkeiten der Eigentümer.
Damentoilette im Restaurant.
Stühle aus Holz im Design von Gaudí.
Eingangsportal aus Gusseisen und Glas.
Blick in einen der Innenhöfe mit Treppen für die Familie Milà, die nur bis zur Beletage führt.
Blick in den 60 qm großen Eingangsbereich mit farbigen Wandbildern und Säulen. Hier befinden sich Treppen und Fahrstühle, die zu den Wohnungen in den darüber liegenden Stockwerken führen. Die repräsentative Treppe an der rechten Seite führt nur in die Beletage, in der die Eigentümer wohnten.
Links eine Pfötnerloge.
Auf dem Innenhof eine Plastik des Bildhauers Miquel Barceló (1957-) von 2001 in der Form eines Tierschädels.
Detail der Deckenleuchte
Details der Wandmalereien und der Kapitelle der Säulen, die mit der Decke scheinbar verschmelzen.
Türen in einer der oberen Etagen, links sieht man das Sternparkett im Wohnzimmer. Die Mietwohnungen waren zwischen 290 und 600 qm groß und passten mit ihrem luxuriösen Design zur privilegierten Wohnlage am Passeig de Gràcia. Dadurch dass kaum tragende Strukturen berücksichtigt werden mussten, gab es fast vollkommene Freitheit bei der Aufteilung der Räume.
Blick in einen der ockerfarbenen Innenhöfe.
Kinderzimmer mit Kleidung und Spielzeug.
Detail der Fliesen auf dem Boden.
Puppenhaus
Detail der Kapelle im Puppenhaus.
Spielzeug in einem Schrank, Modelleisenbahn, Metallauto.
Bügelzimmer mit Weißwäsche.
Blick in den oberen Bereich eines Innenhofes mit den Kaminen auf dem Dach.
Schlafzimmer eines Dienstboten mit kleinem Waschtisch mit Wasserkanne.
Badezimmer
Küche mit Herd, Essecke und Küchenschränken.
Ankleidezimmer oder Abstellkammer mit Sattel, Reitstiefeln, Dreirad, Schrankkoffer, Hutschachtel, Spiegel, Golftasche, Skiern, einem Gewehr.
Deckenleuchte mit weißer Glaskugel mit Blüten, Blättern und Schmetterling.
Arbeitszimmer mit Parkett, Bücherschrank mit Glastüren. Gerahmte Aktien und ein Gemälde an der Wand. Auf einem Schrank mit Schubladen das Modell eines Segelboots.
Deckenleuchte aus Metall und Glas.
Schlafzimmer mit Parkett, Schminktisch, Schrank und Zugang zu einem Balkon.
Badezimmer mit Warmwasser. Dies galt in der damaligen Zeit durchaus als Luxusausstattung.
Kleiner Tisch mit dreiteiligem Spiegel im Bad.
Blick in das Wohnzimmer und Esszimmer.
Blick über das schmiedeeiserne Geländer des Balkons auf die Straßenkreuzung.
Anrichte mit Intarsien aus Holz, Plastiken aus Metall als Dekoration und Oberschrank mit Glastüren.
Zweite kleinere Anrichte mit Intarsien aus Holz und einem Kaffeeservice aus Metall. Darüber an der Wand ein weißes Flachrelief auf goldemen Grund mit der heiligen Familie.
Kleiner runder Tisch aus Holz mit Malereien und Intarsien aus Perlmutt.
Wohnzimmer mit Sofa, Tisch mit Spitzendecke und mehreren Stühlen. Auf einem kleinen Schrank ein Grammophon. An der Wand Gemälde. In einer Ecke ein kleiner Tisch mit einer Büste, darüber ein Gemälde mit dem Bildnis eines Kindes.
Schlafzimmer mit Doppelbett. Am Kopfende des Bettes gemalte, florale Motive.
Deckenleuchte aus Metall und Glas.
Kleiderschrank mit floralen Motiven und Spiegel.
Neben dem Ehebett ein Kinderbett und ein Gemälde an der Wand.
In einem Zimmer an der Wand ein Heizkörper und ein kleiner Tisch als Sekretär. Auch die Ausstattung der Räume mit Heizkörpern galt in der damaligen Zeit als Luxus.
Neben dem Schlafzimmer ein Badezimmer.
Kleiderständer und Schirmständer.
Flur mit kleinem Sofa und Podesten und Blumentöpfen aus Keramik mit floralen Motiven.
Kronleuchter
Tür mit Turspion.
Blick über die Brüstung des Balkons auf die Fassaden der gegenüber liegenden Häuser.
Laden mit Andenken und Gegenständen im Design von Gaudí.
Miniaturausführungen der von Gaudí desigten Stühle.
Stuhl aus Holz von Gaudí.
Handtasche
Glaskunst mit zwei Quallen.
Kleine Nachbildungen der Kamine auf dem Dach.
Blick in das Dachgeschoss. Die Konstruktion des Dachgeschosses unterscheidet sich deutlich von der restlichen Wohnanlage. Zum Schutz vor extremen Temperaturen, entwickelte er ein System zur Wärmeregulierung, bei dem er sich die Dachkammern der katalanischen Bauernhäuser zum Vorbild genommen hat. Die Gestaltung orientiert sich aber nicht an der traditionellen Bauweisen, sondern er plante 270 steinerne Kettenlinienbögen in verschiedener Höhe und Spannweite. Auf ihnen ruht die Dachterrasse. Im 800 qm großen Dachgeschoss befanden sich einst Waschküchen und Abstellkammern zur gemeinschaftlichen Nutzung für alle Bewohner, heute ist hier der Museumsbereich. 160 Fenster mit Vordach aus Stein, sind um das Dachgeschoss herum angeordnet. Sie sorgen für eine gute Belüftung und Beleuchtung.
Modell der Casa Milà
270 Kettenlinienbögen in unterschiedlicher Höhe sind im Dachgeschoss angebracht.
Modell der Bögen im Dachgeschoss.
Grundriss der Krypta von Gaudí in der Colònia Güell.
Grundriss und Querschnitt von Gaudís Sagrada Família
Teilmodell der Sagrada Família
Grundriss und Längschnitt der 1904-1906 entstandenen Casa Battló von Gaudí.
Zwei Modelle der Casa Battló. Ein Modell ein Längschnitt durch das Haus und den Innenhof.
Grundriss und Querschnitt der Casa Vicens von Gaudí.
Bereich des Museums mit von Gaudí entworfenen Stühlen und Bänken, sowie Bodenfliesen.
Blick vom Dachgeschoss auf die Dachterrasse.
Dachterrasse: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielte eine Dachterrasse kaum eine Rolle. Gaudí hat hier allerdings eine Welt aus originellen Formen, Silhouetten und Materialien geschaffen. Sie harmonisiert mit der Wellenbewegung der Fassade und ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die durch die Höhenunterschiede durch Treppen verbunden sind.
Ein Lüftungsturm, wie eine abstrakte Skulptur.
Blick Richtung Westen über die Stadt.
Die verschiedenen Türmchen dienen verschiedenen Zwecken – Belüftung, Ableiten von Rauch oder der Zugang zur Terrasse. Hier sieht man die zahlreichen kleinen Fenster des Dachgeschosses darunter und der umlaufende Weg um das Dachgeschoss.
Im Hintergrund Richtung Nordosten die Baustelle der Sagrada Família.
Der Ausgang des Treppenhauses mit Mosaik aus Marmor und Keramik. Es gibt 6 Treppentürme, die das Dachgeschoss mit der Dachterrasse verbinden.
Blick in den großen Innenhof.
Ein weiterer Turm für das Treppenhaus mit dem Kreuz ganz oben, wie es Gaudí oft verwendet hat.
Im Vordergrund kleine Schornsteine, die mit einem Mosaik aus Scherben von grünen Glasflaschen dekoriert sind. Wie so oft, verwendet Gaudí weggeworfene Materialien.
Blick auf die Dachterrasse eine Penthouses.
Die Kirche Sagrada Família aus Schokolade von Adrián Ramirez, im Schaufenster eines Ladens mit Süßwaren.
Modernistische Straßenlaterne an der Carrer de Provença, direkt gegenüber der Sagrada Família - Sagrada Família:
Die erste Idee für den Bau einer Kirche zu Ehren der Heiligen Familie kam von Josep Maria Bocabella (1818-1892), einem Buchhändler und Verfasser christlicher Schriften aus Barcelona. Er gründene 1866 den Verein Associación Espiritual de Devotos de San José und beschloss 1874 eine durch Spenden finanzierte Sühnekirche zu initiieren. Der dafür gegründete Verein kaufte 1881 einen 12.800 qm großen Bauplatz im damals noch unbebauten Stadtteil Eixample. Der Architekt der Diözene Francisco de Paula del Villar y Lozano (1828-1901) stellte sich als Planer für den Bau zur Verfügung. Die ursprüngliche Idee von Bocabella, eine Kopie der Basilika von Loreto zu errichten, verwarf er und entwarf eine, dem üblichen Zeitgeschmack entsprechende neuromanisch-neugotische Kirche mit Vierungsturm und einem Turm an der Fassade zu bauen.
1882 war am Gedenktag des heiligen Josef die Grundsteinlegung, bei der auch Gaudí anwesend war. Er arbeitete damals im Büro von Joan Martorell, der als Statiker eingebunden war. Durch Streit zwischen der Bauleitung und del Villar, trat der Architekt zurück und das Projekt wurde Martorell angeboten, der ablehnte und seinen Mitarbeiter Gaudí vorschlug.
Gaudí baute die begonnene Krypta im Wesentlichen nach del Villars Plänen fertig, wobei die Gewölbe auf eine Überarbeitung Gaudís zurückzuführen sind. Mitte der 1880er-Jahre konnten erste Gottesdienste darin gefeiert werden und 1889 war die Krypta vollendet. Zeitgleich hatte er bereits begonnen, die Pläne für die Kirche grundlegend umzugestalten. Dazu legte er 1885 ein neues Gesamtkonzept mit gotischer Formensprache vor, in dem 18 Türme erkennbar sind, wenn auch im kleineren Maßstab als beim jetzigen Projekt. Die 1893 fertiggestellte Außenwand der Apsis weist von der Bauhöhe weit über das ursprüngliche Projekt hinaus.
Die sogenannte Geburtsfassade im Nordosten, wurde als erstes errichtet und kurz vor Beginn der Arbeiten sahen sich Bocabella und Gaudí durch eine große anonyme Spende in der Lage, die Pläne für die Kirche zu erweitern. Gaudí entwickelte daraufhin das Grundkonzept einer 18-türmigen und 5-schiffigen Basilika. Mit den Fundamentarbeiten für die viertürmige Fassade begann 1894 die Umsetzung des neuen Projekts. Die eigenwilligen Interpretationen des gotischen und barocken Historismus mit expressionistischen Zügen und in Anlehnung an den katalanischen Modernisme, führten recht bald zu der Ahnung, daß mit einer baldigen Fertigstellung nicht zu rechnen war. Gaudí arbeitete 43 Jahre an der Kirche, die letzten 15 Jahre ausschließlich. Bis zu seinem Tod 1926 konnte nur ein Turm dieser Fassade, der dem heiligen Barnabas gewidmet ist, vollendet werden. Er hatte die Türme zuerst eckig bauen lassen, änderte dann aber den Plan und ließ die eckige Form mit kleinen Balkonen enden. In der oberen Hälfte wurden die Türme dann in runder Form weitergebaut. Das eckige untere Stück versteckte Gaudí hinter vier 14 Meter hohen Apostelstatuen.
1926 starb Gaudí starb nach einem Straßenbahnunfall. Danach wurden die Bauarbeiten immer wieder unterbrochen, doch 1935 konnten die Arbeiten an der „Geburtsfassade“ abgeschlossen werden. Schwere Zerstörungen an der Geburtsfassade und der Krypta während des Spanischen Bürgerkriegs, sowie die Ermordung des geistlichen Leiters der Sagrada Família, der mit Gaudí befreundet gewesen war, führten zu einer langen Verzögerung der Bauarbeiten. Die antiklerikalen Gruppen hatten die Gipsmodelle der Kirche schwer beschädigt und die Zeichnungen von Gaudí wurden daraufhin von der katalanischen Regierung in Verwahrung genommen. Erst ab 1950 konnten die Bauarbeiten fortgesetzt werden. Die späteren Architekten Francesc Quintana (1892-1966), Isidre Puig i Boada (1891-1987) und Lluís Bonet i Garí (1893-1993) versuchten anhand der rekonstruierten Modelle und mündlich überlieferter Gedanken, Gaudís Ideen bestmöglich umzusetzen. 1976 wurden die vier Aposteltürme über der „Passionsfassade“ vollendet. 2010 wurde die Kirche, nach Fertigstellung des Innenraums durch Papst Benedikt XVI. (1927-2022) geweiht.
Vom Außenbau waren 8 der 18 Türme der Kirche fertiggestellt. Es handelt sich um je vier Aposteltürme über den zwei fertigen Fassaden. Vollenden wollte man die Basilika bis 2026, dem hundertsten Todesjahr Gaudís. Dann hätte der Bau insgesamt 144 Jahre gedauert. Der zweithöchste Turm der Kirche, der Marienturm, wurde 2021 fertiggestellt, als er seinen markanten 12-zackigen Stern auf der tze erhielt. In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils zwei der vier dritthöchsten Türme, die Evangelistentürme, fertiggestellt. Das frühere Ziel, die Kirche bis zum 100. Todestag Gaudís im Jahre 2026 fertigzustellen, wird seit 2020 nicht mehr als realistisch angesehen. Seit 2005 befinden sich Teile der Kirche auf der Liste der UNESCO für Weltkulturerbe. Die Kirche steht nordöstlich der Altstadt im Stadtteil Eixample.
Grundriss als Relief mit Blindenschrift. Die Sagrada Família hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Das Langhaus hat 5 Schiffe und weist nicht die sonst übliche Ost-West-Ausrichtung auf. Es ist circa 90 m lang und 45 m breit. Das Hauptschiff 15 m und die vier Seitenschiffe jeweils 7,5 m breit. Das mit 60 m recht kurze Querschiff besteht aus nur 3 Schiffe und ist 30 m breit. Links die Passionsfassade, recht die ältere Geburtsfassade, der heutige Eingang. Links oben, neben dem Chor die Sakristei.
Geburtsfassade: eine der beiden Schaufassaden, die sich jeweils an den Enden des Querschiffs befinden. Diese Fassade wurde größtenteils noch zu Lebzeiten Gaudís fertiggestellt. Sie liegt auf der rechten Seite des Langhauses, welches man links sehen kann. Die Fassade zeigt Details der Geburt Jesu und besteht aus drei Portalen, die die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe symbolisieren.
Das linke Portal ist das Portal der Hoffnung, welches aus Josef gewidmet ist..
Links unten die Flucht nach Ägypten. Das Podest zeigt Motive aus der Natur, wie zum Beispiel Pflanzen und Vögel.
Rechts die Ermordung der Unschuldigen oder der Kindermord in Bethlehem.
Podest mit Gänsen.
Über der Tür der heilige Josef mit Jesus und seinen Großeltern.
Die Tür selber hat oben ein Relief aus Metall welches Schilf und Libellen zeigt.
Am Übergang zum mittleren Portal oben Engel ohne Flügel mit Trompeten, die das jüngste Gericht ankündigen.
Die beiden Säulen stehen jeweils auf einer Schildkröte, ein Symbol für Beständigkeit.
Das mittlere Portal nennt sich Portal der Barmherzigkeit oder Portal der chritlichen Liebe. Die 3 Portale werden durch zwei salomonische Säulen, die in Palmblättern enden, getrennt.
Links ist die Anbetung der heiligen drei Könige dargestellt, darüber musizierende Engel, wieder ohne Flügel.
Rechts die Anbetung der Hirten.
Auch darüber wieder musizierende Engel ohne Flügel.
Auf dem Trumeau oder Mittelpfosten die Geburt Jesu.
Darüber, umgeben von musizierenden Engeln der Chor der Kinderengel und darüber die Verkündigung. Die Musikengel und singenden Kinder hat der japanische Bildhauer Etsuro Sotoo (1973-) geschaffen. Trotz der Zerstörung der Gipsmodelle der Engel während des spanischen Bürgerkrieges, dienten alte Fotografien, die im Atelier von Gaudí, aufgenommen wurden als Modell. Seit 1978 ist er bereits vom Werk Gaudís fasziniert. Er wird in Japan der „japanische Gaudí“ genannt und konvertierte sogar zum katholischen Glauben.
Ganz oben die Krönung Marias.
Oben bei der Fiale das Monogramm von Jesus JHS. Die lateinische Deutung „Jesus hominum salvator“ = Jesus, Erlöser der Menschen. Darüber der Pelikan, als Symbold für Jesus, ganz oben die Zypresse, das Symbol ewigen Lebens. Die reinen Seelen fliegen in Form von weißen Tauben zu diesem Baum und warten auf den Einlass ins Paradies.
Das rechte Portal heißt Portal des Glaubens. Ganz oben im Tympanon, neben den Engeln mit Trompeten, die Darstellung Jesu im Tempel.
Links die Heimsuchung, Maria bei Elisabeth. Auf dem Podest Hühner.
Rechts Jesus arbeitet als Zimmermann in der Werkstatt seines Vaters. Vor ihm stehen Maria und Josef, die nach oben zur Szene über der Tür blicken. Auf dem Podest Hühner mit Küken.
Oben über der Tür predigt Jesus im Tempel. Rechts neben Jesus schreibt Zacharias, als er von der Schwangerschaft seiner Frau Elisabeth gehört hat, den Namen Johannes an die Wand. Links von Jesus sein Cousin Johannes als Kind.
Ganz oben im Giebel in einer Art Höhle die Darstellung der unbefleckten Empfängnis. Diese Darstellung steht auf einem Kandelaber mit 3 Armen, Symbol für die heilige Dreifaltigkeit. Oben in der Spitze eine rechte Hand mit einem Auge, die göttliche Vorsehung, das Mittel mit dem Gott alle Dinge im Universum regiert. Rechts und links zwei Apostel, links Thaddäus, rechts Matthias.
Über der Tür wieder ein Relief aus Metall mit Blättern, Blüten, Schmetterlingen und Vögeln.
Die Türme über der Geburtsfassade. Für Gaudí waren die Türme Lanzen, die die Erde mit dem Himmel verbinden. 1925 wurde der Sankt-Barnabas-Turm fertiggestellt, der einzige Turm, den Gaudí noch zu Lebzeiten sehen konnt. Von der vorderen 4 Türmen ist es der Turm ganz links.
Details der Mosaike mit dem Kreuz an der Spitze. Rechts das Evangelistensymbol von Lukas, der Stier. Die Löcher in den Spitzen symbolisieren desn Bischofsring und die Biegung darüber den Bischofsstab.
Geht man im Uhrzeigersinn um die Kathedrale herum, kommt man zum Langhaus.
Baustelle für die geplante Glorienfassade oder Fassade der Herrlichkeit. Sie liegt der Apsis gegenüber an der Carrer de Mallorca und ist nach Südosten ausgerichtet. Der Bereich der geplanten Treppenanlage vor dieser Hauptfassade wird seit einigen Jahrzehnten von einem Wohnblock eingenommen, der den bisherigen Planungen entgegensteht.
Auf der der Geburtsfassade gegenüberliegenden Seit des Querschiffs liegt die nach Südwesten ausgerichtete Passionsfassade oder Fassade des Leidensweges.
Am Übergang zwischen der Passionsfassade und dem Langhaus sind zahlreiche kleine Giebel, die mit bunten Früchten aus Mosaik bekrönt sind.
Die Fassade unterscheidet sich von ihrem Gegenstück dahingehend, dass sie kaum Verzierungen enthält und mit klaren, geometrischen Linien und großen Figuren übersichtlich aufgebaut ist. Sie wird von sechs schrägen Säulen gestützt und hat drei Portale. 1911 litt Gaudí an einer schweren Krankheit und fühlte sich dem Tode nahe. Zu dieser Zeit gestaltete der diese Fassade. Die originalen Zeichnungen sind noch erhalten. Erzählt wird die letzte Woche im Leben Jesu. Das Vordach erinnert an Knochen. Erst 1986 wurde der Maler und Bildhauer Josep Maria Subirachs (1927-2014) mit der Schaffung der Skulpturen beauftragt. Erst 2009 war dieses Werk vollendet.
Links vom Eingang der Judaskuss, rechts die Verleugnung des Petrus. Über der Tür ein Evangelist, Veronika mit dem Schweißtuch und Jesus fällt unter dem Kreuz. Ganz oben die Kreuzigung mit Johannes, Maria und Maria Magdalena. Darüber der durch den Tod Jesu zerrissene Schleier. Darüber hinter den kleinen Säulen das leere Grab.
Links neben den zentralen Motiven unten das letzte Abendmahl und Judas mit den Silberlingen. Der Reiter ist der Soldat Longinus und darüber die Soldaten beim Würfelspiel.
Detail der Szene mit Veronika und dem Schweißtuch über den Türen.
Detail des Judaskuss links neben den Türen. Hinter Judas die Schlange als Symbol des Bösen. Links ein magisches Quadrat. Im Unterschied zu den klassischen magischen Quadraten, deren Summenkombinationen immer 34 ergeben, hat Subirach die 10 und die 14 wiederholt. So ergibt sich aus allen Kombinationen die Summe 33, das Alter Christi zum Zeitpunkt seines Todes.
Vor den Türen aus Metall die Plastik aus Travertin mit der Geißelung Christi. Auf der Mittelsäule zwischen den Türen die Buchstaben Alpha und Omega, ein Symbol des Anfangs und des Endes.
3 Stufen, die Tage der Passion symbolisierend, führen zu der vierteiligen Säule, an die Christus gefesselt ist.
Die Türen aus Bronze stammen ebenfalls von Josep Maria Subirachs. Die mittleren Türen, wirken wenn sie geschlossen sind, wie ein riesiges offenes Buch. Hier werden die letzten Eposoden aus dem Leben Jesu nach den Evangelien erzählt. 8.500 Buchstaben sind verwendet worden und wirken wie eine riesige Druckplatte.
Die linke Tür ist die Tür von Gethsemane. Hier wird das nächtliche Gebet von Christus im Garten von Gethsemane gezeigt. Unter die drei schlafenden Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes.
Rechts neben der Kreuzigung die Grablegung, darunter die 3 Marias und Simon von Kyrene. Ganz unten das Urteil des Pilatus.
Blick auf den oberen Teil der Passionsfassade mit den Türmen darüber. Umgeben von Aposteln (von links nach rechts: Jakob, Bartholomäus, Thomas, Philippus) das glorreiche Kreuz. Über dem Kreuz die Himmelfahrt.
Das leere Grab
Blick auf weitere verschiedene Turmspitzen.
Links neben der Passionsfassade, an der Ecke des die Kirche umgebenden Kreuzgangs, steht eine der Sakristeien.
Kleines Nebengebäude neben der Sakristei.
Blick über die Kuppel der Sakristei hoch zu den Türmen.
Gaudí hatte auf beiden Seiten der Apsis Sakristeien geplant. Bisher gibt es nur diese neben der Passionsfassade im Westen. Die Kuppel besteht aus 12 Paraboloiden mit dreieckigen Öffnungen, durch die das Licht in den Raum fällt. Gaudí hatte Gipsmodelle hinterlassen, um zu zeigen wie die Struktur der Kuppel sein sollte.
Oben an der Kuppel außen Mosaiken und Flachreliefs mit einem Opferlamm und blauen Weintrauben.
Um die Sakristei weitere kleine Türme mit bunten Spitzen aus Mosaik.
Die Sakristei mit Teilen des Kreuzganges. Gaudí entwarf ihn als eine Abfolge von Modulen, die von kleinen Giebeln gekrönt sind.
Details der Apsis. Sie wurde 1892-1893 im neugotischen Stil errichtet, direkt nach dem Bau der Krypta.
An der Fassade sieht man Frösche, Eidechsen, Drachen, Schlangen und Salamander. Sie fliehen vor Maria und dem Glauben und dienen als Wasserspeier.
Zurück an der Geburtsfassade mit dem Haupteingang in die Kirche.
Plastik einer Mahonie, Pflanze auf der Terrasse vor dem Eingang.
Die Türen der Geburtsfassade:
2015 wurde diese Fassade durch die Anbringung der Türen endgültig fertiggestellt. Der Bildhauer Etsuro Sotoo (1953-) schuf sie aus Bronze und befolgte damit das von Gaudí vorgesehene Programm der Lobpreisung der Schönheit der Natur und des Lebens.
Auf der linken Tür sind Pflanzen und Tiere des Nils dargestellt, Binsen und Libellen.
Die mittlere Tür ist von Efeu bedeckt, laut Sotoo ein Symbol der Liebe, weil sich die Zweige aufeinander stützen. Überall zwischen den Blättern zahlreiche Tiere – Inseken, Vögel, Eidechsen, Spinnen, Schmetterlinge, Ameisen usw.
Das rechte, Maria gewidmete Tor zeigt Rosen ohne Dornen, ein Symbol der Jungfrau.
Inneres:
Grundriss: Unten die im Bau befindliche Hauptfassade, oben der Chor mit der Krypta, links die Passionsfassade und rechts der jetzige Haupteingang, die Geburtsfassade.
Man betritt die riesige Kirche vom rechten Querschiff aus, also von der Geburtsfassade. Blick vom Hauptquerschiff auf die andere Seite, Richtung Passionsfassade. Das Hauptschiff und das Hauptquerschiff sind 45 m hoch, die Seitenschiffe jeweils nur 30 m. Die Gewölbe werden von 4 Sorten Säulen aus Stein getragen. Die Säulen bestehen aus Materialien verschiedener Härte und sind unterschiedlich hoch. Die dicksten und längsten Säulen (22,2 m hoch, 2,1 m Durchmesser) sind aus rötlichem Porphyr. Die zweithöchsten Säulen (18,5 m hoch, 1,75m Durchmesser) sind aus Basalt und halten die Türme der Evangelisten. Im Mittelschiff helle Säulen (14,8 m hoch, 1,4 m Durchmesser) aus Granit und die Säulen (11,1 m hoch, 1,05m Durchmesser) unter dem Chor sind aus dem weichen Stein vom Montjuïch. Die Säulen sollen an Bäume erinnern und besitzen deshalb an ihren oberen Enden Verzweigungen, die sich wie Baumstämme in Äste aufteilen. Zudem wird ein Blätterdach angedeutet. So konnte man auf äußere Strebebögen verzichten. Seit 2010 ist der Innenraum fertig und die Fenster sind verglast. In Blickrichtung liegt auch die Vierung, erkennbar an den hell erleuchteten Medaillons der Evangelisten an den Säulen.
Schaut man nach links, hat man einen ersten Blick in das insgesamt 90 m lange Langhaus mit seinen 5 Schiffen und dem Wald aus Säulen.
Blick an die Decke des rechten Querschiffs. Rechts und links die beiden 30 m hohen Seitenschiffe und in der Mitte das 45 m hohe Hauptschiff des Querschiffs.
Detail der Decke.
Blick auf des rechte Querschiff von der Vierung aus. An den Kapitellen der Vierungspfeiler die Evangelistensymbole von Lukas (Stier) und Johannes (Adler). Dahinter der obere Teil des rechten Querschiffs mit farbigen Glasfenstern. Der oberste Teil ist noch neugotisch, wie man an der Rensterrose und den spitzbogigen Fenstern sehen kann.
Die Fenster weiter unten sind wie alle anderen moderneren Glasfenster ab 1999 vom Künstler Joan Vila-Grau (1932-) geschaffen worden.
Details des rechten Querschiffs.
Farbige Glasfenster mit Fensterrose auf der dem Chor zugewandten Seite des rechten Querschiffs. Außerdem die erste Säule des Kirchenschiffs, die 1921 erbaut wurde. Sie hat als Kapitell das „T“ für Tarragona.
Farbige Glasfenster mit Fensterrose auf der dem Langhaus zugewandten Seite des rechten Querschiffs.
Geht man weiter Richtung Vierung, links das Seitenschiff vom Langhaus und dann das wesentlich höhere Hauptschiff mit dem im Bau befindlichen zukünftigen Haupteingang.
Blick in ein Seitenschiff des Langhauses mit farbigen Glasfenstern in blau, grün und gelb. Im Hintergrund die Baustelle der zukünftigen Hauptfassade.
In einem Seitenschiff des Langhauses befindet sich eine Wendeltreppe.
Blick in das Gewölbe von Hauptschiff und Seitenschiffen im Langhaus. An einer Seite des Fenster der Baustelle der künftigen Hauptfassade.
Wald aus Säulen im Langhaus (schwarz-weiß Aufnahme).
Blick von Innen auf die künftige Hauptfassade, die Glorienfassade.
Die Innenseite der Tür der Eucharistie. Sie befindet sich im zentralen Portal der im Bau befindelichen Fassade. Sie wurde von Josep Maria Subirachs (1927-2014) geschaffen und zeigt das Vaterunser in zahlreichen Sprachen und Schriften. Im Zentrum der Tür befindet sich in größeren, polierten Buchstaben das Vaterunser in katalanischer Sprache.
Über der Tür thront der heilige Georg, der Schutzpatron Kataloniens. Sie wurde von Josep Maria Subirachs geschaffen.
Auf der linken Seite des Langhauses sind ebenfalls farbige Glasfenster, aber eher in warmen Farben, wie rot, organge und gelb angebracht.
Auch hier ist das äußere Seitenschiff ganz in die Farben der Glasfenster eingetaucht.
Linkes Querschiff, innen hinter der Passionsfassade. Auch hier farbige Glasfenster von Joan Vila-Grau.
Oben im Hauptschiff des Querschiffs das Fenster der Wiederauferstehung, wlecdhes den Sieg des Lebens über den Tod symbolisiert. Davor in der Vierung die beleuchteten Kapitelle, links der Engel von Matthäus, rechts der Löwe von Markus.
Auf dem Boden vor den Türen eine Darstellung vom Einzug Jesu in Jerusalem, als „König Israels“ vom Künstler Domènec Fita (1927-2020).
Die Vierung: Blick in das 60 m hohe Gewölbe. Die Kuppel der Vierung stellt den Thron Gottes und des Lammes dar, gebildet von einem zentralen, hyperboloidförmigen Fenster im Dach. Über diesem Gewölbe erhebt sich der Turm Jesu Christ mit 172,5 m Höhe. Umgeben ist die Vierung von 4 Säulen aus Porphyr, die beleuchtete Evangelistensymbole an den Kapitellen bzw. Astknoten zeigen.
Blick in den Chor, links wieder eine Wendeltreppe.
Die 75 m hohe Kuppel der Apsis. Der Hyperboloid hat einen Durchmesser von 17,5 m und ist mit goldenem Mosaik verziert. Es soll das Gewand Gottes darstellen. Es ist ein Werk des Keramikers Jordi Aguadé (1950-). Über diesem Gewölbe steht der Turm Mariens mit 130 m Höhe mit dem zwölfeckigen Stern an der Spitze.
Hinter dem Hochaltar eine Chororgel, die von der Orgelbaufirma Blancafort Orgueners des Montserrat im Jahr 2010 errichtet wurde
Stufen führen zum Hochaltar, über dem ein schirmförmiger, siebeneckiger Baldachin hängt. Er ist us Metall und gläserne Trauben und Ähren aus weißem Holz hängen von ihm herab, beides Symbole der Eucharistie.
Am Baldachin hängt ein 1,90 m großes Kruzifix von Francesc Fajula Pellicer (1945-). Es wurde nach einem Modell von Gaudí für die Kapelle in der Casa Batlló geschaffen.
Auf dem Boden Mosaik mit Symbolen.
Gedenktafel für die Weihe der Kirche durch Papst Benedikt XVI. 2010. Sie wurde zur Basilika erhoben.
Weihwasserbecken mit einer originalen Muschelschale, die Eusebi Güell Gaudí von den Philippinen mitgebracht hatte. Die Muschel sitzt in einer Halterung aus Metall und wurde so auch in der Krypta verwendet.
Farbige Glasfenster im Chor und Sitzbänke für Chöre. In den Geländern aus Metall sieht man Partituren bzw. Noten der Kirchenlieder.
Chorumgang mit farbigen Glasfenstern. In einer der Kapellen ein von Gaudí entworfener Beichtstuhl. Er entstand ca. 1898 in der Werkstatt von Joan Munné.
Detail der Kapitelle.
Wendeltreppe im Chor.
Detail von farbigen Glasfenstern und Kapitellen mit Engeln in einer der Kapellen.
Blick vom Chorumgang in die darunter liegende Krypta. Als Gaudí die Bauleitung übernahm, hatte der Bau der Krypta schon begonnen, sodass keine größeren Planänderungen mehr möglich waren, jedoch erhöhte Gaudí das Gewölbe so weit, dass von oben Licht und Luft hineinströmen können.
Die Krypta wurde im neugotischen Stil erbaut. Die ist fast ein Rundbau mit 120 qm Fläche. Sie wird flankiert von 7 Kapellen im Halbrund. Die mittlere Kapelle ist dem heiligen Josef geweiht. Von hier aus wird die Messe gelesen. In der Kapelle der Heiligen Jungfrau vom Karmel ist Antoni Gaudí begraben.
Auf dem Fußboden Mosaik mit Weinlaub, Weintrauben und Vögeln. Entworfen von Gaudí und ausgeführt in der klassischen römischen Mosaiktechnik von Mario Maragliano i Novone (1864-1944).
Museum im zentralen Teil der Sakristei und Teilen des Kreuzganges: Hier sind von Gaudí 1897 entworfene Ziermöbel und liturgische Gegenstände zu sehen. Obwohl sie während der Aufstände im Jahr 1936 schwer beschädigt wurden, wurden die Teile, die gerettet werden konnten, wiederhergestellt und der Rest wieder aufgebaut.
Informationstafel zur Geschichte der Sagrada Família.
Modell der Sagrada Família.
Stuhl aus Holz mit christlichen Symbolen auf der Lehne, designed von Gaudí.
Kruzifix designed von Gaudí.
Deckenleuchte aus Glas und Metall aus der Krypta. Sie stammt aus der Zeit zwischen 1923 und 1926.
Möbel aus dem Arbeitszimmer von Gaudí
Historische Fotos von der Krypta.
Foto aus einer Werkstatt der Sagrada Família.
Informationstafeln zur Gestaltung der zahlreichen Turmspitzen. Jeder Turm wird von einer Spitze gekrönt, die sich durch die Farben ihrer polychromen venezianischen Glasmosaiken und die von Gaudi verwendeten geometrischen Formen auszeichnet. Dargestellt sind die 4 Symbole der Bischöfe. Ganz oben die Mitra mit dem Kreuz, darunter der Bogen des Bischofsstabes und darunter der Ring des Bischofs.
Modell der Turmspitze des zweithöchsten Turms der Kirche, der Marienturm.
Fotos von der Weihe der Kirche.
Foto aus der Vogelperspektive von der Baustelle der Türme.
Foto mit der Gesamtansicht aus der Vogelperspektive der Geburtsfassade. Rechts vorne eine der Sakristeien und der umlaufende Kreuzgang.
Modelle der Turmspitzen, die die 4 Evangelistensymbole zeigen.
Foto einiger Türme, davon 2 der Evangelistentürme und im Hintergrund der Marienturm mit dem zwölfzackigen Stern.
Bank aus Eichenholz und Metall für die Kirche der Colonia Güell, 1913/14. Hergestellt aus Material, das aus der Textilfabrik Eusebi Güells gerettet wurde. Bemerkenswert ist die Einfachheit der Holz- und Eisenarbeiten sowie die Ergonomie. Die Rückenlehne wurde später hinzugefügt.
Informationstafel.
Triangelleuchter für 15 Kerzen aus der Krypta, 1898. Schmiedeeisen mit Blattgold. Wurde bis 1956 für Ostermessen verwendet.
Informationstafel.
Kandelaber mit 2 Armen aus Schmiedeeisen aus der Krypta 1898. Die zwei Arme sind durch eine horizontale Struktur verbunden mit Platz für 34 Votivkerzen.
Informationstafel.
Bank aus Holz und Eisen aus der Krypta, 1898. Rekonstruktion von 1942. Interessante Metallstruktur zur Verstärkung des Sitzes und der beweglichen Rückenlehne.
Informationstafel
Monogramm „JMJ“ – für Jesus Christus, Maria, Josef – aus Gips mit Eisenkern von der Decke der Kapelle in der Casa Battló, 1909.
Informationstafel.
Schrank aus Holz mit schmiedeeiserner Verzierung aus der Sakristei, unter anderem für liturgische Gewänder.
Bewegliche Kanzel aus Holz aus der Krypta, 1898. Rekonstruktion von 1943.
Altarkarten aus bemaltem Gips, 1904-1906. Sie enthalten den festen Teil der Messe und wurden auf den Altar gelegt, um den Priestern die Verfolgung der Eucharistie zu erleichtern. Sie wurden bis zum zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) verwendet.
Informationstafel
Schmiedeeiserne Kerzenhalter für den Altar aus der Krypta, 1890.
Blick an die Decke des Museums.
Blick in die Kuppel der Sakristei.
Plaça de Gaudí: Auf der Seite der Geburtsfassade, befindet sich die Plaça de Gaudí mit einem See und einem Park. Blick vom Platz auf die Sagrada Família.
Der Park mit Pinien und verschiedenen Pflanzen und Felsen, die sich um den See gruppieren.
Violette Blütenrispen.
Taube mit oranger Farbe auf dem Rücken.
Straßenhändler mit spanischen Fächern, die auf dem Boden ausgebreitet sind.
In den umliegenden Läden gibt es Mützen mit Bärengesicht, Hüte mit Gesicht, Handtaschen und Schuhe aus Naturmaterialien, spanische Andenken – Stiere oder Flamencotänzerinnen.
Laden des Fußballvereins FC Barcelona. An der Tür das Wappen des Vereins.
Plaça de la Sagrada Família: Sie befindet sich auf der Seite der Passionsfassade. Auch hier gibt es zahlreiche Straßenhändler, wie hier mit Ohrringen auf einem aufgespannten Schirm.
Schöne Straßenlaternen zwischen Bäumen und den bepflanzten Bereichen des Parks.
Streetartkünstler mit riesigen Seifenblasen
Rosa Blüten an einem Busch.
Eventuell eine Türkentaube an ihrem Nest im Baum.
Samenkapseln des Jacarandabaums oder Palisanderbaums.
Straßenhändler mit zahlreichen Stofftieren, Puppen, Nüssen, Modellautos und Süßigkeiten.
Kleine Allee in dem Park mit Bänken.
Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer: etwas südlich der Sagrada Família, an der Avinguda Diagonal und der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Passeig de Sant Joan liegt dieser Platz, der nach dem katalanischen Dichter Jacint Verdaguer (1845-1902) benannt ist.
Gebäude an diesem Platz.
In der Mitte ein Noucentista-Denkmal. Noucentista war eine katalanische Kulturbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die größtenteils als Reaktion auf den Modernisme entstand. Das Denkmal wurde 1912 von Joan Borrell-Nicolau (1888-1951) auf einer Säule errichtet. Drumherum eine ringförmige Architektur von Josep Maria Pericàs (1881-1966), mit Säulen und Flachreliefs, die Szenen aus Verdaguers Werken zeigen. Die Reliefs stammen von den Brüdern Llucià und Miquel Oslé.
Palau Ramon Montaner. Werk von Lluís Domènech i Montaner 1899. Das Gebäude im Stil des Modernisme ist der Sitz der Delegation der Regierung Spaniens in Katalonien. Es hat Mosaiken an der Fassade mit Darstellungen von Frauen. Auf dem Dach Plastiken von Drachen. Vor dem Haus ein schmiedeeiserner Zaun im Stil des Modernisme, ebenfalls mit Drachen. - Via Laietana: Der Bau der Via Laietana wurde erstmals 1879 geplant und 1907 unter großen Kontroversen mit dem Ziel begonnen, das Stadtviertel Eixample mit der Uferpromenade zu verbinden. Die Straße trennt die Viertel der Altstadt, die sich auf beiden Seiten befinden: La Ribera / El Born und Sant Pere auf der östlichen Seite und das Barri Gòtic auf der westlichen Seite.
Via Laietana 49 hat zahlreiche Kugeln, die wie Augen wirken an der Fassade. Hier die Rückseite des Hauses, dann die Fassade zur Straße.
Schaufenster eines Ladens mit spanischen Andenken.
Verschiedene Läden in der Gegend. In einem steht ein Auto mit Rosen geschmückt, als Vorgriff auf den Feiertag Sant Jordi.
Schaufenster mit verschiedenen Kunstwerken, zum Beispiel ein Zitat an Gemälde von Salvador Dalí, lesende Plastiken mit überlangen Beinen oder eine Hausfassade als Wanddekoration.
Via Laietana 54 und daneben eine runde Fassade des Modernisme mit Wappenschilden und neugotischen Fialian an Dach.
Daneben an einem kleinen Platz an der Einmündung der Carrer de les Jonqueres, Fein modernistischer Bau mit hohem Turm. Davor ein Denkmal für Francesc Cambó. In dem Gebäude befindet sich heut eine Bank. An der Ecke an der Fassade ein Skulpturengruppe.
Kleine Kuppel auf einem der benachbarten Häuser.
Via Laietana 50. Die Fassade ist mit Sgraffito verziert. Motive sind große Figuren, Architekturformen und Putten mit Instrumenten.
Rückseitige Fassade des Hauses.
Unten ein Laden mit seltsamen Plastiken mit nacktem Gesäß. Die sogenannten Caganer, katalanisch für „Scheißer“. Die im Ursprung eigentlich eigenwillige Krippenfigur aus dem katalanischen Kulturkreis, wird heute gerne modern umgedeutet und zeigt populäre Persönlichkeiten wie Politiker oder Sportler.
Blick auf die in der östlichen Altstadt liegende Plaça Lluis Millet.
An Hausfassaden befestigte Straßenlaternen.
Sant Pere und La Ribera, die Altstadt östlich der Via Laietana:
Plaça Lluis Millet: Auf dem Platz, vor dem modernen Anbau des Palau de la Música Catalana, eine große Plastik eines Kopfes vom Bildhauer Jaume Plensa (1955-).
Blick in eine Seitenstraße mit dem modernen Anbau an den Konzertsaal aus Backsteinen und rundem Turm mit Aufbau aus Glas. - Palau de la Música Catalana:
Der Palau de la Música Catalana stammt von einem der wichtigsten Architekten des katalanischen Modernisme Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Erbaut wurde der Konzertsaal von 1905 bis 1908. Das Gebäude war ursprünglich als Sitz des katalanischen Volkschors Orfeó Català gedacht – eine Funktion, die es bis heute erfüllt. Deshalb war die Akustik des Konzertsaals auch ausschließlich auf ein optimales Klangbild für Chormusik ausgerichtet. Da mittlerweile auch klassische Instrumental- und sogar Pop- und Rockkonzerte im Palau stattfinden, musste an der Akustik des Saals gefeilt werden. Seit 1997 gehört das Gebäude zum UNESCO Weltkulturerbe.
Allein von außen ist das Gebäude bereits beeindruckend mit seinen alten und neuen Gebäudeteilen. Zahlreiche Plastiken und Mosaike zieren die Fassaden. Große flache Bögen mit dicken Säulen, die mit floralen Mosaiken verziert sind, sind dem Eingang an der Carrer de Sant Pere Més Alt vorgelagert. Am übergang zu dem darüber liegenden Balkons Reliefs mit floralen Motiven und das katalanische Wappenschild.
Darüber ein Balkon mit Geländer aus grünen kleinen Säulen aus Keramik und bunte, mit Mosaiken verzierte Säulen, die mit Kapitellen aus Blüten zu den Stützen aus Backsteinen führen.
Auf den Stützen Büsten berühmter Komponisten, dahinter halbrunde Balkone, die von unten ebenfalls mit Mosaiken verziert sind.
Ganz oben ein Mosaik, datiert 1909 mit der Darstellung eines singenden Chores aus Männern und Frauen.
Detail der Fassade mit Büsten von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven.
Blick auf die Ecke des Gebäudes an der Carrer d’Amadeu Vives. In der Höhe der Balkone eine große über die Ecke gehende Plastik mit allegorischen Darstellungen, singenden Menschen und Vögeln in Nestern. Oben ein Ritter in Rüstung mit Fahne und Schwert.
An der Fassade in der Carrer d’Amadeu Vives eine Büste von Richard Wagner.
Blick in das Innere – Foyer und offenes Treppenhaus. Hinter dem Treppenaufgang bunte Glasfenster mit floralen Motiven.
An der von Säulen aus Stein getragenen, hellblauen flachen Decke, braune Bänder aus Keramik mit Rosenblüten, die die Deckenflächen unterteilen.
Fassade des Hauses an der Ecke gegenüber, mit einem runden, von Blüten getragenem Erker.
Carrer de Sant Pere Més Alt in der nordöstlichen Altstadt mit der Passaje Sert, einem Durchgang zur Carrer de Trafalgar, die außerhalb der Altstadt parallel verläuft.
Historischer Hausflur
Passatge de les Manufactures. Auch dies ein Durchgang zur Carrer de Trafalgar, die außerhalb der Altstadt parallel verläuft.
Kurzer Abstecher in die Carrer de Trafalgar mit einem Laden für Tattoowierungen.
Werbefigur für Tattoos mit der Darstellung eines Babies.
Banksy-Museum
Plaça de Sant Pere. Modernistische schmiedeeiserne Straßenlaterne mit Sitzbank und dem Namen des Platzes. - Sant Pere de les Puelles:
Kirche des Mitte des 10. Jahrhhunderts hier von Frauen gegründeten ehemaligen Benediktinerklosters. Das Kloster ist nach Mädchen benannt, die sich entstellten, um Vergewaltigung und Mord zu entgehen. Die ursprünglich präromanische Kirche zeigt noch einen Teil der Struktur in Form des griechischen Kreuzes sowie die korinthischen Kapitelle. Der kleine Glockenturm mit dem Namen ‚Los Pájaros‘ stammt ebenfalls aus romanischer Zeit. 1147 wurde eine neue Kirche errichtet und Teile der alten Kirche integriert. Mit der Säkularisierung 1835 wurde das Kloster zum Gefängnis. 1879 zog die Gemeinschaft nach Sarrià, wo sich das heutige Kloster in der Carrer d’Anglí befindet. Zwei schwere Brände, 1909 und 1939 verwüsteten das Gebäude.
Fassade zur Plaça de Sant Pere und Seitenwand der Kirche mit neuromanischem Portal, ohne Tür, nur mit Fenster.
Inneres:
Informationstafeln unter anderem mit einem Grundriss.
Blick Richtung Chor, durch den dreischiffigen Kirchenraum.
Details von Säulen mit Kapitell am Übergang zum Chor.
Romanischer Altar aus Stein mit der Darstellung des letzten Abendmahls und dem Einzug Jesu in Jerusalem.
Blick in die gemauerte Kuppel.
Apsis des linken Seitenschiffs. Im Gewölbe Christus Pantokrator.
Blick durch das Querschiff.
Reste der Kassettendecke aus Stein im Tönnengewölbe des Querschiffs.
Altar aus Stein in der Apsis des rechten Seitenschiffs. Christus in der Mandorla, gehalten von zwei Engeln. Rechts und links in je 3 Rundbögen Figuren von Heiligen.
Details von Säulen mit romanischen Kapitellen zwischen den Kirchenschiffen.
Praktische Rollos, die auch den Balkon vor Sonne schützen, an einer Hausfassade
Kuppel auf einem Haus im modernistischen Stil. Sie ist mit Fliesen bedeckt wie Schuppen eines Fisches. Die Fassade des Hauses hat oben 5 runde Fenster mit einem Monogramm in der Mitte und Ziermauerwerk aus Backseinen. - Arc de Triomfe:
Direkt am nordöstlichen Ende der Altstadt, am Beginn des breiten Richtung Nordwesten führenden Passeig de Sant Joan, liegt dieser ehemalige Haupteingang zum Gelände der Weltausstellung von 1888. Architekt war Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910). Eine breite begrünte Promenade, der Passeig de Lluís Companys führt zum Parc de la Ciutadella, auf dem sich damals das Gelände der Weltausstellung befand.
Der Bogen wurde mit rötlichen Ziegeln im Neo-Mudéjarstil errichtet, eine typisch iberische Ausrichtung des Historismus. Der Bogen ist 30 m hoch. Oben sind Wappen von Barcelona und aller spanischer Provinzen angebracht. Geschaffen wurden sie von Torquat Tassó und Antoni Vilanova.
Über dem Durchgang einen Fries mit der allegorischen Darstellung „Barcelona rep les nacions“ – Barcelona empfängt die Nationen von Josep Raynés Gurgui (1850-1926), Aus restauratorischen Gründen sind sie mit einem Netz verhangen.
Engel mit Fanfaren und Kränzen stehen an den kleinen Türmen, auf den Kronen sitzen.
Plastiken von Fledermäusen sind neben farbigen Friesen aus Keramik angebracht.
Straßenmusiker mit Eimern aus Plastik als Schlagzeuge.
Auf der Rückseite des Tores ein Fries von Josep Llimona i Bruguera (1864-1934) mit dem Titel „Recompense“, ebenfalls mit Netzes verhangen.
Blick über den breiten und begrünten Passeig de Lluís Companys. Große schmiedeeiserne Straßenlaternen mit 2 weit aufeinander geführten Armen, Palmen, Blumenbeete und Bäume.
Auf der linken Seite steht das Gebäude des Obersten Gerichtshofs von Katalonien. Das monumentale Gebäude wurde im eklektischen Stil von Enric Sagnier bzw. Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931) und Josep Domènech Estapà (1858-1917) entworfen.
An den Türmen Drachen und Blumen.
Ein Rundbogen über dem Eingang zeigt den Namen des Gebäudes vor floralem Untergrund. Darüber eine Plastik von Moses mit den Gesetzestafeln und 2 Frauen.
Blick zurück zum Arc de Triomfe.
An den Treppen zur parallel verlaufenden Straße, Vasen oder Feuerschalen aus Metall auf einem Steinsockel. Sie sind mit Drachen dekoriert.
Castell dels Tres Dragons oder „Burg der drei Drachen“: Im Stil des Modernisme erbaut 1887 aus Backsteienen vom Architekten Lluís Domènech i Montaner (1849-1923) für die Weltausstellung. Die optimale Nutzung der Ausdrucksmöglichkeiten neuer Baustoffe wie Ziegelstein, Eisen, Glas und Keramik sowie der neuen Bautechniken standen bei der Planung im Vordergrund. An den Ecken stehen vier wuchtige Türme. Sie zitieren den maurischen Baustil und haben oben Zinnen. Zwei Türme weisen einen quadratischen und die beiden anderen einen achteckigen Grundriss auf. Als Verzierung wurden bemalte Keramiken an der Fassade angebracht. Sie stammen von Alexandre de Riquer bzw. Alexandre de Riquer i Ynglada (1856-1920) und Joan Llimona i Bruguera (1860-1926). Währen der Weltausstellung befand sich hier ein Kaffeehaus und Restaurant.
Centro Cívico Convento de San Agustín: Der Augustinerorden gründete Anfang des 14. Jahrhunderts hier ein Kloster. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts bis 1980 wurde es als Kaserne und Militärakademie genutzt. Seit Ende der 1990er Jahre ist es ein Bürgerzentrum mit kulturellen und sozialen Programmen und Workshops. Blick in den Hof mit einem Flügel des gotischen Kreuzganges.
Giganten des Karnevals von Barcelona auf dem Weg zur Plaça Comercial mit dem Kulturzentrum „El Born“..
In einem schmalen Streifen zwischen dem Parc de la Ciutadella und der östlichen Altstadt befindet sich die Plaça Comercial. Mit Blumen bemalte Fassade eines modernistischen Mietshauses. - An der Plaça Comercial befindet sich die große, restaurierte ehemalige Markthalle „El Mercat del Born“. Heute ist sie ein Event- und Kulturzentrum. In der mehr als 8000 qm großen Halle sind Teile eines alten Stadtviertels freigelegt worden. Sie wurden bei der Belagerung und Einnahme der Stadt durch bourbonische Truppen während des spanischen Erbfolgekrieges 1714 abgerissen, um eine Zitadelle zu erbauen. Die Fundstätte ist Teil des Born Centre de Cultura i Memòria (auch: El Born CCM), das im Jahr 2013 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dieses Kultur- und Museumszentrum integriert die archäologische Fundstätte sowie zugeordnete Ausstellungen und Aktivitäten. Als die Zitadelle 1869 abgerissen wurde, errichtete der modernistische Architekt Joseph Fontserè i Mestre (1829-1897) eine Stahlkonstruktion mit zahlreichen Glaselementen, die 1876 als Markthalle eingeweiht wurde.
Inneres:
Blick in das Innere mit einem historischen, militärischen Rettungswagen und der umgebenden Stahlkonstruktion, die eine zentrale achteckige Kuppel trägt.
Als Besucher umrundet man die Ausgrabungen auf erhöhten Stegen. Man sieht ein Netz aus Straßen, Abwasserkanälen, Häusern, Palästen, Geschäften sowie Handwerksbetrieben wie Schmieden, Tuchfabriken, Kesselwerkstätten.
Informationstafeln zum spanischen Erbfolgekrieg mit Portraits von Philipp V. von Spanien links, in der Mitte der Habsburger Kaiser Karl VI. und rechts seine Frau Elisabeth Christiine von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Lageplan der Ausgrabungen.
Blick über die Ausgrabungen und durch die Markthalle. Im Hintergrund stehen die inzwischen angekommenen Giganten des Karnevals von Barcelona.
Vom Kulturzentrum „El Born“ Richtung Westen, gelangt man in den Passeig del Born. Turniere und Ritterspiele fanden hier früher statt (Born ist katalanisch und heißt Turnierfeld). Die verkehrsberuhigte Straße liegt im östlichen Teil der Altstadt, schon ziemlich dicht am Hafen. Am Ende der Straße liegt die gotische Kirche Santa Maria del Mar.
Fassade eines Hauses mit Schaufensterpuppen auf den Balkonen. Eine Schaufensterpuppe stellt die Filmfigur „Joker“ dar.
Mittelalterliches Gebäude. Auf dieser Straße wurden im 16. Jahrhundert die Opfer der Inquisition hingerichtet.
Modernistische Fassade. - Santa Maria del Mar:
Erbaut zwischen 1329 und 1383, ist sie ein sehr gutes Beispiel für katalanische Gotik. Sie wurde über einer spätrömischen Nekropole errichtet. Angeblich soll hier ursprünglich die heilige Eulalia bestattet gewesen sein. Die erste schriftliche Erwähnung einer Kirche Santa Maria am Meer stammt aus dem Jahre 998. Die verantwortlichen Architekten waren Berenguer de Montagut, der das Gebäude entwarf, und Ramon Despuig. Die Wände, Seitenkapellen und Fassaden wurden im Jahre 1350 vollendet. 1379 zerstörte ein Feuer bedeutende Teile des Bauwerks. Schließlich wurde die Kirche 1383 mit einer Messe eingeweiht. 1428 verursachte ein Erdbeben schwere Schäden und zerstörte die Fensterrose in der West-Fassade. Das neue Fenster im spätgotischen Flamboyant-Stil wurde 1459 vollendet. Der dreischiffige Bau ohne Querschiff, ist umgeben von engen Straßen.
Sicht vom Passeig del Born auf den Chor bzw. die Apsis der Kirche. Die Sakramentskapelle rechts daneben, wurde im 19. Jahrhundert hinzugefügt.
Portal welches direkt in die Apsis bzw. den Chorumgang der Kirche führt. Vor der Tür ein Polizeifahrzeug.
Wasserspeier an der Apsis.
Fossar de les Moreres, ein ehemaliger Friedhof, an der Südseite der Kirche. Auf dem Platz befindet sich ein Denkmal für die im Krieg gefallenen Katalanen mit einer Fackel der ewigen Flamme und einem Heldengedicht von Frederic Soler.
Gotisches Portal im Süden der Kirche.
Westfassade von der Plaça de Santa Maria, die ebenfalls früher ein Friedhof war. Die Fassade wirkt kompakt und hat eine gewisse Strenge, wie es für die katalanische Gotik typisch ist. Sie wird durch zwei hohe Strebepfeiler in drei Abschnitte geteilt, die den drei Kirchenschiffen im Inneren entsprechen.
Plastiken vom Apostel Petrus und Apostel Paulus besetzen die Nischen zu beiden Seiten des Westportals. Im Tympanon Jesus, flankiert von Maria und Johannes. Der schlanke, achteckige Nordwestturm wurde 1496 fertiggestellt, sein Gegenstück blieb bis 1902 unvollendet. Die große Fensterrose wurde durch ein Erdbeben 1428 zerstört und im Flamboyant-Stil 1459 erneuert.
Inneres:
Grundriss
Blick durch das dreischiffige Langhaus Richtung Chor. Es gibt keine Begrenzung zum Chorraum. Neuartig bei diesem Gebäude war die Bündelung der Gewölbelast auf wenige Punkte, so dass das einfache Kreuzrippengewölbe des Hauptschiffs von lediglich vier schlanken, achteckigen Säulen getragen wird. Dabei wird die für die damalige Zeit enorme Breite von 13 Metern überspannt.
In den Gewölben prächtig gestaltete Schlusssteine.
Blick auf die Orgel im südlichen Seitenschiff und einige Seitenkapellen. Die Orgel ist ein historisches Instrument, das von dem Orgelbauer Grenzing restauriert wurde.
Südlicher Chorumgang.
Blick vom nördlichen Seitenschiff Richtung nordlichen Chorumgang.
Nördlicher Chorumgang.
Blick in den Chorraum mit der Apsis. Ungewöhnlich für eine Kathedrale dieser Zeit sind die sehr schlanken Säulen, die die Apsis umgeben.
Blick in das Gewölbe der Apsis. Im Schlusstein die Darstellung der Krönung Mariens.
Blick durch das Langhaus Richtung Eingang im Westen mit der großen Fensterrose.
Der Eingang auf der Südseite von Innen.
Einer der Seitenaltäre. Aufgrund eines Feuers im Verlauf von gegen die Kirche gerichteten Unruhen im Jahr 1936 sind im Innenraum kaum Kunstwerke erhalten geblieben.
Laden mit spanischem Schinken und anderen Spezialitäten.
Häuser an der Plaça de Santa Maria, der Westfassade der Kirche direkt gegenüber.
Kleine Gasse gleich bei der Kirche Santa Maria del Mar.
Schaufenster mit Gebäck und Kuchen.
Modernes, surrealistisches Gemälde an einer Holztür mit einer Frau und Krokodil.
Bemaltes Rollo an einem Eingang – Motiv das Innere eines Restaurants.
Fassade der Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi oder Escola de la Llotja am Fasseig d’Isabell II. bzw. Pla de Palau.
Brunnen Font del Geni Català, der Kunstakademie gegenüber und kurz vor dem Hafen im Süden. Ganz oben eine Plastik der katalanischen Genie. Sie hat an allen vier Seiten Löwenköpfe und vier Frauen, die die 4 katalanischen Provinzen symbolisieren, die das Wasser der vier Flüsse Llobregat, Ter, Ebre und Segre führen.
Ebenfalls der Kunstakademie gegenüber am Pla de Palau das Gebäude der Delegación del Gobierno, ein Regierungsgebäude von 1790. - Carrer del Carme, ein kleine Straße westlich von La Rambla. Ein Laden mit Kleidung mit einem Eingang, verziert mit Mosaik im Jugendstil, Carrer del Carme 11.
Schaufenster mit zahlreichen, teilweise historischen Waffen für Ritter, Messern und Pistolen.
Eingang zu einem Restaurant mit einem stark bewachsenen Balkon darüber.
Carrer del Carme 15, in der Ecke des Eingangs die Plastik eines Drachens.
Carrer del Carme 23, modernistische, mit Marmor verkleidete Fassade einer Apotheke.
Darüber florale Motive an den Seiten eines Fensters und zwei Saxophon spielende Musiker als Plastik aus Metall vor dem bis zum Boden gehenden Fenster.
Carrer del Carme 24, die modernistische Fassade des Ladens „El Indio“. Dieser inzwischen geschlossene Laden wurde 1870 von dem Indianer M. Mitjans gegründet.
Carrer del Carme 32, Fassade, Haustür und Fenster eines modernistischen Hauses.
Carrer del Carme 59, mit Flachreliefs geschmückte Fassade.
Reial Acadèmia de Medicina: die an der Carrer del Carme gelegene Akademie befindet sich im Stadtgebiet, das die Gebäude des alten Hospital de la Santa Creu sowie das Haus der Genesung und das Gebäude der alten Hochschule für Chirurgie umfasst. Es bildet den Kern dessen, was seit mehr als fünfhundert Jahren, vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert, das Zentrum der früheren Gesundheitsversorgung Barcelonas war.
Plakat mit Foto des historischenanatomischen Saales. Dieses Amphitheater für Anatomie im neoklassizistischen Stil wurde von Ventura Rodríguez Tizón (1717-1785) entworfen.
Nischen mit und ohne Statue an Ecken von Institutsgebäuden in der Carrer de les Egipcíaques.
Straßenreinigung mit Fahrzeug und Wasserschläuchen.
Gran Via de les Corts Catalanes, große Straße in Ost-West-Richtung durch die Stadt. An der Kreuzung mit der Rambla Catalunya (etwas nördlich der Plaça de Catalunya), steht ein Eckhaus mit Plastik eines Adlers im Turm.
Laden mit Andenken.
Schaufenster mit Schuhen, Cowboystiefeln.
Carrer de Balmes 30. Modernistische Fassade eines Mietshauses.
Wo die Carrer de Balmes auf die Gran Via de les Corts Catalanes stoßt, Es ist derzeit der Hauptsitz der Versicherungsgesellschaft „Mutua de Seguros Universal“. Das Gebäude wurde um 1907 erbaut. Eingangstür mit kunstvollem schmiedeeisernen Gitter. Die rote Backsteinfassade ist mit Streifen, Erkern und Einfassungen der Fenster aus hellem Stein strukturiert.
Die lange Front des Hauptgebäudes der Universität an der Gran Via de les Corts Catalanes und der Plaça de la Universitat. Die Gründung der Universität erfolgte bereits 1450 von König Alfons dem Großmütigen. Nach den Erbfolgekriegen und der Aufhebung der katalanischen Sonderrechte, wandelte Philipp V. 1717 die alte Universität in eine Kaserne um. Erst 1837 kehrte der Lehrbetrieb nach Barcelona zurück. Das neugotische Gebäude mit neoarabischen und byzantinischen Dekorationselementen, wurde von Elies Rogent y Amat (1821-1897) entworfen und 1863-1882 realisiert. An der Fassade zwei Medaillons mit Porträts, rechts von Alfons V. von Aragon, dem Gründer der Universität.
Details der Fassade mit dem königlichen Wappen.
Blick auf einen der Türme mit Glocken, ganz im Sinne des Architekten mit dem Gebäude der Universität als weltlichem Tempel.
Eckhaus an der Plaça de la Universitat, Ecke Carrer de Pelai mit spitzem hohen Turm.
Die Geschäftsstraße Carrer de Pelai führt von der Plaça de la Universitat zu einer Ecke der Plaça de Catalunya. Hier steht die im Stil des Art Céco errichtete Casa Damians. Erbaut 1913-1915 nach Entwürfen der Architekten Eduard Ferrés (1880-1928), Ignasi Mas i Morell (1881-1953) und Lluís Homs i Moncusí (1868-1956). Das Gebäude wurde als Verkaufsstelle für die Firma Hijos de Ignacio Damians errichtet, die sich der Herstellung von Metallteilen wie Lampen, Stangen, dekorativen Figuren und architektonischen Accessoires sowie anderen schmiedeeisernen Elementen widmete. Es war eines der ersten Gebäude in der Stadt, welches aus Stahlbeton errichtet wurde. Die Fassade hat Galerien mit konvexen Fenstern. Ganz oben eine kugelförmige Oberlichtkuppel im expressionistischen Stil. Im fünften Stock befinden sich zwei große Plastiken in der Form von Karyatiden, die die Arbeit und das Studium symbolisieren und von dem Dramatiker und Künstler Lambert Escaler i Milà (1874-1957) stammen. Heute beherbergt es das Textilkaufkaus C&A.
Auch die Avenida del Portal de l’Àngel mündet parallel zur Rambla auf der Plaça de Catalunya. An einer Ecke ein modernistisches Eckhaus.
Davor einer der zahlreichen, symbolträchtigen Canaletes-Brunnen. Sie sind nach dem nördlichen Teil der Stadtmauer benannt. Dort fürhten schon im Mittelalter Wasserrinnen, die sogenannten Canaletes entlang. Der aus Gusseisen bestehende Brunnen mit seinen 4 Wasserhähnen, die in kreisförmige Becken speien, wird gekrönt von einer vierarmigen Laterne, die auf einer hohen Säule steht. Über jedem Wasserhahn prangt das Wappenbild der Stadt. Am Boden in einer der Ecken befindet sich sogar ein kleiner Wassertrog für Hunde. Der Brunnen wurde 1892 fertiggestellt. Die Stadtverwaltung entschied damals 14 baugleiche Brunnen auch in anderen Stadtteilen aufzustellen, von denen leider nicht mehr alle erhalten sind. - La Rambla: die bekannteste rund 1,2 km lange Straße Barcelonas. Allerdings gibt es mehrere Straßen, die im Namen „la Rambla“ enthalten, da es im arabischen (Al-Rambla) für einen eingetrockneten Fluss steht. Viele Straßen folgten ursprünglich ausgetrockneten Flüssen.
Sie liegt im Zentrum und verbindet den Plaça de Catalunya im Nordwesten, mit dem alten Hafen im Südosten. Auch sie hat in den verschiedenen Abschnitten von Nord nach Süd unterschiedliche Namen.
Erst mit dem Abriss dieser innerstädtischen Mauer (1704-1829) begann die Umgestaltung der Rambla in eine Promenade moderner Prägung. 1703 wurden die Rambles erstmals mit Bäumen bepflanzt (Pappeln und Espen). Ab 1859 wurden diese Bäume gefällt und durch Platanen aus der Region Girona ersetzt.
Heute wird zu beiden Seiten von Fahrbahnen für den Individual- und Busverkehr sowie von teils prächtigen und historischen Bauten flankiert. Nordöstlich der Rambla erstreckt sich das Altstadtviertel Barri Gòtic oder gotisches Viertel, südwestlich der ebenfalls zur Altstadt gehörende Stadtteil El Raval.
Straßenhändler mit Gegenständen, Brettern und Schüsseln aus Olivenholz.
Bunte Kleidung für Kinder, T-Shirts mit Motiven von Tieren.
Stand mit Tüchern und Schals.
Geschirr aus Keramik und Kannen aus Metall.
Eingang eines Hauses, mit Kassettendecke und Wandleuchter, den ein Drachen aus Metall hält.
Blick in einem weiteren Eingang eines modernistischen Hauses mit Kassettendecke und Treppenaufgang.
Detail der Deckenleuchte.
Blick in das Treppenhaus Säulen und bunten Glasfenstern.
Modernistische Fassade eines Mietshauses, La Rambla 129. Streifenförmige Reliefs zwischen den Balkonen.
Straßenhändler mit spanischen Fächern und kleinen Puppen mit gehäkelten spanischen Flamencokleidern.
Jugendstil-Fassade einer alten Apotheke „Farmaçia Hadal“. La Rambla 121.
Über der Tür ein schlafender Putto, umringst von einer Schlagen als Plastik.
Gegenüber, auf der Seite der Altstadt, ein kleiner Platz, der aus Mündungen kleiner Altstadtgassen entstanden ist, wie z.B. der Carrer de Canuda.
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona oder Königliche Akademie der Wissenschaften und Künste von Barcelona: La Rambla 115. Das 1894 erbaute modernistische Gebäude stammt vom Architekten Josep Domènech i Estepá (1858-1917). Die beiden 1893 fertiggestellten Türme, basieren aus astronomischen Messungen. Sie rahmen eine Uhr ein, die jahrzehntelang die offizielle Zeit in Barcelona bestimmte. Flankiert wird sie von zwei Plastiken, die die Wissenschaft – mit Kompass – und die künstlerische Genialität symbolisieren. Die stammen von Rafael Atché i Farré, der auch die Status auf dem Kolumbusdenkmal geschaffen hat.
Eglesia de Betlem oder Bethlehem-Kirche: an der Kreuzung der Rambla mit dem Carrer del Carme erhebt sich die barocke Fassade der ehemaligen Jesuitenkirche. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden im Zuge der Gegenreformation in Barcelona zahlreiche Kirchen und Klöster errichtet – besonders im damals noch relativ jungen Stadtteil El Raval. 1553 erhielten auch die Jesuiten die Genehmigung zum Bau einer Kirche in diesem Viertel. Das Gebäude mit angegliederter Schule wurde zwei Jahre später eingeweiht. 1671 fing sie Feuer und brannte ab. 1680-1729 wurde an gleicher Stelle mit einem wesentlich größeren und prächtigeren Neubau errichtet, ein Projekt von Josep Juli. Architekt war der Jesuit Francisco Tort und der Jesuit Pau Diego de Lacarre der Bildhauer. 1767 wurden die Jesuiten aus Spanien vertrieben. Die Kirche stand danach jahrelang leer und begann zu verfallen. Erst ab 1787 wurden wieder Gottesdienste abgehalten. 1936 wurde die Kirche während des Spanischen Bürgerkrieges in Brand gesteckt. Dabei brannte der prächtige barocke innenraum völlig aus und das Dachgewölbe stürzte ein. Seit dem Wiederaufbau zeigt sich die Kirche deutlich schlichter: Die Außenfassaden wirken grau und sind von schwerem Bossenmauerwerk geprägt.
Über dem Seiteneingang zur La Rambla das Jesuskind mit Kreuz und Lamm, darunter brennende Herzen.
Inneres:
Der Innenraum ist größtenteils schmucklos weiß und besteht aus einem Kirchenschiff im Basilika-Stil. Blick zur halbkreisförmigen Apsis.
Im Inneren befinden sich in beiden Seitenschiffen jeweils fünf von elliptischen Kuppeln gekrönte Kapellen, die durch Bögen getrennt werden. Die elliptische Kuppeln sind mit Laternen bekrönt, die man von außen sehen konnte.
Detail des Altars in der Apsis mit einer Statue von Maria mit dem Jesuskind. Darüber ein Mosaik mit Engeln an der gewölbten Decke.
Blick auf die dreiteilige Nordwand des Kirchenschiffs.
Seitenkapelle mit Kuppel, Kruzifix und modernen Wandmalereien mit Grablegung und Auferstehung.
Weitere Seitenkapelle mit Kuppel und Wandmalereien, unter anderem dem letzten Abendmahl.
Blick auf die Wandmalereien in der Kuppel mit der Anbetung des Lamm Gottes.
Blick auf die dreiteilige Südwand des Kirchenschiffs. Hier stehen noch drei barocke Altäre.
Die bemalte Kuppel mit Laterne und der obere Teil eines der Altäre mit Christus als Statue, darüber Gottvater und die Taube des Heiligen Geistes.
Altar mit der bekrönten Maria mit dem Jesuskind.
Daneben eine weitere Seitenkapelle mit moderner Wandmalerei mit der Taufe Christi. Hinter einem steinernen, wie Ruinen wirkenden Bogen, steht das Taufbecken.
Seitenkapelle mit einer Kopie der Schwarzen Madonna aus dem Kloster Montserrat. Die Figur ist zu einem Symbol für Katalonien geworden. Darunter morderne Flachreliefs mit der Darbringung Christi im Tempel, der Kreuzigung und der zwölfjährige Christus lehrt im Tempel.
Weitere schwarze Madonna mit Umhang und Krone.
Zur Weihnachtszeit werden in der Kirche zahlreiche kunstvolle Weihnachtskrippen ausgestellt, die zahlreiche Besucher anlocken.
Blick zur Orgel und dem Eingang.
In der der Kirche gegenüber liegenden Carrer de la Portaferrissa, ist die Font de la Portaferrissa. Hier befand sich eines der eisernen Tore in der alten Stadtmauer. Der Trinkwasserbrunnen ist mit einem Bild aus Fliesen verziert, welche das ehemalige Stadttor zeigen. Der Patronatsheilige „San Josep Oriol“ ist auch auf der Keramik zu sehen. Er überfliegt hier das Stadttor in die Stadt.
Ein modisch bekleideter Hund.
Straßenhändler mit Plüschtieren und Zeichentrickfiguren als Spielzeug.
Händler mit kleinen Totenköpfen mit Mützen, Helmen und Frisuren.
Straßenhändler mit Süßwaren, typischen Backwaren und Getränken.
Große lebende Statuen, überaus einfallsreich und prächtig verkleidet, hier als eine Art Drachen mit Flügeln und Hörnern, erbitten Geldspenden.
Blick auf die prächtigen Kandelaber als Straßenbeleuchtung, kurz vor dem Palau de la Virreina Cultura.
Palau de la Virreina Cultura: gleich neben dem Mercat de la Boqueria liegt dieses barocke Stadtpalais aus dem späten 18. Jahrhundert. Der Palast ist eines der ersten nennenswerten und noch heute erhaltenen Gebäude an der Rambla, das nach dem Abriss der Stadtmauer entstand. Der Palast gilt als schönstes barockes Profangebäude Barcelonas und wird heute als Kunst- und Kulturzentrum genutzt.
Erbaut 1772-1778 vom Architekten Josep Ausich i Mir, im Auftrag des damals amtierenden Vizekönigs von Peru, Manuel d’Amat i de Junyent, der hier seinen Lebensabend verbringen wollt. Die Fassadendekoration zeigt Einflüssen des Rokoko und stammt von Carles Grau. Blick in das Treppenhaus. Durch flach überwölbte Durchgänge kommt man in einen Innenhof.
Schaufenster mit den Giganten des Karnevals von Barcelona. Links die Gigantin Laia von Barcelona, in der Mitte der Stadtadler von Barcelona und rechts die beiden
alten Giganten des Karnevals von Barcelona. Erstmals erwähnt wurden sie 1859 im Zusammenhang mit der Ankunft des Königs des Karnevals, der alle Karnevalsveranstaltungen leitet. Im Jahr 1891 wurden sie der Casa de la Caritat des Provinzrats von Barcelona zur Freude verwaister Kinder gespendet. Bei den aktuellen Figuren handelt es sich um eine Nachbildung von Domènec Umbert aus dem Jahr 1987. Die Originalköpfe werden im Ethnologischen Museum aufbewahrt.
Informationstafel zu Laia von Barcelona.
Erotic-Museum, La Rambla 98. In einem Fenster im Obergeschoss eine Schaufensterpuppe in weißem, wehenden Kleid, im Stil des berühmten Fotos von Marilyn Monroe. Im Erdgeschoss in Mann in entsprechender Verkleidung.
Auf dem Mittelstreifen Blumenhändler mit Samen für Gemüse, kleinen Kaffeebechern mit Kakteen und halben kleinen Kaffeebechern als Magneten mit Kakteen.
Gegenüber der Mercat de la Boqueria oder Mercat de Sant Josep, die bekannteste Markthalle in Barcelona. Fläche von 2.583 m² und ganz aus Glas und Stahl konstruiert. Die Markthallen gehen auf einen Straßenmarkt zurück, der an der Rambla abgehalten wurde. Seit 1217 weiß man von Tischen, die in der Nähe des
ehemaligen Stadttors Boqueria aufgestellt wurden, um Fleisch zu verkaufen. Über Jahrhunderte befanden sich hier verschiedene, allerdings inoffinielle Märkte, vor und hinter dem Stadttor. Erst 1826 wurde der Straßenmarkt gesetzlich geregelt, und als 1835 der Konvent von Sant Josep abgerissen wurde, gestaltete man an seiner Stelle einen Platz, ähnlich der Plaça Reial mit umlaufenden Arkadengängen. Ein Jahr später wurde der Bau eines Marktes mitten auf dem Platz geplant. Die Bauarbeiten begannen 1840 unter Anleitung des Architekten Josep Mas i Vilà (1779-1856). Noch im selben Jahr wurde der Markt eröffnet, doch bis 1846 wurden immer wieder Änderungen am Bau vorgenommen. 1853 erhielt der Markt offiziellen Charakter. 1911 wurde der neue Fischmarkt eröffnet und 1914 wurde das Metalldach, so wie es heute zu sehen ist, eingeweiht.
Der bekannte Eingang zum Markt von den Ramblas stammt vom Architekten Antoni de Falguera i Sivilla (1876-1947).
Gedenktafel mit Relief für des Resturator der Markthalle Ramón Cabau (1924-1987).
Durchblick auf den Turm der Kirche Santa Maria del Pi im gotischen Viertel.
La Rambla 77, ein schmales Haus mit einem blau-weißen Mosaik an der Fassade mit floralen Motiven und der katalanischen Flagge.
Gegenüber die Casa Bruno Cuadros oder Casa dels paraigües: La Rambla 82, direkt an der Ecke der kleinen Plaça Boqueria. Ein Wohn- und Geschäftshaus, benannt nach seinem ehemaligen Besitzer. Es hat vor allem wegen seiner ungewöhnlichen, historistischen Fassadengestaltung im asiatischen Stil Bekanntheit erlangt hat. Der Architekt Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910) gestaltete das bereits 1858 erbaute Haus in den Jahren 1883–1888 um. Als Werbung für das Schirmgeschäft von Bruno Cuadros schuf Vilaseca den Fassadenschmuck aus Schirmen und fächern, sowie aus japanischen Holzschnitten nachempfundenen Wandbildern, die durch Schmuckfenster in asiatischem Stil ergänzt werden. An der Ecke ein schmiedeeiserner chinesicher Drache, der eine Laterne, einen Schirm und einen Fächer trägt. 1980 wurde die Fassade restauriert.
An der kleinen Plaça Boqueria ein historisches Gebäude mit rundem Erker an der Ecke.
Auf dem Mittelstreifen, bei der Metro-Station Liceu, ein 1976 vom Künstler Joan Miró geschaffenes Bodenmosaik.
Gran Teatre del Liceu, La Rambla 59: es ist das größte Opernhaus Barcelonas. Das Opern- und Konzerthaus wurde 1847 eröffnet. 1861 wurde das Haus durch einen Brand fast vollständig zerstört, lediglich der Eingang und der Spiegelsaal blieben erhalten. Nach einem erneuten Brand 1994 wurde das Haus im Jahr 1999 wieder eröffnet. Als Architekten des Rekonstruktionsprojektes fungierten Ignasi de Solà-Morales, Xavier Fabré und Lluís Dilmé.
Oriente Atiram Hotel, La Rambla 45. Ein prächtiges Gebäude aus der Zeit des Modernisme, mit braunen ionischen Säulen und Rundbögen, die die Fassade strukturieren. Über dem Haupteingang Plastiken von Engeln mit Fanfaren und in den Zwickeln zwischen den Bögen ornamentale Reliefs mit Krone und fünfzackigem Stern.
Zum Teil seltsame und ungewöhnliche Menschen tummeln sich auf La Rambla.
Frauen, verkleidet als Inderinnen im Sari und mit Fächer, tanzen über La Rambla.
Schaufenster mit bunten Andenken im Mosaikstil.
Durchblick auf einen Pub in der Carrer de Ferran, durch Kollonaden der Plaça Reial. Diese Straße verläuft neben der Plaça Reial und verläuft durch das ehemalige jüdische Viertel.
Blick von der Straße La Rambla über die kleine Querstraße Carrer Colom Richtung Osten zur Plaça Reial.
Plaça Reial: der geschlossene Platz ist von klassizistischen Häusern umgeben und liegt im Barri Gòtic, dem Altstadtviertel Barcelonas. Auf seinem Gebiet stand bis zur Säkularisation das Kapuzinerkloster Santa Madrona. Nachdem es ausgebrannt war, wurde es abgerissen und von 1848-1859 entstand nach Entwürfen des Architekten Francesc Daniel Molina i Casamajó (1812-1867) im neoklassischen Stil dieser Platz. Die Gebäude mit 4 Geschossen haben allle eine umlaufende Arkadenreihe, die darüber hinwegtäuscht, daß der Platz eigentlich einen etwas asymmetrischen Grundriss hat. Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert, war es der Flanier-Corso des katalanischen Bürgertums. Bis in die 1970er Jahre verkam jedoch der Platz immer mehr und wurde vermehrt Umschlagplatz des Drogenhandels. Von 1981-1983 wurde er wie viele andere Stadtteile Barcelonas saniert und verstärkten Polizeikontrollen unterworfen, sodass sich nun im nördlichen und östlichen Flügel zahlreiche gut besuchte Restaurants, Bars, Cafés, Bier- und Nachtlokale befinden.
Auf einem der Eckhäuser Plastiken von zwei Putten, die das kleine Wappen der Bourbonen-Könige mit den Säulen des Herkules halten.
In der Mitte die Fuente de las Tres Gracias, der Brunnen mit den 3 Grazien, ebenfalls von Francesc Daniel Molina i Casamajó. Aufgrund der massiven Wasserknappheit sind alle Brunnen abgestellt.
Auffällig sind die zwei behelmten Laternen, eines der Erstlingswerke von Antoni Gaudí. 1878 erhielt er den Auftrag.
Auf einem der zahlreichen Balkone werden die Tauben gefüttert.
Auf den zahlreichen Palmen nisten die überall gegenwärtigen Mönchssittiche.
Am Sonntagvormittag und an Feiertagen findet zwischen 9.00-13.00 Uhr auf dem Platz ein Markt für Philatelisten und Numismatiker statt.
Etwas weiter südlich das Mietshaus, La Rambla 25, mit Flachreliefs an der Fassade
Plaça del Teatre: hier steht das seit 2006 geschlossene Teatre Principal, das älteste Theater in Barcelona. Es wurde 1579 gegründet, zwischen 1597 und 1603 erbaut und mehrmals umgebaut, hauptsächlich 1788 und erneut 1848. Das Theater hieß ursprünglich Teatro de la Santa Cruz.
Auch hier wieder lebende Statuen, hier die Figur des Alien aus dem gleichnamigen Film, die um Geldspenden bittet.
Verschiedene Maler und Karikaturisten bieten Bilder zum Verkauf an.
Gegenüber vom Theater das Denkmal für den Dichter und Dramatiker Frederic Soler i Hubert (1839-1895). Es wurde entworfen von Pere Falqués i Urpí (1850-1916) und ausgeführt 1906 vom Bildhauer Agustín Querol Subirats (1860-1909).
Kurz vor dem Hafen befindet sich in dem ehemaligen Gebäude der Bank von Barcelona, das Museu de Cera, das Wachsfigurenkabinett. Durch eine kleine Gasse, die Passatge de la Banca erreicht man einen kleinen Platz, wo das Museum steht.
Auch hier kurz vor dem Hafen große, lebende Statuen, hier wohl ein Don Quijote, ganz in ein silbernes Tuch gehüllt. - Palau Güell:
Bedingt durch die schmale Gasse, kann man die 22 m hohe Fassade des Palau in ihrer Gänze nur von der Seite erahnen.
Der Palau Güell ist ein Frühwerk des Archtekten Antoni Gaudí (1852-1926). 1885 erhielt er den Auftrag von seinem Mäzen Eusebi Güell (1846-1918), auf einem 18 x 22 m großen Grundstück im verfallenen Viertel Raval ein Wohnhaus im großbürgerlichen Stil zu errichten. Der 1908 zum Grafen erhobene Kunst- und Architekturliebhaber war Industrieller und der Bau in der kleinen Seitengasse Carrer Nou de la Rambla, steht in einer der damals verwahrlosesten Gegenden Barcelonas. Das 1888 während der Weltausstellung eingeweihte Bauwerk machte Gaudí über die Künstlerkreise Barcelonas hinaus bekannt und zum beliebtesten und renommiertesten Architekten der Stadt. 2850 qm beträgt die Gesamtfläche aller Stockwerke im Palau Güell. 1936 brach der spanische Bürgerkrieg aus und der Palau Güell wurde beschlagnahmt und als Polizeistation verwendet. Seit 1984 steht das Gebäude auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO.
Teile der Fassade des Gebäudes erinnern an einen venezianischen Palast. Die beiden großen ovalen Tore an der Vorderseite fallen besonders auf: Durch diese konnte man mit Kutschen direkt in die Pferdeställe fahren. Gäste gingen dann über Treppen in die oberen Stockwerke.
Vor der Beletage erstreckt sich ein imposanter Erker, der fast die gesamte Breite der Fassade von 23,60 m einnimmt. Darüber in der 2. Etage zwei kleine Balkone mit kunstvollem Gitter aus Metall.
Die nebeneinander liegenden Ein- bzw. Ausfahrten für die Kutschen, die auch Eingang für Gäste waren. Ganz rechts eine kleine Tür, die für die Dienstboten gedacht war.
Detail der jeweiligen, mit aufwändigen Gittern versehenen Tore.
Zwischen den beiden Toren, befindet sich ein schmiedeeisernes Gitter vor dem Fenster der Pförtnerloge. Darüber die katalanische Flagge, gebildet aus Streifen und einem Netz aus Eisen. Ganz oben ein Phönix als Symbol der kulturellen Auferstehung Kataloniens. Die im ganzen Palais vorhandenen schmiedeeisernen Arbeiten stammen überwiegend von den Brüdern Josep und Lluís Badia.
Unten neben den Toren Schlangen aus Eisen.
Eingangshalle: die 100 qm große Eingangshalle verbindet die zentrale Haupttreppe mit der links und rechts davon befindlichen Ein- bzw. Ausfahrt für die Kutschen. Die Wege sind mit Imitationen der alten Pflastersteine, allerdings aus Kiefernholz belegt, um die Geräuschbelästigung gering zu halten. An den Seiten mit Marmor verkleidete Gehwege.
An der Decke in geometrischen Mustern angebrachte Backsteine.
Blick durch die kunstvollen schmiedeeisernen Gitter an der Fassade.
Haupttreppe
Neben der Haupttreppe eines der Tore aus Eichenholz mit Eisenbeschlägen zur Wagenhalle.
Zwischen den Balken an der flachen Decke der 3,70 m hohen Wagenhalle, weiß-blaue unglasierte Fliesen mit geometrischen und floralen Motiven.
In der Wagenhalle eine kleine, abgedeckte Wendeltreppe in das Untergeschoss.
Modell des Palau Güell von vorne, dem Dachgeschoss und der Fassade am hinteren Hof. Hier sieht man gut den angebauten Dienstbotentrakt.
Im hinteren Bereich der Wagenhalle führt eine Rampe für die Pferde in das Untergeschoss zu den Ställen.
Blick nach oben in dem Lichthof der oberhalb der Ställe liegt.
Blick auf die Bögen aus Backsteinen der Stallungen im Untergeschoss.
Die Pferdeställe schauf Gaudí als einen von tragenden Wänden befreiten Raum. So war genug Platz die Pferde in den Stall zu führen und auch die Belüftung funktionierte gut. 21 riesige Säulen aus Backsteinen mit zylindrischem oder pilzförmigen Kapitellen, stützen die Decke.
Blick auf die Fußgängerrampe, die unterhalb der Haupttreppe liegt.
Details der Säulen.
Der Hof bei den Stallungen. An den Säulen Anbinderinge für die Pferde aus Metall, hier verziert mit einem Hundekopf.
Schmiedeeisernes Gitter am Fahrstuhlschacht.
Vorraum und Vorsaal zur Beletage:
Am Ende der nach oben führenden Treppe liegt der Vorraum, der als Eingangsbereich zur Beletage gilt.
An der Kassettendecke über der Treppe hängt eine noch zum Originaldekor gehörende Lampe aus Eisen und Glas.
Die Wände sind mit Marmor aus Güells Steinbruch in Garraf verkleidet. Von hier verteilen sich die Wege in die verschiedenen Bereiche der Beletage – den Familienraum und den Vorsaal zum Hauptsalon. Rechts eine Bank aus Holz, die gleichzeitig als Geländer für die Treppe fungiert.
Der Vorraum besitzt Arkaden und Säulen aus Marmor aus Garraf, die zur Carrer Nou de la Rambla hinaus gehen. Rechts und links davon farbige Glasfenster mit Glasmalereien, die Figuren von Shakespeare zeigen.
Kassettendecke aus Holz mit geometrischen Figuren.
Der Vorsaal hat einen großen Erker zur Carrer Nou de la Rambla, dem Dreiergruppen aus Säulen mit Arkaden auf 25 cm hohen Sockeln vorgelagert sind.
Hier warteten die Besucher auf den Beginn der Feiern im Hauptsalon. Der 35 qm große, 7 m lange und nur 5 m breite Raum gewinnt durch die raffiniert angeordneten Säulen eine gewisse Tiefe.
Die Struktur der Kassettendecke aus Holz
Die Tür zum Hauptsalon hat einen aus der Wand hervorspringenden Rahmen und wirkt dadurch recht monumental.
Detail der schmiedeeisernen Leuchter am Durchgang zum Hauptsalon.
Hauptsalon: der zentrale, einem antiken Peristyl nachempfundene, 59 qm große Raum, geht über 3 Etagen und eine Höhe von insgesamt 16,4 Metern. Er bildet den Mittelpunkt des öffentlichen und privaten Lebens der Familie Güell. Der quadratische Grundriss wird durch verschiedene Elemente unterbrochen.
Oben unterhalb der Kuppel kann man die Orgel von Aquilino Amezua y Jáuregui (1847-1912) sehen. Schmiedeeiserne Lampen beleuchten zusätzlich zu den Fenstern, die in den Etagen zu den angrenzenden Räumen führen das Innere.
Hinter zwei Türen, die für liturgische Zwecke geöffnet werden konnten, ist eine Kapelle verborgen. Neben der Kapelle ist in einem kleinen Raum die Tastatur der Orgel und es gibt eine Empore für ein Orchester. So konnte der Hauptsalon auch als Konzertsaal genutzt werden. In den Ecken des Hauptsalons befinden sich Ölgemälde von Aleix Clapés Puig (1850-1920), hier rechts von der Kapelle zum Beispiel die Heilige Elisabeth von Ungarn.
Historisches Foto der Kapelle, in der sich früher ein kleiner Altar und ein neugotisches Bildnis der Jungfrau Maria befand. Güell erhielt 1876 die Erlaubnis vom Papst hier religiöse Zeremonien abhalten zu dürfen.
Die Türen zur Kapelle sind mit 24 Ölgemälden von Aleix Clapés Puig (1850-1920) geschmückt. Außen 12 Heilige und innen die 12 Apostel.
Inneres der Kapelle bzw. des Gebetsschrankes, der mit vergoldeten Messingplatten verkleidet ist. Auf der rechten Seite konnte in 2 kleinen übereinander gelegten Logen die Zeremonie aus nächster Nähe betrachtet werden. Die 3 unteren Sitze waren für die Familie Güell vorgesehen, darüber konnten auch Bedienstete teilnehmen.
Die Kassettendecke ist ebenfalls teilweise vergoldet.
In einer anderen Ecke des Hauptsalons ein Ölgemälde mit der Darstellung des Philosophen Jaume Balmes und einer der schmiedeeisernen Leuchter.
Großes Fenster zu einem der angrenzenden Räume.
Vor der Treppe zur Zwischenebene mit der Empore für das Orchester, eine Säule aus Marmor mit der Büste von Eusebi Güell, geschaffen von Rossend Nobas i Ballbé (1841-1891). An der Säule ein Blumenstrauß aus Metall. Das Geländer der Treppe aus Ebenholz mit Intarsien aus Elfenbein.
Besuchsraum: von der Lage liegt er neben dem Vorsaal und geht ebenfalls mit einem Erker zur zur Carrer Nou de la Rambla hin. Auch hier Säulen und Arkaden aus Marmor. Die Dekoration des Raumes ist sehr aufwändig. Zwischen der komplexen Kassettendecke und der Wand hat Gaudí einen Tragrahmen mit Gitterkonstruktion anbringen lassen, der es den Familienmitgliedern erlaubte, von der darüber liegenden Etage die Gäste zu beobachten. An der hinteren Wand die Tür zum Toilettenzimmer, ein spezieller Raum für die weiblichen Gäste.
Blick in die Decke aus Eichenholz, verziert mit Blattgold und Ornamenten aus Schmiedeeisen.
Die Arkaden und Säulen vor dem großen Fenster sind auch hier flankiert von zwei farbigen Glasfenstern mit Glasmalereien, die Figuren von Shakespeare zeigen.
An den Wänden und um die Türen aufwändige Schnitzereien und Holzvertäfelungen mit floralen und graphischen Motiven, die zum Teil vergoldet sind.
Im Toilettenzimmer eine Truhe, die mit Eisenbeschlägen und Malereien verziert ist. .
Langer Gang mit Arkaden und Säulen.
Die hintere Fassade des Palau Güell ist aus dem gleich Kalkstein wie die Straßenfassade erbaut. Er stammt aus dem Steinbruch Garraf, der Güell gehört. Zentrales Element ist ein Erker aus Holz und Keramik, der von der Terrasse bis zum dem Sonnendach auf dem Balkon der 2. Etage (vor dem Schlafzimmer der Güells) reicht. Die Konsolen des Erkers bestehen aus Eisen und Holz, wie man an der rechten Seite gut sehen kann.
Im rechten Winkel schließt sich ein Flügel aus unverputzten Ziegeln an, der vor allem für das Personal vorgesehen war.
Das bunte Glasfenster im Familienzimmer vom Hof aus gesehen.
Blick von der Beletage in den Innenhof, der der Beleuchtung und Beluftung des Untergeschosses diente.
Beletage: in der klassischen und islamistischen Architektur, wurden bei herrschaftlichen Häusern die Räume rund um einen Innenhof, das Peristyl angeordnet. Da die Familie Güell nicht nur seit 1908 in den Adelsstand erhoben wurde, sonder auch einer der bedeutendsten Unternehmer Kataloniens war, sollte sein Haus auch für gesellschaftliches Leben und den Empfang hochgestellter Persönlichkeiten ausgestattet sein.
Richtung Süden, dem hinteren Hof zugewandt, liegen 3 Räume, die insgesamt 102 qm groß sind und durch leicht abnehmbare Türen aus Holz und Schmiedeeisen unterteilt werden. Sie gehören zum privaten Bereich der Beletage.
Historisches Foto von diesem Bereich.
Familienraum für Treffen der Familie mit Freunden und hier übte die Tochter Güells Klavier.
Buntes Fenster zum hinteren Hof mit eingeätzten historischen Motiven. Das Glasfenster stammt eventuell aus dem Palau Fonollar.
Die geschnitzten Holzvögel über der Täfelung dienten als Lampenhalter.
Detail der Vertäfelung aus Nussbaumholz an den Wänden mit Pflanzen- und Tiermotiven.
Raucherzimmer: Kassettendecke aus Holz mit geometrischen Formen und einem großen Fenster zum innen liegenden Hauptsalon.
Arkaden zum Erker des hinteren Hofes und einer die Form des Erkers nachvollziehenden Sitzbank.
Historisches Foto.
Blick in das Speisezimmer.
Der dominierende Kamin aus Marmor und Walnussholz wurde von Camil Oliveras gestaltet, der auch die Holzvertäfelungen und Kassettendecken der vorherigen Räume geschaffen hat.
Blick in die Decke aus Holz mit Flachreliefs und einem Leuchter aus Messing und Kristall.
Säulen am Fenster zum hinteren Hof aus Marmor aus Garraf, einem Güell gehörenden Steinbruch.
Hinten links in dem Raum der Durchgang zum Billardzimmer.
Details des 4,98 m hohen und 2,61 m breiten Kamins. In der Mitte eine Lampe in der Form einen Blumenstraußes aus Disteln.
Einige Stühle sind mit mehrfarbig geprägtem Leder, genannt „Guadamassils“ bezogen. Hinter der Stuhllehne kann man den geöffneten Barschrank im Kamin erkennen.
Blick in das Speisezimmer vom Kamin aus. Links im Durchgang sieht man den Spieltisch der Orgel, abgesperrt mit einem kunstvollen Gitter aus Holz mit Intarsien aus Elfenbein. Das Gitter diente auch als Rückenlehne für den 0rganisten:
Die Seite des Kamins mit Schnitzereien aus Holz, wieder mit Tier- und Pflanzenmotiven.
Detail mit sich windenden Schlangen.
Buntes Glasfenster mit den Initialen für Eusebio Güell.
Blick in das hinter dem Speisezimmer, im Anbau liegende Billardzimmer. Von den Töchtern Güells wurde es auch als Zeichenatelier genutzt.
Hinten an der Wand mit bunter Glaskunst umrahmte Fenster.
Neben dem Billardtisch ein Gestell aus Holz zum Zählen der Punkte.
Kapitell einer Säule aus Marmof aus Garraf.
Blick von der 2. Etage in den Hof der Stallungen im Untergeschoss.
2. Etage, Schlafzimmergeschoss: der 387 qm große Bereich mit den Schlafzimmern, ist um den vertikalen Bereich des Hauptsalon herum angelegt. Hier befindet sich eine Dauerausstellung mit Möbeln der Zeit des Modernisme und Möbeln der Familie Güell. Da die Familie Güell nur bis in die 1930er Jahre den Palau Güell bewohnten, wurden die Möbel unter mehreren Familienmitgliedern aufgeteilt, wodurch das Gebäude fast leer war.
Als in den 1950ger Jahren die erste Restaurierung des Gebäudes abgeschlossen war, wurde es Sitz der Gesellschaft der Freunde Antoni Gaudís. Kurz danach war es das Museum des Instituts für Darstellende Kunst. Seit dieser Zeit haben beide Institutionen begonnen Möbel aus der Zeit des Modernisme zu sammeln. Nach der umfassenden Restaurierung des Palastes zwischen 2004 und 2011, wurden alle diese Möbelstücke in einer separaten Sammlung zusammengefasst, die Barcelonas führende Innenarchitektur der damaligen Zeit repräsentiert und auch Zeugnis ablegt von der eigenen Geschichte des Palastes nach der Zeit von Gaudí und der Familie Güell.
Das Ehepaar Güell hatte 10 Kinder und so passten sich die Räume an die Bedürfnisse der Familie an, deren jüngstes Kind gerade geboren war und die älteste Tochter bereits 17 Jahre war. Im mittleren Bereich befanden sich Badezimmer und ein Familienraum.
Kunstvolles Geländer zur Treppe und dem Hauptsalon.
Familienraum: dieser Raum für Familienzusammenkünfte war auch Übergangsraum zwischen Treppe und den Schlafzimmern.
Am Ende der Treppe ein schmiedeeisernes Geländer aus spiralförmigen Einsenbändern.
Blick durch den Raum in Richtung der Fenster, die zum innen liegenden Hauptsalon weisen.
Der große Kamin aus rotem Marmor und Alabaster, entworfen vom Architekten Camil Oliveras i Gensana (1840-1898). innerhalb eines Rahmens aus rotem Marmor, die Darstellung der heiligen Elisabeth von Ungarn aus weißem Marmor, geschaffen von Alexandre de Riquer 1883. In den Ecken der habsburger Doppeladler.
Detail der Seiten des Kamins.
Hauptschlafzimmer mit 80 qm, auf der der Straße abgewandten Seite des Hauses. Bei reichen Familien jener Zeit, war es üblich das Schlafzimmer in zwei getrennte Bereich aufzuteilen. Hier der 43 qm große Schlafbereich von Isabel López, der Ehefrau von Güell. In der Ecke ein Kamin mit Waschbecken darüber. Links eine mit Stoff überzogene Holzwand, die den Ankleidebereich abtrennt.
Vor dem Fenster Bögen mit Kapitellen aus Eisen und Bronze, dekoriert mit Kränzen und Medaillons mit verschiedenen Inschriften, hier das Entstehungsjahr 1895.
Blick in die Kassettendecke.
Schlafbereich von Eusebi Güell mit 37 qm etwas kleiner. Auch hier ein Waschbecken über dem Kamin und Arkaden innen vor dem Fenster.
Historische Fotos des Hauptschlafzimmers mit seinen originalen Möbeln.
Schmiedeeiserne Ornamente an den Bögen der Säulen im Zimmer von Eusebio Güell.
Möbel des Designers Juan Busquets i Jané (1874-1949) im ehemaligen Lernzimmer mit Kollonaden vor den Fenstern. Zusammen mit Gaspar Homar wurde er einer der profiliertesten und erfolgreichsten Möbeldesigner des Modernisme. Nach einer äußerst vielseitigen Zeit schloss er sich kurz vor 1900 der internationalen Jugendstilbewegung an, die von der Arbeit belgischer und französischer Innenarchitekten und Tischler, insbesondere der Schule von Nancy beeinflusst wurde. Um 1911 gab er den Modernismus auf, um sich der Reproduktion von Stilen aus der Vergangenheit zu widmen.
Möbel aus der Zeit des Modernisme, Jugendstils.
Glasscheibe mit gravierten rankenden Pflanzen.
Möbel aus der Zeit des Modernisme, Jugendstils.
Kabinettschrank, ca. 1905 mit Intarsien und Beschlägen aus Messing von Caspar Homar i Mesquida (1870-1953). Er arbeitete zuerst in der Firma von Francesc Vidal i Jevellí, machte sich aber Ende des 19. Jahrhunderts selbständig. Internationale Bekanntheit erlangte er auf den Messen zwischen 1907 und 1911 in London, Venedig, Paris und Buenos Aires. Er war für seinen raffinierten, einfachen Stil bekannt, der vor allem nach 1900 stark vom Japonismus und den innovativeren englischen und Wiener Stilen beeinflusst wurde. Eines der Hauptmerkmale seiner Arbeit ist die Verwendung von Intarsien mit weiblichen Figuren und geometrischen Blumenmustern.
Ein Raum der Ausstellung mit verschiedenen Möbeln. Rechts eine Originalbronze des Bildhauers Josep Llimona i Bruguera (1864-1934), die ursprünglich in der zentralen Halle gestanden hatte. Auch der Schreibtisch aus Eusebi Güells Büro wurde als Leihgabe zur Verfügung gestellt.
Sofa und Lehnstuhl ca. 1886 von Francesc Vidal i Jevellí (1858-1914). Er war einer der ersten in Katalonien, der traditionelle Fertigkeiten nach dem Vorbild der englischen Kunst- und Handwerksbewegung wieder aufgriff. In Barcelona gründete er die Indústries Artístique Vidal mit den Bereichen Möbel, Metallarbeiten, Polsterung und Verglasung, wo einige seiner Mitarbeiter bald als wichtige Designer des Modernisme hervortraten, wie der Juwelier Lluís Masriera, der Glasmaler Lluís Rigalt, Maler und Innenarchitekt Designer Alexandre de Riquer und Tischler Caspar Homar. Die Polsterung stammt aus dem 18. Jahrhundert, sogenanntes „Guadamassils“, mehrfarbig geprägtes Leder.
Stühle aus Wallnussholz, 1885-1890 vom Innenarchitekten und Designer Francesc Vidal i Jevellí.
Die Fenster des Schlafzimmergeschosses zum Hauptsalon.
Blick nach oben in die Kuppel des Hauptsalons. Sie ist mit sechseckigen Stücken aus kristallinem Kalkstein verkleidet.
Blick von der 2. Etage durch dien Hauptsalon nach unten auf die Treppe.
Blick in den oberen Bereich des Hauptsalons.
Badezimmer mit blau-weißer Toilette.
Das Ankleidezimmer der ältesten Tochter, direkt neben dem Badezimmer.
Blick in den Dachboden, in dem einst die zahlreichen Bediensteten untergebracht waren.
Blick in den oberen Bereich des Hauptsalons bzw. Innenhofes. Links kann man die Pfeifen der großen Orgel erkennen, die oben im Hauptsalon angebracht ist.
Aus der 481 qm großen Dachterrasse, machte Gaudí einen weiteren Freizeitbereich für die Familie Güell mit ihren Gästen. In zwangloser Atmosphäre, im Gegensatz zu den edlen Räumen der Beletage, schuf er aus der Laterne, die dem Hauptsalon Licht von oben spendete und den 20 Schornsteinen, künstlerische Skulpturen mit viel Fantasie und Farbe. Mosaike aus bunten Scherben von Fliesen, aber auch Sandstein und Backsteine wurden verwendet.
Blick über den unteren Bereich der Dachterrasse mit den Bögen um den zentralen Turm und den Oberlichtern für die darunter liegende zentrale Halle.
Der konisch geformte Turmheld ist mit glasierten Sandsteinstücken beschichtet, die sein Inneres vor Feuchtigkeit schützen. Zahlreiche eingelassene Fenster beleuchten die Halle bzw. den Hauptsalon, der darunter liegt.
An seiner Spitze eine Kugel mit herausragenden Spitzen als Blitzableiter.
Ganz oben als Symbol Barcelonas eine Fledermaus als Wetterfahne.
Weitere Schornsteine.
Blick auf die etwas höher gelegene Personalterrasse. Hier wurde die Wäsche aufgehängt. Darunter der Zugang zum Treppenschacht.
Auf der Personalterrasse stehen 6 Schornsteine auf Ziegeln.
Blick auf die Türme der Kathedrale im gotischen Viertel.
Blick Richtung Hafenviertel mit dem Turm der Seilbahn und dem Kolumbus-Denkmal.
Die Schornsteine aus Ziegeln.
Blick über die Stadt. Hinten links der Montjuïc.
Carrer de Sant Paul mit Blick auf das ehemalige Kloster.
Blick auf die Rambla del Raval.
Streetart, Wandmalereien zum Thema sexuelle Rechte. - Sant Pau del Camp, San Pablo del Campo: Das Kloster wurde zwischen 897 und 911 von Wilfried II. (- 911) gegründet. Nach wechselvoller Geschichte wurde es mim Rahmen der Desamortisation in Spanien aufgehoben. Die Klosteranlage ist heute ein Museum.
Seinen Namen verdankt es dem Umstand, daß es außerhalb der damaligen Stadt, also auf dem Felde errichtet wurde. Erhalten hat sich auch die romanische Klosterkirche von 1117, errichtet auf kreuzförmigem Grundriss. Sie hat einen massiven Vierungsturm.
An der Westfassade Reliefs und Plastiken mit den Evangelistensymbolen.
Das Museum war geschlossen, daher nur ein Plakat mit Foto vom Kreuzgang.
Fassade eines Mietshauses mit Sgraffito-Technik. In der obersten Etage Fliesen, Backsteine und Plastiken von Bestien.
Detail des Eingangs mit der Jahreszahl 1898. Details der Balkone.
Laden für russische Spezialitäten mit kyrillischen Buchstaben und einem Bild eines Bären in einem von Pferden gezogenen Schlittens.
In der Nähe der Avinguda del Parallel der Nachtclub „Bagdad“.
An der Avinguda del Parallel ein Brunnen mit der Plastik der Sängerin und Schauspielerin Raquel Meller (1888-1962) von Josep Viladomat (1899-1989) aus dem Jahr 1966. Der Brunnen wird auch Font de la Violetera genannt.
Laden mit zahlreichen Prominenten als kleine Spielzeugfiguren, sogenannte Caganer – eigentlich katalanisch für „Scheißer“.
Gebäude des Verteidigungsministeriums am Hafen. - Plaça del Portal de la Pau: einer der Plätze direkt am Hafen, der mit 300 Hektar Größe, den gesamten Küstenstreifen bis zum Montjuíc einnimmt. Bevor Amerkia entdeckt wurde, gehörte er zu den bedeutendsten Häfen des Mittelmeers und noch heute ist er einer der wichtigsten Häfen Spanien.
Marina von Barcelona.
Blick auf den Turm der 1,3 km langen Seilbahn über den Hafen von Barcelona (Transbordador Aeri del Port)
Hier kommt der Boulevard La Rambla am Hafen an. Zahlreiche Cafés ziehen Straßenkünstler an, wie diese Artisten, die über eine Gruppe von Mädchen springen.
Auf diesem Platz steht das Kolumbus-Denkmal, welches 60 m hoch und 205 Tonnen scher ist. Es wurde für die Weltausstellung 1888 errichtet. Die eiserne Säule ist über und über mit allegorischen Figuren dekoriert. Am Sockel einige Reliefs mit wichtigen Szenen aus dem Leben von Kolumbus. Ganz oben eine 8 m hohe Statue von Kolumbus, die Richtung Meer weist von Rafael Atché i Farré.
Südlich steht das historische Zollamt. Es wurde zwischen 1896 und 1902 von Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931) und Pere García im klassizistischen Stil errichtet. Beflügelte Sphinxen ruhen ganz oben auf den Türmen.
Plaça Antonio Lopez an der Ostseite des Hafens mit einer großen bunten Pop-Art-Skulptur von Roy Lichtenstein “The Head”.
Avocado-Baum mit Früchten und weißem Gespinst, evt. von Schädlingen.
Mercado del Libro Dominical de San Antonio: 1882 (nach anderen Quellen 1879) erbaut auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes vom Architekten und Stadtplaner Antoni Rovira i Trias (1816-1889). Bedeutend ist vor allem ihre Eisenarchitektur. Es ist die erste Markthalle, die außerhalb der kurz vorher abgetragenen Stadtmauer errichtet wurde. Sie liegt auf einem quadratischen Platz an der Carrer del Comte d’Urgell, 1, an der Metro-Station Sant Antoni.
Mietshauses, Carrer de Balmes 65, mit Erkern aus Glas mit Jugenstil-Motiven und wohl Sgraffito-Technik an der Fassade.
Balkone mit zahlreichen Pflanzen.
Fassade und Details der Fassade des Mietshauses Carrer de Balmes 81. Fassade wohl mit Sgraffito-Technik verziert. Jugendstil.
Fassade und Details der Fassade des Mietshauses Carrer de Balmes 85. Jugendstil.
Detail von Fenstern des Hauses Carrer de Balmes 87. Jugendstil.
Fassaden und Details von Fassaden von Miethäusern in der Carrer de Balmes.
Traditionell eingerichtete Bäckerei mit Holzregalen und Backofen im Hintergrund. Die Eingangstür verziert mit floralem Motiv aus Metall.
Flur in einem Mietshaus mit floralen Malereien an der Wand, Jugendstil.
Haus des Barcelona-Clubs, Circulo Ecuestre an der Avinguda Diagonal, Ecke Carrer de Balmes.
Mietshaus an der Via Augusta Ecke Avinguda Diagonal. Oben eine Kuppel mit Mosaik auf Scherben von Fliesen.
Schneewittchenbrunnen aus Bronze von Josep Manuel Benedicto i García (1895-1964). Der Trinkwasserbrunnen von 1947 steht auf der Plaza de Gala Placídia.
„Dia de Sant Jordi“ naht, ein Verkaufsstand mit Rosen.
Blick in das Schaufenster eines Kostümverleihs für Figuren aus Star Wars. Maske von Yoda und Kostüm für Sturmtruppe bzw. Stormtrooper.
Bemalte Garagentore mit Werbung für einen Orthopäden und einem roten VW-Käfer. - Casa Vicens: 1883-85 von Antoni Gaudí (1852-1926) für den Keramikfabrikanten Manuel Vicens i Montaner erbaut. 1925 wurde es mit mit Gaudís Genehmigung von Joan Baptista Serra de Martínez (1888-1962) ausgebaut und die heutige Straßenfront dabei verändert. Das in einer kleinen Seitenstraße liegende Haus, ist Gaudís erster verwirklichter Entwurf eines Hauses. Es wirkt noch weitestgehend linear und verrät einen starken Einfluss der spanisch-maurischen Bautradition. In den unteren Etagen optisch eher der bürgerlich spanischen Tradition verhaftet, wird es nach oben hin immer arabischer, auch durch die reichliche Verwendung von Fliesen.
Fassade zur Carrer de les Carolines. An der Stelle der linken unteren Fenster, befand sich früher der Haupteingang. Der Garten erstreckte sich ursprünglich bis 1946 auch auf das links daneben liegende Grundstück. Der Verkauf mehrerer Parzellen führte zur Verkleinerung von 1738 qm auf 698 qm seit 1965. Ein Wasserfall und eine Kapelle der Heiligen Rita fielen der Verkleinerung zum Opfer.
Der Zaun aus Metall zeigt als Motiv die Form von Blättern der Fächerpalme.
Tribüne eines der Türme an der Ecke. Die pyramidenförmigen, handgefertigten Ornamente unterhalb der Überhänge, erinnern an die Muqarnas der maurischen Architektur.
Oberer Teil der Fassade. Oberhalb der Balkone gibt es eine Galerie.
Detail eines oberen Balkons mit Gitter aus Metall und Fensterläden. Die gelben Blüten der ursprünlich auf dem Grundstück wachsenden Tagetes, werden auf den Fliesen abgebildet.
Gitter aus Metall vor Fenstern im Erdgeschoss.
Rechts Seite der Fassade an der Straße mit Turm, in der Form eines orientalischen Pavillons.
Balkon und Fenstergitter auf der rechten Seite der Fassade.
Auf der Brüstung der Galerie sitzen Kinderfiguren, die von Antoni Riba i Garcia (1859-1932) geschaffen wurden. Er war auch an der Dekoration der Sagrada Familie beteiligt.
Der Eingang zum Haus befindet sich heute auf der Gartenseite. Hier die nordwestliche Fassade.
Inneres:
Jede der 4 Etagen im Haus wurde einer bestimmten Funktion zugeordnet. Im Erdgeschoss befinden sich die öffentlich genutzten Räume. Hier im Foyer eine Lampe aus Schmiedeeisen und Glas, die aus der Zeit nach Gaudí stammt. Sie ahmt den Stil orientalischer Lampen nach. Decke mit verzierten Deckenbalken, die Wände sind mit Sgraffito mit floralen Motiven verziert.
Speisesaal: der 32 qm große zentrale Raum im Erdgeschoss, mit einem Kamin, der mit Relieffliesen verziert ist. Decken und Wände sind mit zahllosen naturalistischen Motiven verziert. Gemälde mit Landschaften schmücken die Wände und sind umgeben von Möbeln, die unter Gaudís Aufsicht gebaut wurden.
34 Gemälde schmücken den Speisesaal. Die Efeublätter sind mit der Sgraffito-Technik gebildet worden.
An den Ausgängen zur Galerie insgesamt Wandmalereien mit Vögeln und scheinbar umherfliegenden Blättern.
Zentrales Gemälde von Francesc Torrescassana i Sellarés (1845-1918) „La llegada del pescado“ mit eines Szene mit Fischern an der katalanischen Küste. Über der Tür eine liegende Plastik aus Terrakotta. Nelkenblüten dekorieren die Kragsteine, die die Deckenbalken tragen.
Zwischen den Deckenbalken aus Pappmaché gefertigte und lackierte Reliefs mit Olivenblättern.
Kamin am Durchgang zur Galerie und die in Cuerda-seca-Technik angefertigten Fliesen, einer von den Mauren im mittelalterlichen Spanien entwickelte Technik.
Galerie: geschützt durch japanische Faltgitter. In der Mitte ein Springbrunnen aus Marmor mit einem Spinnennetz aus Eisen, welches bei Kontakt mit Wasser in allen Regenbogenfarben schillert.
An der Decke Sgraffito mit Ornamenten und floralen Motiven.
Blick in den Übergang zur mit Palmwedeln bemalten Kuppel.
Raucherzimmer: 10 qm groß und dem Speisesaal benachbart. Dieser ungewöhnliche Raum ist vielleicht von der Alhambra inspiriert, die gerade in jenen Jahren nach langer Zeit des Vergessens wieder entdeckt wurde. Der Einfluss der nasridischen Kultur zeigt sich vor allem an der Muqarnas-Decke, die aus Gipsstücken mit Reliefs von Palmblättern und Datteln besteht. Fliesen mit Reliefs von Pflanzen im oberen Teil der Wände, sind aus Pappmaché angefertigt.
Direkt vorgelagert ist ein kleiner Balkon mit ins Geländer eingearbeiteten Sitzbänken.
1. Etage mit den Privaträumen der Familie Vicens. Die Gestaltung ist nüchterner, aber überall begegnen uns wieder Pflanzenmotive.
In der westlichsten Ecke des Hauses, direkt über dem Raucherzimmer ein kleiner Salon mit einem Deckengemälde. Es zeigt einen perspektivischen Blick in einem Turm mit Vögeln und Pflanzen.
Blick in den kleinen Balkon des Salons.
Mehrere Schlafzimmer befinden sich auf dieser Etage. Alle sind mit Sgraffito-Technik mit Pflanzenmotiven verziert.
Blick in das 34 qm große Hauptschlafzimmer, welches ursprünglich mit einer Wand in zwei Bereiche unterteilt war. Daher unterscheiden sich auch die Dekorationen an den Wänden. Mal Farne, mal Schilf.
Auf der Terrasse über der Galerie im Erdgeschoss ein mit Fliesen verzierter Pflanzbereich mit Palme.
Decke und bemalte Kragsteine im Ankleidezimmer.
6 qm großes Badezimmer mit angrenzender Toilette. Es gab hier fließendes Wasser, was Ende des 19. Jahrhunderts außergewöhnlich war.
2. Etage mit einer Ausstellung:
Jardinière (Blumenbehälter im 19. Jahrhundert) aus Keramik, die auf einem schmiedeeisernen Ständer steht. Der große Topf ist mit Pflanzenmotiven, 2 Faunköpfen und einer darum drapierten Blumengirlande.
Eckschrank aus Holz von Antoni Gaudí.
Hängender Eckschrank von 1880, den Gaudí für die Frau von Manel Vicens, Dolors Giralt entworfen hat. Außen sind die Initialen D und G angebracht. Außerdem florale Motive aus goldfarbenem Messing und Vögel aus geschnitztem Holz.
Modell der Casa Vicens.
Dachgeschoss: Das Dach hat eine Fläche von 150 qm, wovon 85 qm zum ursprünglichen, von Gaudí entworfenen Haus gehören und der Rest zur Erweiterung von Joan Baptista Serra de Martínez (1888-1962) gehören. Das ursprüngliche Dach verfügt über vier Dachschrägen, die mit Ziegeln bedeckt sind. Ein Gehweg führt zum kleinen Vavillon an der Ecke. Der von Serra erbaute Bereich hat eine Terrasse mit Stufen, die zu dem anderen kleinen Pavillon in der gegenüberliegenden Ecke führt. Diese kleinen Pavillons von Serra, sind eine exakte Kopie von Gaudís Original. Mit Fliesen dekoriert, tragen sie über einer Kuppe eine kleine Flamme aus Bronze. Auch die Schornsteine sind mit Fliesen verkleidet.
Wohnhaus in der Nähe des Parc Güell. - Parc Güell: angelegt 1900-1914 von Antoni Gaudí (1852-1926). Seit 1984 gehört der Park Güell neben weiteren Werken Gaudís zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Der Standort war ein felsiger Hügel mit wenig Vegetation und wenigen Bäumen, genannt Muntanya Pelada. Es umfasste bereits ein großes Landhaus namens Larrard House oder Muntaner de Dalt House und lag neben einem Viertel mit Häusern der Oberschicht namens La Salut. Ursprünglich sollte hier eine für die Zeit wegweisende Gartenstadt im Auftrag des Industriellen Eusebi Güell (1846-1918) entstehen. Größe 17,18 Hektar. Beeindruckt von englischen Gartenanlagen, wollte Güell so etwas auch in Barcelona realisieren. 60 Villen sollten hier entstehen, finzanziert durch den vorherigen Verkauf. Das Projekt scheiterte und nur 2 Parzellen wurden verkauft, so dass der Park wegen fehlender Mittel nicht fertiggestellt werden konnte. Es wurden nur drei Häuser gebaut: das Wohnhaus der Familie Güell (das ehemalige Landhaus), heute eine Schule, das Wohnhaus eines Rechtsanwaltes, welches noch heute bewohnt ist und das Wohnhaus Gaudís, seit 1963 als Casa-Museu Gaudí ein Museum. Hier lebte der von 1906 bis 1925, ein Jahr vor seinem Tod.
Gaudí achtete bei der Anlage des Parks nicht nur auf umweltgerechtes, sondern auch auf kostengünstiges Bauen: Er verzichtete auf große Erdbewegungen und passte seine Pläne dem hügeligen Terrain an. Dabei verwendete er Stützmauern und Terrassen. Diese fügen sich durch ihre organischen Formen einzigartig ins Gelände ein und vermitteln den Eindruck absoluter Natürlichkeit. Die benötigten Materialien fand der Baumeister auf dem Gelände selbst. Für die vielen Mosaike verwendete er Abfälle der nahen Keramikfabriken. Allerdings war die Bauweise selbst sehr teuer, da alles in Handarbeit angefertigt werden musste.
An der Außenmauer des Parks viele Mosaiken aus Scherben von Fliesen mit dem Namen des Parks.
Links vom eigentlichen Eingang ein Bürogebäude mit hohem Turm und pilzartigem Aufbau auf dem Dach, verziert mit Mosaiken.
In der Mitte der ehemalige Eingang, der heute Ausgang ist. Dahinter oben die große Terrasse über einer Säulenhalle. Davor eine Freitreppe, die Escala i Drac. Vorne ein kunstvoller Zaun aus Metall, in der Form von Blättern der Fächerpalme, wie man ihn bei einigen Bauten von Gaudí sehen kann.
Rechts das Pförtnerhaus mit einem fliegenpilz-artigem Aufsatz auf dem Dach.
Der heutige Eingang.
Plan des Parc Güell: links von der Mitte die Casa Larrard (Nr. 10), Casa Trias (Nr. 16), Casa Museu Gaudí (Nr. 7) – die 3 einzigen Gebäude im Parc Güell. Unten das Pförtnerhaus und das Bürogebäude (Nr. 1 + 2), rechts daneben der heutige Eingang. Hier steht der Plan.
Unterhalb des Viaducts ist ein Tor aus Metall und ein Weg zur Casa Museu Gaudi.
Oben stehen auf dem Viaduct de Dalt stehen hohe Töpfe, die mit Agaven bepflanzt sind, mit kleinen runden Bänken dazwischen.
Weg zur Casa Museu Gaudi.
Viaduct de Dalt: Im oberen Viaduct befinden sich 3 Säulenreihen, die Gewölbe mit Rippen tragen, die eine sechseckige Form ergeben. Es war als Ruheplatz mit Steinbänken im Porticus geplant.
Direkt unterhalb liegt die Casa Museu Gaudi. Eine Modellwohnung, entworfen von Francesc Berenguer i Mestres (1866-1914) und durch Antoni Gaudí und seine Familie gekauft. Er wohnte fast 20 Jahre in seinem eigens entworfenen Stadtpark Güell. Heute ist in dem haus ein Museum.
Blick auf Barcelona, den Hafen und die Altstadt mit dem gotischen Viertel.
Torre Glòries oder Torre Agbar, ein 32-stöckiger Bürokomplex. Das Hochhaus aus Beton hat eine Glas-Aluminium-Fassade. Mit einer Höhe von 142 Metern gehört es zu den höchsten Gebäuden Kataloniens. Der Bauherr des Gebäudes, sind die Wasserwerke von Barcelona, daher auch die schillernde und farbenfrohe Gestaltung des Hochhauses. Architekt ist der Franzose Jean Nouvel (1945-).
Eine Mauer aus Natursteinen stützt den Hang ab. Darauf Zacken aus Backsteinen.
Casa Trias: das weiße Wohnhaus von Rechtsanwalt Martí Trias i Domènech, wurde entworfen von Juli Batllevel, einem mit Gaudí befreundeten Architekten. Der Anwalt war der erste, der ein Stück Land kaufte und es bebaute. Viele sollten seinem Vorbild folgen, doch leider geschah das nicht. Man kann die Wohnung nicht besichtigen.
Blüten der Gelben Klettertrompete (Campsis radicans)
Blick über die Stadt Richtung Hafen und der Baustelle der Sagrada Familie
Blick auf die Baustelle der Sagrada Familia
Myrtenblättrige Kreuzblume (Polygala myrtifolia).
Wege durch dichte Vegetation nach unten Richtung großer Terrasse, die von Gaudí auch „griechisches Theater“ genannt wurde. Hier am Hang sollten ursprünlich die 60 Villen entstehen. Von ihnen hätte man, wie von Rängen auf das griechische Theater herunterschauen können.
Mönchssittiche (Myiopsitta monachus) in Bäumen und Palmen.
Blick auf die über der Säulenhalle liegenden Terrasse.
Madeira-Natternkopf (Echium candicans)
Detail der Blüten.
Blick auf das Wohhaus eines mit Gaudí befreundeten Architekten.
Blick auf die nach unten und oben führenden Wege, die Gaudí nach den Vorgaben der Natur gestaltet hat. Er hat die Hügel nicht eingeebnet, sondern mit schrägen Stützmauern und Pfeilern Höhlenwege, zum Teil mit künstlichen Tropfsteinen geschaffen.
Blick auf die große Terrasse, die sich auf dem Dach der Säulenhalle befindet. Es ist der zentrale Teil der gesamten Anlage und 86 x 40 Meter groß.
Rechts unterhalb der Terrasse die Casa Larrard, ein ehemaliges umgebautes Landhaus, welches einige Zeit das Wohnhaus der Familie Güell war. Eusebi Güell starb 1918 und 1922 wurde das Anwesen an die Stadtverwaltung von Barcelona verkauft . Der Architekt Josep Goday i Casals (1881-1936) erweiterte den Komplex und verwandelte ihn in eine öffentliche Schule, die während der Weltausstellung 1929 eingeweiht wurde und heute den Namen Schule Baldiri Reixac bzw. Escuela Baldiri Reixac trägt.
Von der Terrasse hat man einen weiten Blick über die Stadt. Im Hintergrund die Baustelle der Sagrada Familia.
Beim ehemaligen Eingang und jetzigen Ausgang stehen links das Pförtnerhaus mit fliegenpilz-artigem Aufbau und rechts ein Bürogebäude mit kleinem Turm. Beide Gebäude mit markanten „Zuckergussdächern“.
Die Umfassungsmauer der Terrasse wurde durch eine wellenförmige Sitzbank mit zahlreichen Mosaiken aus Fliesenscherben gestaltet.
Zahlreiche Details der Sitzbank mit den äußeren und innen liegenden Mosaiken.
Neben der Säulenhalle noch einmal die Escuela Baldiri Reixac.
Säulenhalle mit 86 dorischen Säulen. Die äußeren Säulen sind stark nach innen geneigt, um den Schub des Deckengewölbes aufzufangen. Zwischen den Säulen zahlreiche keramische und gläserne Mosaiken von Josep Maria Jujol i Gibert (1879-1949) an der Decke.
Sitznische unterhalb der Säulenhalle.
Vom Terrassenplatz führt eine große Freitreppe nach unten. In der Mitte ein Drache mit bunten Kachelplättchen. Er stellt den Wächter der unterirdischen Gewässer Python dar. Hinter ihm befindet sich eine Zisterne, die bis zu 12.000 Liter Wasser fassen kann und als Sammelbecken für Regenwasser gedacht ist.
Überall an den stützenden Mauern weitere Mosaike aus zerbrochenen Fliesen, die hier wieder verwendet wurden.
Den Eingang des Parks – heute ist es der Ausgang – bilden ein Pförtnerhaus mit fliegenpilz-artigem Aufbau, sowie ein Bürogebäude, beide mit markanten „Zuckergussdächern“.
Mönchssittich (Myiopsitta monachus) in einem blühenden Baum beim Parc Güell.
Marktstände anlässlich des „Dia de Sant Jordi“, dem Georgstag. Am 24. April (in manchen Gegenden auch der 23. April) wird es in Barcelona mit Umzügen, Buchständen und zahlreichen Verkaufsständen mit Rosen gefeiert. Der heilige Georg, der Schutzpatron Kataloniens, vertreibt den „Drachen Winter“. Die bekannte Legende vom Drachentöter, der das Volk und eine Prinzessin vom Drachen befreit – aus dem toten Ungeheuer erblühen rote Rosen, von denen der heilige Georg eine der Prinzessin schenkt. In Katalonien ist er auch der Schutzheilige der Verliebten und in Anlehnung an eine alte katalanische Tradition ist der Georgstag seit 1995 auch „Welttag des Buches“. - Plaça d’Espanya: wichtigster Verkehrsknotenpunkt im Westen der Stadt. Hier schneiden sich die breite, das gesamte Stadtgebiet durchquerende Gran Via de les Corts Catalanes und die am Fuß des Montjuïc entlanglaufende Avinguda de la Paral-lel.
An der Südostseite des Platzes stehen zwei Türme, die dem Campanile der Kirche San Marco in Venedig nachgebildet sind. Sie bilden den Eingang zum dahinter liegenden Messegelände Fira de Barcelona.
Flankiert werden sie von von weißen Kolonnaden, die verglast sind.
In der Mitte des runden Platzes das als Brunnen gestaltete Denkmal „España Ofrecida a Dios“ oder „Das gottgeweihte Spanien“.
In der Sichtachse hinter den Türmen und den Gebäuden des Messegeländes die Kuppel, Türme und Fassades des Palau Nacional. Er wurde auf dem Hügel des Montjuïc als Hauptgebäude der Internationalen Ausstellung von 1929 errichtet. Er wurde von Eugenio Cendoya (1894-1975) und Enric Catà i Catà (1878-1937) unter der Leitung von Pere Domènech i Roura (1881-1962) entworfen. Seit 1934 beherbergt es das Nationale Kunstmuseum Kataloniens.
Fassade eines Mietshauses aus Backsteinen mit zahlreichen Balkonen.
Fassade eines Mietshauses mit zahlreichen Balkonen.
Flughafen Barcelona. - Rückflug mit der spanischen Fluggesellschaft Vueling.
Luftaufnahmen: Start vom Flughafen Barcelona. In Hintergrund die Stadt Barcelona und Richtung Norden der 532 m hohe Berg Tibidao.
Blick auf den Strand und die kleines Seen am Ufer des Mittelmeeres.
Kleines Hotel mit Swimmingpool und Tennisplätzen am Ufer des Mittelmeeres.
Delta del Llobregat, Mündung in das Mittelmeer.
Blick auf Barcelona und seinen großen Hafen. Im Hintergrund die Pyrenäen.
Barcelona und sein Hinterland. Links an der Küste der Flughafen, rechts der Hafen.
Blick auf die Mündung des Flusses El Llobregat, zwischen Flughafen und der Stadt.
Barcelona mit Hafen.
Barcelona
30 km nördliche von Barcelona die Stadt Mataró mit vorgelagertem kleinen Hafen.
115 km nordöstlich von Barcelona liegt die Stadt Sant Feliu de Guíxols. Sie ist umgeben von Hügeln und felsigem Küstengebirge. Die natürlichen Grenzen durch die Steilküste führten dazu, dass sich die Stadt sehr stark ins Landesinnere in Form eines spitzwinkligen Dreiecks ausbreitete.
Kurz vor der französischen Grenze die Stadt Palamós. Sie liegt in einer Ebene am Fuße des Küstengebirges Massis de les Gavarres.
Das ehemalige kleine Fischerdorf und heutige Ferienort L’Estartit an der Costa Brave. Vorgelagert ist die Insel Medes. L’Estartit befindet sich am Übergang von einer felsigen Steilküste zu einem zehn Kilometer langen, feinen Sandstrand in der Tiefebene des Flusses Ter.
Weiter Richtung Norden der große Golf des Roses.
Jetzt über Südfrankreich mit dem Étang de Berre westlich von Marseille.
Der Stadt Marseille vorgelagert, die Inseln Les Îles. Die ganz leine Insel rechts ist die berühmte Festungs- und Gefängnisinsel Chateau d’If.
Landzunge Calanque de Callelongue
Oben Marseille, unten in der Bucht Cassis mit dem Nationalpark Calanque.
Marseille, Cassis und sein Hinterland.
La Ciotat und Saint-Cyr-sur-Mer
Circuit Paul Ricard oder Circuit du Castellet. Es ist eine 1970 fertiggestellte Motorsport-Rennstrecke, in der Nähe des Ortes Le Castellet im Département Var.
Bergkette Jouc de l’aigle.
Weitere Landschaften, Orte und Felder im Département Var.
Lac de Saint-Cassien
Der Fluss Var bei der Stadt Gattières
Die schneebedeckten französischen Alpen.
Ort am Rand von schneebedeckten Bergen
Blühende Rapsfelder in Deutschland.
Südlich von Berlin die Halle vom Tropical Island.
Mehrere Seen südlich von Berlin.
Landeanflug auf den Flughafen Berlin Brandenburg. Zahlreiche Seen, Flüsse, Orte.
Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.