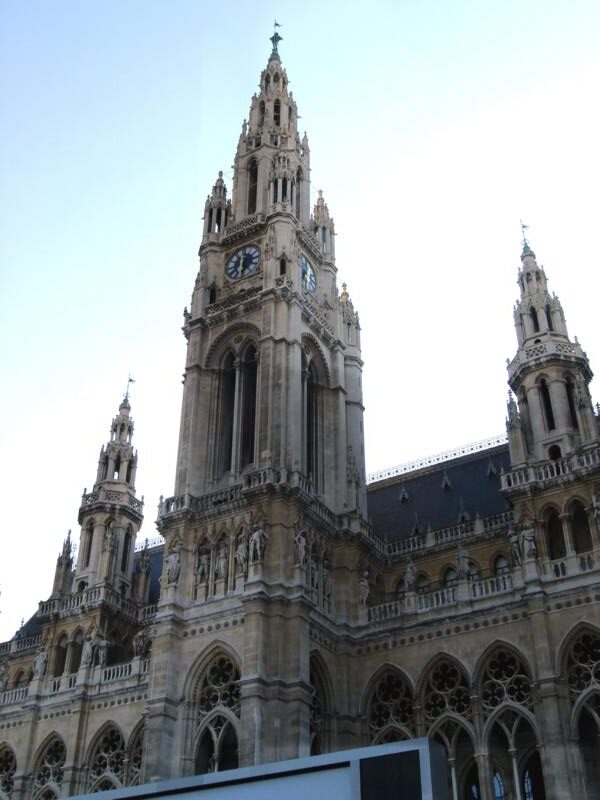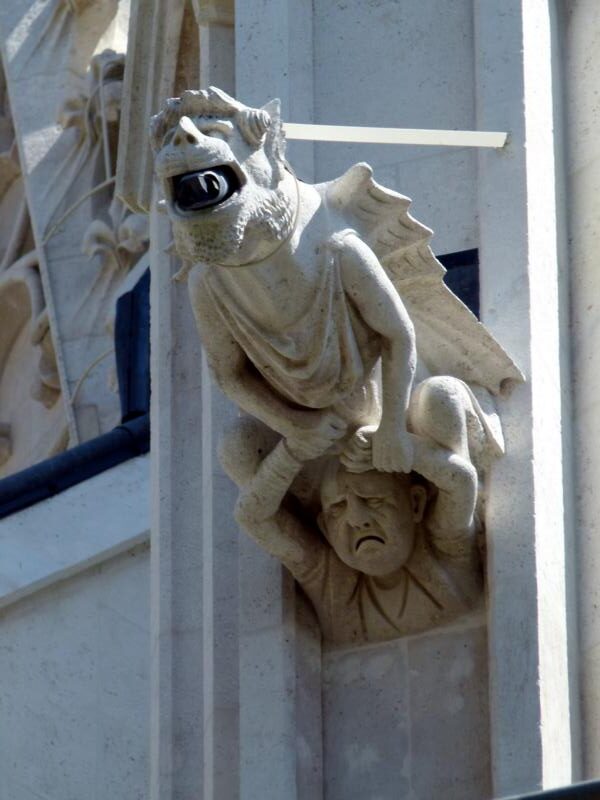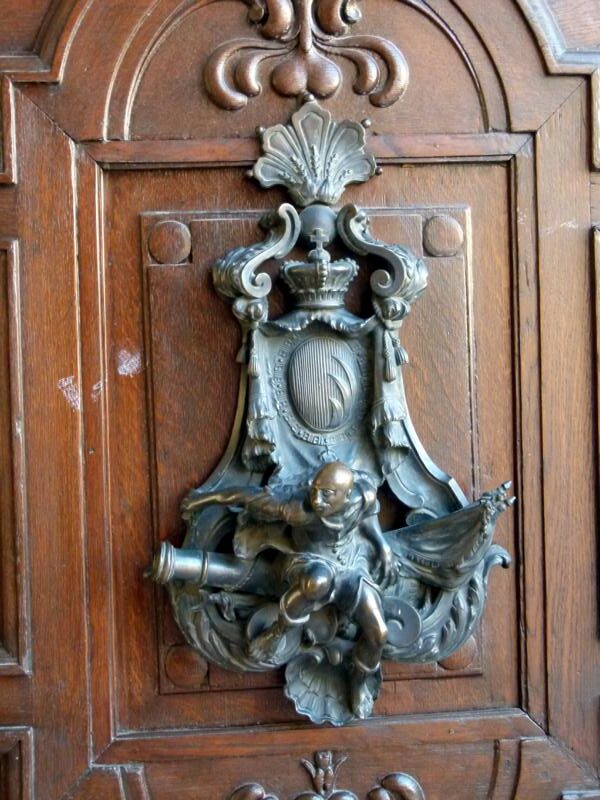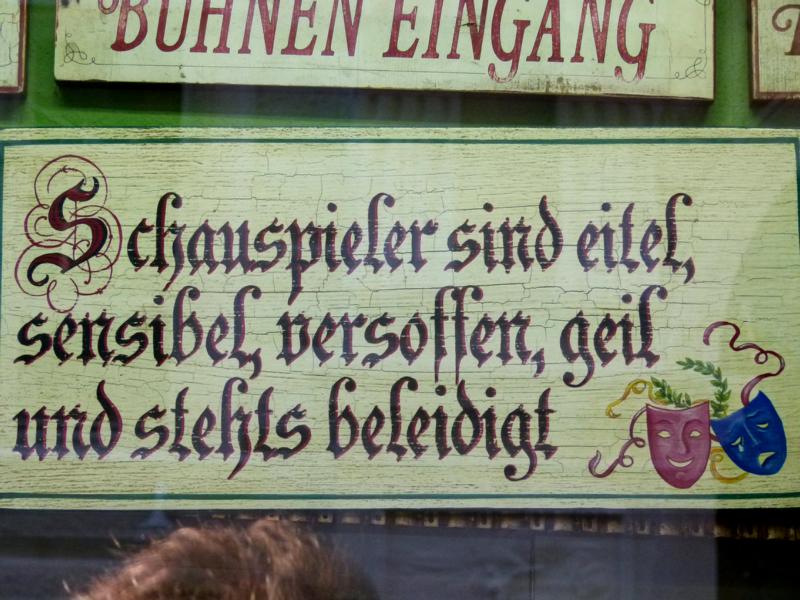Ausführlicher Reisebericht mit Text und allen Bildern.
Altes Rathaus
Augustinerkirche
Ausstellungsgebäude der Wiener Sezession
Belvedere
Donaukanal und Donau Rundfahrt per Schiff
Historische Musikinstrumente im Musikvereinsgebäude
Hofburg
Hofsilber- und Tafelkammer
Kaiserappartments, Sisi-Museum
Kaiserliche Schatzkammer
Kapuzinergruft
Karlskirche
Kunsthistorisches Museum
Michaelerkirche
Minoritenkirche
Musikvereinsgebäude
Naschmarkt
Neue Burg, Heldenplatz
Neues Rathaus
Neustädter Altar
Oberes Belvedere
Österreichische Mediathek
Österreichische Nationalbibliothek, Prunksaal
Palais Ferstel
Palais Kinsky
Parlament, Pallas-Athene-Brunnen
Peterskirche
Prater
Schloss Schönbrunn
Gloriette
Schloss Schönbrunn Inneres
Schlosstheater
Schmetterlingshaus an der Hofburg
Schottenkirche
Stephansdom
Unteres Belvedere
Goldkabinett
Volksgarten
Votivkirche
Wienbibliothek Musiksammlung
Walk of Fame
Sie können dieses Set vollständig oder in Teilen von mir erhalten. Kontaktieren Sie mich bei Interesse bitte über dieses Formular
Wien 27.07.- 07.08.2013
Wien: Erste urkundliche Erwähnung Wiens als „Wenia“ 881, aber bereits in der Altsteinzeit war das Wiener Becken kontinuierlich besiedelt. Im 1. Jahrhundert legten hier die Römer eine Stadt mit Namen „Vidobona“ an. Bereits im 11. Jahrhundert war Wien ein wichtiger Handelsort. Heinrich II. oder Heinrich Jasomirgott (1107-1177) aus dem Geschlecht der Babenberger, machte Wien 1155 zu seiner Hauptstadt. Kurz danach wurde Österreich zum Herzogtum erhoben und damit war Wien Residenzstadt. Nach Beendigung des 3. Kreuzzuges wurde der englische König Richard Löwenherz (1157-1199) bei seiner Rückreise nach England von Markgraf Leopold V. (1157-1194) 1192 in Erdberg bei Wien gefangen genommen und in Dürnstein gefangen gehalten. Ab 12. Jahrhundert erste kulturelle Blüte. Mit dem Sieg 1278 von Rudolf I. (1218-1291) über Ottokar II. Přemyslvon Böhmen (ca. 1232-1278) begann die Herrschaft der Habsburger in Österreich. Architektonisch ist Wien bis heute vor allem von den Bauwerken aus der Gründerzeit, aber auch vom Barock und Jugendstil (dem sogenannten Wiener Secessionsstil) geprägt. 1804-1867 war es die Kaiserliche Reichshaupt- und Residenzstadt und wurde zum kulturellen und politischen Zentrum in Europa. 1814/15 fand hier der Wiener Kongress statt, der nach der Niederlage Napoleons die Europäischen Grenzen neu festlegte. Noch 1910 war es die Hauptstadt der Habsburgermonarchie. Zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt heute die Altstadt von Wien, aber auch Schloss Schönbrunn. Die Hauptstadt Österreichs liegt an der Donau und ist mit fast 2 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in Österreich.
-
Luftbilder vom Flug ab Berlin und Landung.
-
Summerstage mit Bars, Restaurants und beleuchteter Kunst am Ufer des Donaukanals bzw. der Kleinen Donau. Im Mittelalter befand sich hier der Hauptarm der Donau.
-
Staatsoper an der Ringstraße, Herbert-von-Karajan-Platz. Gehört zu den größten und prächtigsten Musiktheatern der Welt. 1861-1869 nach Plänen von August Siccard von Siccardsburg (1813-1868) und Eduard van der Nüll (1812-1868) im Stil der Neorenaissance erbaut. 1869 mit Mozarts Don Giovanni eröffnet. Berühmte Dirigenten wie Gustav Mahler, Richard Strauss, Herbert von Karajan oder Karl Böhm arbeiteten hier.
-
Detail eines Balkons aus Metall.
-
Goethedenkmal am Opernring aus Bronze von Edmund von Hellmer (1850-1935), 1900 enthüllt. Auf einem Podest aus Granit sitzt Goethe auf einem Sessel.
-
Andenken, Magnete mit Motiven von Wien.
-
Kunsthistorisches Museum: kurz KHM, 1891 an der Ringstraße eröffnet. Direkt gegenüber das Naturhistorische Museum als Zwillingsbau. Beide Museen gehören zu den wichtigsten Großgebäuden an der Ringstraße. Beide Gebäude flankieren den Maria-Theresien-Platz. Auftraggeber des Baus war Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916). Er hatte sich 1857 zum Abriss der Stadtmauer entschieden, im Kontext mit der geplanten Stadterweiterung. 1872 von Gottfried Semper (1803-1879) und Carl von Hasenauer (1833-1894) für die kaiserlichen Sammlungen entworfen und bis 1881 fertiggestellt (Neorenaissance). Der Grundstock der Museumsbestände besteht aus den Sammlungen der Habsburger.
-
Naturhistorisches Museum: kurz NHM, von der Ringstraße aus rechts, von den gleichen Architekten, 1889 eröffnet. Es enthält 30 Millionen Sammlungsobjekte.
-
Maria-Theresien-Platz mit imposanten Denkmal von Kaspar von Zumbusch (1830-1915) von 1887. Er arbeitete mit seinem Schüler Anton Brenek 13 Jahre an der Herstellung der Bronzefiguren. Auftragsarbeit von Franz Joseph I. Das Denkmal ist fast 20 m hoch und bedeckt eine Fläche von 632 qm. Es erinnert an die Gattin von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen (1708-1765). Sie regierte die Habsburgermonarchie von 1740-1780. Auf den 4 Seiten des Sockels befindet sich je ein Bogenfeld mit Reliefs, davor jeweils thematisch passend eine Statue.
Um das Denkmal ein Garten, gestaltet wie ein barockes Gartenparterre. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Ringstraße liegt die Wiener Hofburg.
Detail einer Seite mit den Beratern der Kaiserin, repräsentiert von Wenzel Anton Kaunitz als Statue. Im Relief dann Johann Christoph von Bartenstein, Gundaker Thomas Graf Starhemberg und Florimond Claude von Mercy-Argenteau. Im Hintergrund die Gloriette von Schloss Schönbrunn.
Detail: zu Füßen der Kaiserin die Verkörperungen der Kardinaltugenden. -
Museumsquartier Wien: Grundlage sind die ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen. Plan der Anlage.
Betritt man den Innenhof befindet sich rechts das Museum für moderne Kunst Stiftung Ludwig (mumok). Die Fassade ist mit anthrazitfarbiger Basaltlava verkleidet.
In der Mitte die Veranstaltungshallen vom Tanzquartier Wien. -
Kunsthistorisches Museum:
Birgt eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt.
Rechts vom Eingang empfängt die Personifikation der Bildhauerei von Johannes Benk -(1844-1914). Das Sklupturenprogramm des ganzen Baus stammt von Gottfried Semper (1803-1879) selbst.
Darüber „Eros und Psyche“ auch von Johannes Benk. Darüber der Kopf von Lorenzo de Medici von Victor Oskar Tilgner (1844-1896).
Der Fußboden im Vestibül unter der Kuppel aus Carrara-Marmor und schwarzem belgischen Devonkalk.
Blick in die Kuppel mit Portraitköpfen von Cellini, Raffael, Michelangelo und Bramante. Die Namen stehen auf den roten Marmorplatten.
Blick durch den Okulus in die darüber liegende Kuppelhalle.
Rechts und links der zum Treppenhaus führenden Mittelachse des Vestibüls gelangt man über einige Stufen und durch Ädikulaportale in die höher gelegenen Sammlungsräume des Hochparterre. Canovas Theseusgruppe am Wendepodest der Treppenanlage markiert einen Höhepunkt der Rauminszenierung. Darüber das Stiegenhaus in prachtvoller Farbigkeit und opulentem Formen- und Bilderreichtum.Theseusgruppe am Wendepodest von Antonio Canova (1757-1822).
Eingang zur Kunstkammer: Sie ist den Kunst- und Wunderkammern des späten Mittelalters, der Renaissance- und Barockzeit nachempfunden und geht vor allem auf die früheren Sammlungen der Habsburger zurück.
Kleiner Hausaltar ? aus Elfenbein?
Blick in das bemalte Gewölbe eines der Ausstellungsräume.
Donatello (1386-1466): Madonna mit Kind, ca. 1443, umgeben von ehemals teilweise vergoldetem Marmor.
Jörg Syrlin der Ältere (1425-1491) oder Michel Erhart (ca. 1440-1522): Allegorie der Vergänglichkeit „Vanitas“. Lindenholz mit alter Farbfassung.
Bemalte Terrakotta
Margarete von Österreich (1480-1530). Einzige Tochter von Maximilian I. und Maria von Burgund. Statthalterin der habsburgischen Niederlande und Tante von Kaiser Karl V.
Altarflügel, wie ein Comic gestaltet.4 Brunnenfiguren von Johann Gregor von der Schardt (1530-1591) aus vergoldeter Bronze. Vorne Vulkan, dann Flora. Die Kapitelle auf dem Kopf weisen sie als Trägerfiguren aus. Sie dienten ursprünglich als Stützen für einen Prachtbrunnen, der für Kaiser Maximilian II. angefertigt wurde.
Francois Cluet (1510-1572): König Karl IX. von Frankreich, 1569.Erzengel Michael besiegt den Satan. Detail vom Deckel des sog. Michaelspokals. 1532. Stammt aus dem Schatz der Könige von Frankreich. Geschenk an die Habsburger anlässlich der Hochzeit von Karl IX (Sohn von Katharina Medici) und der österreichischen Erzherzogin Elisabeth.
Auf dem gleichen Weg gelangte auch die „Saliera“ von Benvenuto Cellini (1500-1571) in den Besitz der Habsburger. 1540-43. Es ist die einzige erhaltene Goldschmiedearbeit von Cellini. Er schuf sein Werk für den französischen König Franz I. Allegorische Darstellung der Welt. Elemente Wasser und Erde sitzen sich gegenüber. Die römische Göttin der Erde „Tellus“ sitzt auf einem Elefanten und zu ihren Füßen ist ein Salamander. Er steht für das Element Feuer und ist gleichzeitig das Wappentier von Franz I. In dem aufklappbaren Tempelchen konnte Pfeffer aufbewahrt werden, in der Schale neben Neptun Salz.
Saal in dem Säulen ein Gewölbe mit Kassetten aus Stuck und Bemalung stützen.
Kabinettschrank, 1560/70, vormals Wenzel Jamnitzer (gest. 1585) zugeschrieben. Auf den Reliefs Darstellungen der Tugenden und Laster.
Vitrine mit Pokalen, ca. Ende des 16. Jahrhunderts.
Tischautomat in Form eines Schiffes von Hans Schlottheim (1545/46-1625). Augsburg, 1585. Das Schiff kann als festliche Tischdekoration zur Unterhaltung der Gäste über den Tisch rollen, dazu ertönt Musik. Zwei der Kanonen können mit Schwarzpulver befüllt werden und schießen als Höhepunkt am Ende eine Salve ab.
Büste von König Philipp II von Spanien, um 1580 von Pompeo Leoni (1533-1608).
Becken der Trionfi-Lavabo, 1601 von Christoph Jamnitzer (1563-1618). Triumphzug Amors. Die Liebe triumphiert über die weltliche Macht. Im Vordergrund die gefesselten Figuren von Julius Caesar und Herkules.
Wappendecke „Kaiserreich Österreich“. Im Zentrum der doppelköpfige Habsburger Adler, drumherum Wappen anderer Provinzen.
Albrecht Dürer (1471-1528): Maximilian I., der „letzte Ritter“, 1519
Brettspiel aus dem Besitz von Kaiser Ferdinand I. von Hans Kels d. Ä. 1537.
Tizian bzw. Tiziano Vecellio (1477-1576): Isabella d’Este 1535
Rosenkranz-Anhänger mit dem Leidensweg Christi, eine sogenannte Betnuss. Anfang 16. Jahrhundert.
Kästchen mit Schnitzereien aus Elfenbein oder Holz.
Miniaturbuch aus Metall
Heiliger Gregor mit Schreibern, Elfenbein, spätes 10. Jahrhundert.
Blick in den Innenhof mit Sgraffiti (=Kratzputz – verschiedenfarbige Putzschichten) von Ferdinand Julius Laufberger (1829-1881). 38 Personifikationen der Künste und Gewerbe.
Treppenhaus:
Mitte des Jahres 1881 wurde Hans Makart (1840-1884) mit der Ausstattung des großen Treppenhauses beauftragt. Durch seinen frühen Tod konnten nur einige Lünettenbilder an den Wänden fertiggestellt werden. Die Maler-Vereinigung in denen sich die Brüder Gustav Klimt (1862-1918) und Ernst Klimt (1864-1892), sowie Franz von Matsch (1861-1942) zusammengeschlossen hatten, erhielten 1890 den Auftrag für die weiteren Gemälde in den Zwickeln und an den Wänden über den Bögen der Durchgänge.
Blick auf das Wendepodest mit Canovas Theseusgruppe und 2 Wappenschilde haltende Löwen.Deckengemälde von Mihály Munkácsy (1844-1900) „Apotheose der Renaissance“, 1890 vollendet. Ursprünglich hatte zwar Hans Makart den Auftrag erhalten, durch seinen frühen Tod erhielt dann der Ungar den Auftrag. Unten links unterhält sich Leonardo da Vinci mit Raffael. Rechts unten hinter der Balustrade Michelangelo in klassischer Denkerpose. In der Mitte am Ende der Treppe unterrichtet Tizian einen Schüler in Aktmalerei.
Zwickel- und Interkolumnienbilder: 6 Jahre nach Makarts Tod erging der Auftrag an die erwähnte Künstlervereinigung.
Detail: Franz von Matsch (1861-1942) „Römische Antike“ links und rechts die „Karolingische Zeit“.
Oben von Hans Makart die „Allegorie der religiösen und profanen Kunst“. Darunter links von Gustav Klimt (1862-1918) „Griechische Antike“ und rechts ebenfalls von Gustav Klimt „Ägypten“.
Links neben der „Griechischen Antike“ das Venetianische Quattrocento“ mit einem Profil des Dogen, ebenfalls von Gustav Klimt.
Die „Griechischen Antike“ wird durch Pallas Athene dargestellt.
Rechts neben „Ägypten“ von Gustav Klimt die „Altitalienische Kunst“. -
Gemäldegalerie: Ging aus den Kunstsammlungen des Hauses Habsburg hervor und zählt heute weltweit zu den größten und bedeutendsten ihrer Art.
Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Der verliebte Alte, um 1530/40
Jan Thomas bzw. Johannes Thomas (1617-1678) : Margarita Teresa von Spanien, 1. Frau von Leopold I. in einem Theaterkostüm. Tochter Philips IV. von Spanien. Velasques porträtierte sie in dem berühmten Gemälde „Las Meninas“ als süßes blondes Mädchen. Die junge Kaiserin war von strenger Frömmigkeit und veranlasste Leopold I. zur Vertreibung der Juden aus Wien, weil sie diesen die Schuld an ihren zahlreichen Fehlgeburten gab.
Jan Thomas bzw. Johannes Thomas (1617-1678): Kaiser Leopold I. in einem Theaterkostüm.
Hans Burgkmair der Ältere (1473-1531): Kaiser Friedrich III.
Hans Burgkmair der Ältere (1473-1531): Eleonora von Portugal, seine Frau. Der letzte Ritter Maximilian I. ist deren gemeinsames Kind.
Albrecht Dürer (1471-1528): Karl der Große mit Bügelkrone, ca. 1514
Albrecht Dürer (1471-1528): Kaiser Sigismund
Museumscafé in der Kuppelhalle: achteckiger Grundriss, eine Anspielung und inhaltliche Verknüpfung mit dem Aachener Dom. In den oberen Bogenzwickeln Genien und Fama-Figuren, in den unteren Bogenzwickeln Knabengestalten als Allegorien der einzelnen kunstgewerblichen Tätigkeiten. Darüber eine riesige Kuppel.
Details der Figuren.
Blick aus dem Fenster auf den Zwillingsbau des Naturhistorischen Museums und den Maria-Theresia-Platz.
Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun: Marie Antoinette, das jüngste Kind von Maria Theresia und Franz I. Stephan von Lothringen. Sie endet ebenso wie ihr Mann Ludwig XVI. auf dem Schafott.
Antoine-François Callet (1741-1823): König Ludwig XVI. von Frankreich im Krönungsornat. 1793 hingerichtet. Gemälde datiert 1781
Canaletto (1720-1780): Gartenseite von Schloss Schönbrunn. 1759/60
Canaletto (1720-1780): Schönbrunn von der Hofseite. 1758
Anton von Maron (1731-1808): Kaiserin Maria-Theresia in Witwentracht mit dem Plan von Schloss und Garten Schönbrunn. Nach dem Tode ihres Mannes (1765), legte sie diese bis zu ihrem Tode nicht mehr ab. 1773.
Canaletto (1720-1780): Wien vom Belvedere gesehen. 1758-61
Johann Zoffany (1733-1810): Franz I. Stephan von Lothringen, der Mann von Maria-Theresia in seinen naturhistorischen Sammlungen. 1776/77
Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787): Kaiser Joseph II. und Großherzog Pietro Leopoldo von Toskana (der spätere Kaiser Leopold II.), die beiden ältesten Söhne von Maria-Theresia.
Anton Raphael Mengs (1728-1779): Infantin Maria Ludovica, Tochter von Karl III. von Spanien, Gemahlin von Leopold II., um 1764/65Orazio Lomi Gentilesci (1563-1639): Detail des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht“, um 1622/28.
Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Isabella von Valois, Königin von Spanien. Um 1560. Älteste Tochter von Katharina Medici und Heinrich II. von Frankreich. 3. Ehefrau von König Philipp II. von Spanien.
Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Infant Don Carlos von Österreich, Sohn von König Philipp II. von Spanien und seiner 1. Ehefrau Maria Manuela von Portugal, datiert 1564.Alonso Sánchez Coello (1532-1588): Anna von Österreich, Königin von Spanien. 4. Ehefrau von Philipp II. und Tochter von Kaiser Maximilian II.
Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): König Philipp IV. von Spanien.
Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): Isabella von Spanien (eigentlich Elisabeth de Bourbon), 1632, 1. Ehefrau von König Philipp IV von Spanien, Tochter von Maria Medici und König Heinrich IV von Frankreich.
Juan de Miranda Carreño: Karl II. von Spanien, Sohn von König Philipp IV von Spanien und seiner 2. Ehefrau Maria Anna von Österreich. Er starb kinderlos und löste dadurch den spanischen Erbfolgekrieg aus. Es zeigten sich an ihm deutliche Anzeichen von Degeneration, die auf die jahrhundertelange Inzucht zwischen den Königshäusern zurückzuführen ist.
Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): Maria Theresia als Infantin von Spanien, 1652/53, einzig überlebendes Kind aus der 1. Ehe von Philipp IV. von Spanien. Sie heiratete später Ludwig XIV von Frankreich.
Diego Velázquez bzw. Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660): 2 x Margarita Theresa von Spanien, neben dem durch Inzucht kranken Karl II, einziges überlebendes Kind von König Philipp IV und seiner 2. Ehefrau Maria Anna von Österreich. Sie heiratete später ihren Onkel Kaiser Leopold I. Berühmt wurde sie durch ihr Kinderporträt „Las Meninas“ ebenfalls von Diego Velázquez.
Marcello Bacciarelli (1731-1818): Porträt von Maria Christina von Österreich, 1766, der Lieblingstochter von Maria-Theresia. Sie war das einzige Kind der Kaiserin, dass eine Liebes-Heirat eingehen durfte.
Tizian Schule: Papst Paul III. Farnese.
Tizian bzw. Tiziano Vicellio (1477-1576): Mädchen im Pelz um 1535.
Saal in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.
Paolo Veronese (1528-1588): Judith und Holofernes, ca. 1580
Tintoretto bzw. Jacopo Robusti (1518-1594): Susanna im Bade, 1555/56
Raffael (1483-1520): Madonna im Grünen, 1506, Dreieckskomposition.
Tizian bzw. Tiziano Vicellio (1477-1576): Kirschenmadonna, 1516/18.
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593): die vier Elemente, Gemäldeserie, 1566. Wasser + das Feuer
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593): die vier Jahreszeiten, Gemäldeserie, 1563, Winter + Sommer. Dargestellt in einem sogenannten Kompositkopf.
Saal mit Malerei der Italienischen Schulen in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.
Detail der Decke.
Hans von Aachen (1552-1615): Kaiser Rudolf II., ca. 1606/08, Rudolf war ein bedeutender Förderer von Kunst und Wissenschaft. Wichtige Teile seiner Sammlung sind in diesem Museum erhalten. Insgesamt war er aber schwacher Herrscher und zumindest in den letzten Jahren faktisch regierungsunfähig. Sohn von Kaiser Maximilian II. Er wurde durch seinen Bruder Matthias entmachtet.
Dirck de Quade van Ravesteyn (1565-1620): ruhende Venus, um 1608.
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Bauerntanz oder die Kirchweih, 1568
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Bauernhochzeit, um 1568
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Jäger im Schnee, 1565
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Massaker an den Unschuldigen oder der Bethlehemitische Kindermord, 1565/67
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Kinderspiele, 1560
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Kampf zwischen Karneval und Fasten, 1559
Pieter Bruegel de Oudere (1525-1569): Turmbau zu Babel, Wiener Fassung, 1563Jacob Cornelisz (1470-1533): Hieronymus-Retabel
Geertgen tot Sint Jans (1460-1495): Das Schicksal der irdischen Überreste des Hl. Johannes des Täufers, um 1484
Rogier van der Weyden (1390-1464): Kreuzigungstriptychon, um 1440
Juan de Flandes (1465-1519): Johanna die Wahnsinnige, Mutter von Kaiser Karl V., um 1496.
Juan de Flandes (1465-1519): Philipp der Schöne, um 1500, Ehemann von Johanna der Wahnsinnigen und Vater von Kaiser Karl V.
Porträt einer Unbekannten.
Joos van Cleve (1485-1540): Eleonore von Frankreich, um 1530, Tochter von Philipp dem Schönen und von Johanna der Wahnsinnigen. Schwester von Kaiser Karl V. Erst Königin von Portugal, später 2. Ehefrau des französischen Königs Franz I.Jan Bruegel de Oudere (1568-1625): Großer Blumenstrauß, 1606/06
Jan Vermeer van Delft (1632-1675): Der Maler in seinem Atelier, um 1666/68
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669): Portrait eines Mannes und einer Frau, 1632
Peter Paul Rubens (1577-1640): Philipp der Schöne. Lange Jahre hielt man es für ein Porträt von Kaiser Maximilian I., 1618.
Hans Holbein (1497-1543): Bildnis eines jungen Kaufmanns, ca. 1541.
Jakob Seisenegger (1505-1567): Kaiser Karl V. mit einer Ulmer Dogge, 1532.
Bernhard Strigel (1460/61-1528): Die Familie Kaiser Maximilians I., 1516. Rechts 1. Ehefrau Maria von Burgund. Dazwischen deren Sohn Philipp der Schöne. Vorne Maximilians Enkel Ferdinand I. (1503-1564) und Karl V. (1500-1558) und sein Schwiegerenkel Ludwig II. (1506-1526).
Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Vertreibung aus dem Paradies, 1530
Albrecht Dürer (1471-1528): Bildnis einer jungen Venezianerin, 1528.
Albrecht Dürer (1471-1528): Kaiser Maximilian I., 1519, der Kaiser als Privatmann dargestellt.
Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Adam und Eva, 1513/15
Lucas Cranach der Ältere (1472-1553): Die Prinzessinnen Sidonie, Aemilia und Sibylle von Sachsen, um 1535
Hans Holbein (1497-1543): Jane Seymor, 3. Frau von König Heinrich VIII. von England und Mutter des früh verstorbenen Thronfolgers Edward VI.
Detail eines Gemäldes.
Albrecht Dürer (1471-1528): Brustbild eines jungen Mannes, 1507.Peter Paul Rubens (1577-1640): Himmelfahrt Mariens, um 1616, ein von Rubens mehrfach gemaltes Motiv.
Peter Paul Rubens (1577-1640): das Pelzchen, um 1635/40, eine Venus mit dem Antlitz von Rubens Frau
Peter Paul Rubens (1577-1640): Selbstbildnis, um 1638/40
Camillo Pacetti (1758-1826): Büste Franz II., dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen und durch die Zerschlagung dieses Reiches durch Napoleon dann Franz I., der 1. Kaiser von Österreich.
Kaspar von Zumbusch (1830-1915): Büste von Kaiser Franz Joseph I. -
Das Palais Epstein. Es wurde im typischen Stil des Historismus an der Wiener Ringstraße errichtet und befindet sich auf dem Weg vom Kunsthistorischen Museum zum Parlament.
-
Denkmal der Republik. 1928 enthüllt, 10 Jahre nach der Proklamation der „Republik Deutschösterreich“. Es zeigt die Büsten von Jakob Reumann (1853-1925, Wiener Bürgermeister von 1919 bis 1923), Dr. Viktor Adler (1852-1918, zuletzt Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten) und Ferdinand Hanusch (1866-1923, Staatssekretär für Soziale Fürsorge von 1918 bis 1920).
-
Parlament: Theophil Edvard von Hansen (1813-1891) erbaute das Parlamentsgebäude 1873-1883 für die neu geschaffenen Reichs- und Landesvertretungen, die 1861 neu geschaffen wurden. Anspielend auf das Ursprungsland der Demokratie, Griechenland, wurden bei dem Bau klassisch-griechische Formen verwendet. Vor dem Portikus steht seit 1902 der Pallas-Athene-Brunnen. Links an der Auffahrt die Sitzfiguren von Herodot, Polybius, Thukydides und Xenophon. Im Hintergrund der Turm des Rathauses.
Neben dem Brunnen Rossebändiger aus Bronze, entworfen von Josef Lax (1851-1909).
Pallas-Athene-Brunnen (Göttin der Weisheit und des Krieges), hier war ursprünglich eine Personifikation der Austria geplant. Die Liegefiguren symbolisieren die Flüsse der einstigen Doppelmonarchie, Donau, Inn, Elbe und Moldau.
Im Dreieckgiebel ist die Verleihung der Verfassung an die 17 Völker Österreichs durch Franz Joseph I. dargestellt.
Detail von Fuß der Laternen
Detail vom Geländer
Büsten des Architekten Theophil Edvard von Hansen.
Mosaik der Austria über dem Haupteingang. -
Burgtheater: gegründet wurde die Bühne 1776 durch Kaiser Joseph II. als „Hoftheater“. Bis heute markiert es den Höhepunkt der Laufbahn eines deutschsprachigen Schauspielers. Entwurf von Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879). Einweihung 1888 durch Kaiser Franz Joseph I. 1945 wurde der Zuschauerraum vollständig vernichtet, Wiedereröffnung erst 1955. Länge 136 m, Fassade 27 m hoch.
-
Palais Liechtenstein: ein Gartenpalais, errichtet unter Fürst Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein (1657-1712). Entwurf zunächst von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), dann Domenico Egidio Rossi (1659-1715), weitergeführt von Domenico Martinelli (1650-1718). Bis Ende 2011 befand sich hier das Liechtenstein Museum.
-
Strudlhofstiege: Ganz in der Nähe des Palais Liechtenstein gelegen. Die Treppenanlage aus Mannersdorfer Kalkstein, wurde von Theodor Johann Jaeger (1874-1943) entworfen. Es gilt als bedeutendes Bauwerk des Jugendstils. 1910 eröffnet. Integriert sind zwei kleine Brunnen. Über dem unteren, kleineren Brunnenbecken dient eine Kopfmaske als Wasserspeier.
Oberer Brunnen, bei dem ein von Donaukies umgebenes Fischmaul Wasser speit. -
Palais Felix: Fassade mit einem von Karyatiden getragenen Giebel und Vordach aus Metall. Erbaut 1870 als Residenz und Atelier für den österreichischen Maler Eugen Felix. Neoklassizismus.
Laden mit Modellen von Teilen des menschlichen Körpers.
Samenkapseln des Chinesischen Blauglockenbaums.
Kleiner chinesischer Steingarten, umgeben von niedrigem Zaun aus Bambus. -
Josephinum oder Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum war eine medizinisch-chirurgische Akademie zur Ausbildung von Militärärzten. Heute gehört das Gebäude zur Universität Wien und birgt unter anderem das Institut für Geschichte der Medizin. 1783-1785 nach Plänen von Isidore Canevale (1730-1786) errichtet. Eröffnet 1784 von Kaiser Joseph II. (1741-1790).
Detail des von Greifen gehaltenen Wappenschildes mit dem österreichischen Doppeladler. -
Dampferfahrt mit der „Vindobona“: Name Wiens als römisches Legionslager.
Libelle
Donaukanal = Kleine Donau, ein Donauarm Richtung Süden. Im Mittelalter befand sich hier der Hauptarm der Donau. Fahrt Richtung Süden.
Badeschiff Wien. Ein schwimmendes Lokal mit Pool und Sonnendeck.
Urania: Volkbildungshaus mit Sternwarte. Gebäude Jugendstil 1909 nach Entwürfen von Max Fabiani (1865-1962) (Schüler von Otto Wagner) erbaut. Hier mündest der Fluss Wien in den Donaukanal.
Bundesamtsgebäude: Erbaut 1980-1986 von Peter Czernin (1932-2016). Durch seine achteckige Form, wird das Gebäude auch „Oktoneum“ genannt.
Blick zurück zur Urania.
Malereien an einem Container.Daubelfischer = quadratische Hebenetze am Ufer mit einem kleinen Haus aus Holz.
Einmündung des Donaukanals in die Donau
Bemalte Silos.Schleuse Freudenau
Buddhistische Friedens-Pagode, 1983 eingeweiht. 28 m hoch. An der Vorderseite 3 m hohe Buddhastatue, integriert in eine Stupa.
Historische Schiffe am Ufer.Praterbrücke: achtspurige Autobahnbrücke. Erbaut 1967-1970.
Franz-von-Assisi-Kirche auch Kaiserjubiläumskirche oder Mexikokirche genannt. 1898 gründete sich ein Komitee, welches den Bau einer repräsentativen Kirche organisieren sollten. Anlass war das 50-jährigen Thronjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. Grundsteinlegung 1900. Architekt war Victor Luntz (1840-1903). Die Fertigstellung verzögerte sich und so wurde sie erst 1913 eingeweiht. Da bereits 1898 Kaiserin Elisabeth (Sisi) ermordet worden war, befindet sich im linken Seitenschiff die Elisabeth-Kapelle. -
UNO-City, 1979 eröffnet. 3. Hauptsitz der UNO neben New York und Genf. 1996 folgt Nairobi als 4. Sitz. Geschwungene Hochhäuser im Hintergrund Entwurf von Johann Staber (1928-2005), errichtet 1973-76. Direkt benachbart die Hochhäuser der Donau-City, auf dem Gelände der für 1995 vorgesehenen Weltausstellung, die durch Volksentscheid verhindert wurde. Hochhaus mit dem roten Aufbau = 113 m hoch Andromeda Tower von Wilhelm Holzbauer (1930-2019), von1998.
Kurz vor der Einfahrt in den Donaukanal von Norden der Leopoldsberg (425 m hoch) mit Burg. Links daneben der Kahlenberg, der zum Wienerwald gehört.
Leopoldskirche: die Burg auf dem Leopoldsberg war im Zuge der ersten Türkenbelagerung Wiens weitestgehend zerstört worden. Anlässlich der Pest in Wien 1679, ließ Ksiser Leopold I. am Leopoldsberg, der damals noch Kahlenberg hieß, einen Sakralbau errichten und widmete ihn dem 1485 heiliggesprochenen Babenberger Markgrafen Leopold III. Bei der zweiten Türkenbelagerung 1683, wurde die neu errichtete Kapelle mit zentralem Kuppelraum und vier Kreuzarmen in Brand gesetzt und geplündert. 1693 wurde die reparierte Kirche erneut geweiht.
Kraftwerk und Schleuse Nussdorf. 1892 erbaut. Pläne erarbeitet von Otto Wagner (1841-1918), der in der Anlage aufgrund ihrer exponierten Lage eine Art Stadttor sah. Er stattete daher die machtvollen Pylonen mit bronzenen Löwen aus. -
Müllverbrennunsanlage Spittelau, gestaltet durch Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).
Rossauer Kaserne gebaut 1865-1869 als Kronprinz-Rudolf-Kaserne kurz nach der Revolution von 1848. Heute Bundesministerium für Landesverteidigung.
Graffitos an der Ufermauer.
Schützenhaus von Otto Wagner (1841-1918). Es gehörte zur geplanten Staustufe Kaiserbad. Schütz ist ein altes Wort für ein bewegliches Wehr, daher wird es auch Schleusenhaus genannt. Heute Restaurant.
Graffito an der Ufermauer. -
Ruprechtskirche. Heutiger Bau 1130-1170. Schlichte einschiffige Kirche mit später erneuertem gotischen Chor. Mittleres Chorfenster mit den einzigen romanischen Glasfenstern Wiens. Der Vorgängerbau wurde über einer römischen Bastion der Stadtbefestigung erbaut. Es handelte sich um die erste Kirche Wiens, erbaut im 8. Jahrhundert von missionierenden Mönchen.
-
Kunstuhr der Anker-Versicherungsgesellschaft an der Ostseite des Hohen Marktes. Ein Schwibbogen überspannt die Rotgasse. 1914 von Franz von Matsch (1861-1942) geschaffene Spieluhr. Stündlich paradieren berühmte Wiener.
Unterseite des Bogens mit Greifen und den Tierkreiszeichen.
Stützen mit Gesichtern. -
Der Hohe Markt ist der älteste Platz Wiens. Erbaut auf dem „Forum altum“ der Römer stand hier einst der Palast des Festungskommandanten, im Mittelalter lag hier die Richtstätte, es war der Handelsplatz der Gewandkrämer, daher auch der Wiener Name „Fetzenviertel“. In der Mitte der von Leopold I. gestiftete Vermählungsbrunnen oder Josephsbrunnen. Ursprünglich von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) in Holz errichtet. Nachdem dieses Denkmal desolat geworden war, wurde es im Auftrag von Kaiser Karl VI. abgetragen und als Ersatz ein 18,5 m hoher Tempel auf korinthischen Säulen aus weißem Marmor, nach einer Zeichnung von Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) erbaut.
Die 4 Engelsfiguren und die Vermählungsgruppe stammt von Antonio Corradini (1688-1752). Der Bronzebaldachin erinnert an einen jüdischen Hochzeitsbaldachin und wurde von dem Glockengießer Johann Baptist Divali (1672-1746) geschaffen.
Prunkvolle Eingangstür aus Holz. -
Altes Rathaus bis 1885 Sitz der Stadtverwaltung. Es handelt sich ursprünglich um das Haus des freiheitsliebenden Bürgers Otto Haymo. Nachdem 1309 Kaiser Albrecht I. ermordet wurde, entschlossen sich namhafte Wiener Bürger zum Widerstand gegen den neuen Habsburger Landesherrn. Die Verschwörung wurde entdeckt, die Mitglieder bestraft und enteignet. Heute hat es eine barocke Fassade, deren Westhälfte zwischen 1699 und 1706 von einem unbekannten Architekten nach dem Vorbild von Johann Bernhard Fischer von Erlach gestaltet wurde. Die Osthälfte wurde 1780 durch Theodor Valery (1724-1800) barock umgestaltet.
An der Westhälfte 2 Portale mit Plastiken: Gerechtigkeit und Güte von 1706 und Öffentliches Vertrauen und Frömmigkeit von 1781. Letzteres von Johann Michael Fischer (1740-1820).
Das massiv gestaltete Erdgeschoss wird durch ein kräftiges Gesims von den beiden Hauptgeschossen getrennt. Reich gestaltet ist die Architravzone unter dem Dachgesims. -
Judenplatz mit dem 1999 von Rachel Whiteread (1963-) gestalteten Mahnmal für den Holocaust. Ermordung von 65.000 Wiener Juden durch die Nationalsozialisten. Dahinter liegt das Museum am Judenplatz mit Ausgrabungen einer mittelalterlichen Synagoge und einem Museum zum mittelalterlichen Judentum.
-
Alte Häuser in Wien, Schwertgasse.
-
K.K. Telegrafen-Centrale mit Ausstellung „Wagner Extase“.
-
Alte Börse: nach einem Architektenwettbewerb wurde das von Carl Tietz (1831-1874) entworfene Gebäude von 1873-1877 errichtet. Typisch für den Historismus als Stil der Architektur in der Ringstraße, handelt es sich hier um den Stil der Neorenaissance. Inspiriert wurde es von der Tradition der flämischen Rathäuser der Gotik, z.B. vom Rathaus in Brüssel.
-
Festival mit Musikfilmen am Neuen Rathaus. Typischer Bau der Neogotik. 1872-1883 unter Franz Joseph I. vom Kölner Dombaumeister Friedrich von Schmidt (1825-1891) errichtet. 98 m hoher Turm mit dem Wahrzeichen, dem „Eisernen Rathausmann“. Diese aus Kupfer getriebene Gestalt eines Standartenträgers in Rüstung, ist allein, 5,4 m hoch. Insgesamt ist der Rathausturm also103,3 m hoch und damit eines der höchste Gebäude Wiens. Im Inneren u.a. ein 81 x 35 m großer Innenhof.
Schaut man auf das Neue Rathaus, hat man das berühmte Burgtheater im Rücken, da es genau gegenüber, jenseits der Ringstraße liegt.
Das Neue Rathaus besteht aus Backstein und ist mit Naturstein lediglich verkleidet.
Unten am Turm Statuen der Wappenträger der Kronländer.
Im Erdgeschoss sind Arkadengänge vorgelagert. Darüber ein kleiner Balkon. Er ersetzt einen ursprünglich in der Zeit des Nationalsozialismus entstandenen Holzbalkon, der für Adolf Hitler für eine Ansprache 1938 gebaut worden war.
Blick auf die zu einem der Innenhöfe gelegenen Fassaden.
Fassade bei Nacht mit Beleuchtung. -
Hofburg: Plan der Hofburg. Der aus 18 Gebäuden bestehende Komplex blickt auf eine 700-jährige Baugeschichte zurück.
Rechts der Volkgarten, links der Burggarten. Ganz oben der Maria-Theresia-Platz mit den Zwillingsbauten von Kunsthistorischem- und Naturhistorischem Museum. In der Mitte der Heldenplatz. Links spannt sich im großen Bogen die Neue Hofburg. Hier befinden sich verschiedene Museen und Teile der Österreichischen Nationalbibliothek. Nr. 5 bezeichnet den Festsaaltrakt. Der dreieckige Gebäudekomplex unten links ist die Albertina, Österreichs am meisten besuchtes Museum. Rechts daneben am Josepfsplatz gelegen die Nationalbibliothek mit dem Prunksaal (Nr. 12). Wieder rechts daneben die beiden Höfe der Stallburg und der Sommerreitschule. Der kleine Hof darüber ist der Schweizerhof mit den Zugängen zu den Schatzkammern. Dieser Bereich wird auch die Alte Hofburg genannt (Nr. 3 + 4). Unten der Michaelerplatz mit dem Durchgang in den großen Burghof mit dem rechts liegenden Amalienhof und dem Leopoldinischen Trakt, der die Hofburg zum Volksgarten abgrenzt.
Blick über den Heldenplatz auf die Neue Hofburg.
Torbau zwischen Hofburg und der Ringstraße.
Eine der berühmten Wiener Fiaker, Kutschen.
Reiterstandbild Prinz Eugen, Türkensieger von Anton Dominik von Fernkorn (1813-1878).
Neue Burg nach Entwürfen von Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879) ab 1869 für Kaiser Franz Joseph I. planten. Sie ist Teil des monumentalen Kaiserforums. Vom zentralen Balkon aus verkündete Adolf Hitler 1938 die Annexion Österreichs. Heute ist hier das Museum für Völkerkunde, die Hofjagd- und Rüstkammer, Sammlung historischer Musikinstrumente, das Ephesos-Museum und der historische Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek untergebracht.
-
Josefsplatz: Fassade der Winterreitschule am Josefsplatz.
Palais Pallavicini: an der nordöstlichen Seite des Josefsplatz gelegen. Ein klassizistischer Bau mit prächtigem Karyatidenportal und Attikafiguren des Bildhauers Franz Anton von Zauner (1746-1822) 1786, wurde 1782-84 vom Architekten Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816) für Moritz Reichsgraf von Fries erreichtet, damals einer der reichsten Männer des Landes.
Detail der Kayatiden.
Auf dem einheitlich spätbarock umbauten Platz ein von Franz Anton von Zauner (1746-1822) zwischen 1795-1806 geschaffenes Denkmal von Joseph II, dem Sohn Maria Theresias.
Statue des Atlas mit goldener Weltkugel oben am Dach.
Weitere Statuen am Dach. -
Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek:
Vase aus Stein im Treppenhaus.
Der barocke Prunksaal gehört zu einem der schönsten historischen Bibliothekssäle der Welt. Bau von Kaiser Karl VI. veranlasst. 1723-26 nach Plänen des berühmten Hofarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) und seinem Sohn Joseph Emanuel (1693-1742). Deckenfresken von Daniel Gran (1694-1757) bis 1730 fertiggestellt. Der Prunksaal nimmt die ganze Front des Josefsplatzes ein und misst 77,7 m in der Länge, 14,2 m Breite und 19,6 m Höhe. Der Saal fasst 200.000 Bücher von 1501-1850, darunter die 15.000 Bände umfassende Sammlung des Prinzen Eugen von Savoyen im Mitteloval. Insgesamt ist die Österreichische Nationalbibliothek mit über 10 Millionen Büchern eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt.
Fresken an der Decke im heutigen Eingangsbereich behandeln weltliche und kriegerische Themen.
Bücherschränke aus Nussholz
Statuen berühmter Persönlichkeiten.
Fresko der knapp 30 m hohen Kuppel stellt die Apotheose Karls VI., mit einer Allegorie auf die Erbauung der Bibliothek dar.
Im Zentrum des Mittelovals steht eine lebensgroße Marmorstatue Kaiser Karls VI., als „hercules Musarum“ vonden Brüdern Peter Strudel (1660-1714) und Paul Strudel (1648-1708).
Porträtbüste des Arztes Gerard van Swieten.
Römische Zahlen über den Regalen kennzeichnen sie verschiedenen, nach Sachgebieten aufgestellten Bestandsbereiche.
Detail des Deckenfreskos: Herkules und Apollo halten ein Medaillon mit dem Bild von Kaiser Karl VI.
Der Name des Freskenmalers Daniel Gran, 1730 und die „VI“ des Kaisers am Rand der Kuppel.
Bogen mit dem Porträt der Kaiserin Elisabeth von Österreich.
Bogen mit aufrecht stehendem Löwe mit Rahmen, ganz aus hebräischer Schrift gestaltet.
Heldenplatz mit der beleuchteten Fassade der Neuen Burg bei Nacht.
-
Votivkirche: einziger Sakralbau der Ringstraße. Anlass für die Errichtung war der Fehlschlag eines Attentats auf den jungen Kaiser Franz Joseph I. im Februar 1853. Sein jüngerer Bruder Erzherzog Ferdinand Max (später Kaiser Maximilian) rief zu Spenden für diesen Kirchenbau auf.
Entwurf: Heinrich von Ferstel (1828-1883). 3-schiffige neogotische Basilika mit Zweiturmfassade. Vorbild sind französische gotische Kathedralen. Nach über 20 Jahren Bautätigkeit 1879 geweiht. 99 m hoch, zweithöchste Kirche Wiens. Die Basilika hat 3 Schiffe und einen Chorumgang mit Kapellenkranz, dieses allerdings ungewöhnlicherweise im Westen. Die östliche Hauptfassade wird von zwei riesigen Türmen flankiert.
Detail eines Wasserspeiers.
Blick auf die Vierung mit einfachem Dachreiter und den Chor mit Kapellenkranz.
Denkmal für Antonio Vivaldi.
Einer der Eingänge mit reichem Figurenschmuck.
Inneres:
Langhaus mit Kreuzgewölbe. Die Zone des Triforiums ist weggelassen und zeigt die Wappen aller, im großen Titel des Kaisers vorkommende Reiche, Provinzen und Ortschaften.Die Bemalung im Gewölbe des Mittelschiffs, zeigt den Stammbaum Christi.
Detail der Bemalung des Gewölbes.
Orgel von Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872) in Ludwigsburg, 1878 eingebaut. Anton Bruckner spielt häufig auf ihr.
Kanzel: Sechseckig mit Marmorsäulen aus Ägypten. Die Brüstung zeigt im Mittelrelief den lehrenden Christus, umgeben von den 4 Kirchenlehrern des Westens (Augustinus, Gregorius, Hieronymus und Ambrosius). Selbstbildnis des Architekten Heinrich Ferstel im Fuß der Kanzel, eine Analogie zum Kanzelfuß im Stefansdom.
Glasfenster, genannt das marianische Gnadenbild.
Bischofskapelle mit neuen Glasfenstern. Sie zeigen Bischöfe, die für die österreichische Kirchengeschichte von Bedeutung waren, links das Fenster den heiligen Ambrosius, er segnet ganz unten die Bienenkörbe. Rechts das Fenster des Heiligen Altmann, unten betet er vor einen romanischen Madonnenbild. Neugotischer Herz-Jesu-Altar aus Laaser Marmor. Unten Medaillons mit dem Phönix, der aus den Flammen steigt, das Kreuz des Auferstandenen, umgeben von einem Strahlenkranz und der Pelikan, der seine Jungen mit Herzblut nährt. Im Altaraufsatz das Opferlamm Christi mit den Evangelistensymbolen. Oben eine Herz-Jesu-Statue mit mehreren Reliefs mit reicher Vergoldung mit der Passion Christi.
Sterngewölbe der Vierung.
Südliches Querschifffenster, im 2. Weltkrieg zerstört. Oben die beiden ältesten Heiligen Österreichs, der Heilige Severin, Gefangene befreiend und rechts der Heilige Martin, Nackte bekleidend. Beide Heilige verkörpern die christliche Nächstenliebe, die auch im unteren Teil des Fensters Menschen zeigt, die sich auf verschiedenartigste Weise um Sozialreformen im christlichen Sinn bemühten.
Nördliches Querschifffenster, ebenfalls im 2. Weltkrieg zerstört, aber als einziges Fenster originalgetreu nachgebildet, da es noch die Originalzeichnung von Eduard von Steinle (1810-1886) gab. Dieses „Kaiserfenster“ zeigt oben die Taufe Christi und seine Verklärung auf dem Berg Tabor. Darunter ein dreiteiliges Widmungsbild: Erzengel Michael tötet den Drachen, das Symbol der Sünde, der das Leben des Monarchen bedroht. Hier wird das historische Ereignis des versuchten Anschlages auf den Kaiser (der Anlass für den Kirchenbau) in die Sphäre des Sakralen verlegt. Joseph und der andere Namenspatron des Kaisers, Franz von Assisi befinden sich in der Mitte des Bildes. Letzterer beugt sich über den jugendlichen Kaiser, der nach rechts gewandt vor der thronenden Madonna kniet, um für seine Errettung zu danken.
Taufkapelle mit Renaissance-Hochgrab des Grafen Niklas Salm – Befehlshaber während der Türkenbelagerung Wiens 1529 (Werkstatt des Loy Hering (1484-?) in Antwerpen). Gelb-grauer Marmor. Seitenwände mit Reliefs, die in figurenreichen Gruppen die Gefechte und Schlachten veranschaulichen, an denen Niklas Salm teilnahm. 10 Medaillons enthalten Reliefbrustbilder berühmter Zeitgenossen Salms, sowie ihn selbst.Weitere Glasfenster.
Eine der Kapellen am Chorumgang mit Glasfenstern und Wandmalereien. Altar mit Kreuzigung.
Detail eines Glasfensters mit einem Hinweis auf den 2007 selig gesprochenen Franz Jägerstätter. Geboren als Franz Huber, war ein österreichischer Landwirt und Widerstandskämpfer, der wegen „Wehrkraftzersetzung hingerichtet wurde.
Kopie der Madonna von Guadelupe im nördlichen Querschiff. Das mexikanische Gnadenbild wurde 1954 von dem Maler Hans Schweiger (1930-) angefertigt. Er schuf auch das Glasfenster darüber, welches die wichtigsten Szenen der Legende um die Madonna von Guadelupe dargestellt.
Historisches Gebäude in der Währinger Straße, in der Nähe der Votivkirche. -
Innenhof des Schottenstifts. Im Schottenstift befindet sich eine Gemäldegalerie und ein Gymnasium, aus dem u.a. Johann Strauß Sohn und der Maler Moritz von Schwind zur Schule gingen.
Innenraum eines Restaurants.
Biergarten mit Brunnen. -
Freyung: einer der größten und bekanntesten Plätze in Wien. Im Hintergrund das von irischen Mönchen gegründete Schottenstift. Das Schottenkloster gewährte Befreiung von der städtischen Gerichtsbarkeit und besaß ebenso wie der Stephansdom das Recht, Verfolgten Asyl zu gewähren. Wahrscheinlich leitet sich der Name des Platzes daher ab. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden im Umkreis Stadtpaläste. Rechts das weiße Haus neben der Schottenkirche, ist das 1773/74 von Andreas Zach (1736-1797) erbaute „Schubladkastenhaus“. Es handelt sich um eine volkstümliche Bezeichnung für das Prioratshaus des Schottenstifts.
-
Schottenkirche an der Freyung.
Erbaut für irische Benediktinermönche, die im 12. Jahrhundert von Regensburg nach Wien berufen wurden. Irland = Neu-Schottland. Der Babenberger Herzog Heinrich II., genannt Jasomirgott (1107-1177), der Wien zu seiner Residenz erkor, gründete 1155 das Schottenkloster. Kirche 1177 begonnen, fiel sie 1276 einem Stadtbrand zum Opfer. 1317 wurde sie im frühgotischen Stil erneuert. 1443 beschädigte ein Erdbeben den Chorraum, der dann 1446-1449 gotisch umgestaltet wurde. Als dann 1638 der Turm nach einem Blitzschlag einstürzte, wurde dies von Abt Johann Walterfinger zum Anlass genommen, die Umgestaltung von Turm und Chor in barocken Formen in Auftrag zu geben.
Die jetzt mit einem Tonnengewölbe versehene Wandpfeilerkirche wurde von Andrea Allio dem Älteren, seinem Vetter Andera Allio dem Jüngeren (gest. 1645) und Silvestro Carlone (1610-1671) errichtet.
Fassade im Westen.
Inneres:
Die meisten barocken Altäre wurden in der Zeit von 1883-1887 durch Altäre in Stil des Neobarock oder der Neorenaissance ersetzt.
Tonnengewölbe mit Malereien, hier die Kreuzabnahme und Christi Auferstehung.
Darstellung der Stiftung durch Herzog Heinrich II. genannt Sasomirgott an die irischen Mönche.
Der Hochaltar war Heinrich Ferstels (1828-1883) letzte Arbeit (1883). In der Mitte ein Mosaik von Michael Rieser (1828-1905). -
Palais Kinsky an der Freyung am Beginn der Herrengasse. 1713-1719 erbaut. Er ist einer der am besten erhaltenen Barockpaläste Wiens. Entwurf Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Auftraggeber war Graf Daun, der Vater des Feldherrn aus dem Siebenjährigen Krieg gegen Friedrich II. von Preußen. Heute ist es ein Auktionshaus. Auf nur 30 m Breite Straßenfront, wurden 4 Etagen bis in eine Höhe von 28 m untergebracht. Durch 2 hintereinander liegende Höfe zieht es sich fast 90 m in die Tiefe des Grundstücks.
Monumentales Eingangsportal, welches sich an römischen Vorbildern orientiert. Bildhauer bzw. Steinmetzmeister waren hier Johann Georg Haresleben (1671-1716) und Simon Sasslaber (1673-1740).
Über dem Portal und einem Fenster das Wappen der Familie Kinsky mit Putten.
Inneres:
An den Holzvertäfelungen des Flurs Zierelemente mit Figuren und Wappen aus Metall.
Rundes Vestibül hinter dem Treppenhaus.
Blick in das Treppenhaus. Die Figuren stammen wahrscheinlich von Joseph Kracker (1683-1733), der auch die Figuren am Hauptportal gestaltet haben dürfte. Die Stückverzierungen an der Decke zeigen Kriegsgerät, ein Hinweis auf den ursprünglichen Bauherren Feldmarschall Wirich Philipp Graf Daun.
Riesige, golden gerahmte Spiegel und Lampen.
Das Treppenhaus ist ein Entwurf von Antonio Maria Nicolao Beduzzi (1675-1735). In der Beletage ein zentrales Deckenfresko, welches die Apotheose des Grafen Daun darstellt. In der Technik der perspektivischen Quadraturmalerei stammt es von Marcantonio Chiarini (1652-1730) und Carlo Innocenzo Carlone (1686-1775).
Beletage mit golden gerahmten Spiegeln, Lampen und Statuen.
Nischen mit Statuen.
Blick in das Treppenhaus von oben. -
Palais Porcia: Eingangsportal des Palais Porcia neben dem Palais Kinsky. Es ist einer der wenigen Palastbauten in Wien, der noch unter dem Einfluss der Renaissance entstand, und zählt zu den ältesten erhaltenen Palais Wiens.
Über dem Portal der kaiserliche Doppeladler. -
Palais Batthyány: Herrengasse 19 mit einem um 1718 entstandenen Balkonportal, welches Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) zugeschrieben wird. Auf Postamenten stehen Vasen, aus denen Schlangen quellen. An der Seite Pilaster, geschmückt mit Kriegstrophäen. Oben im Giebel über dem kleinen Balkon das Wappen der Fürsten Batthyány. Durch Zusammenlegung mehrerer Häuser auch um die Ecke in die Bankgasse hinein, entstand das große Palais Batthyány.
-
Palais Ferstel: Donaunixenbrunnen in einem der Innenhöfe des Gebäudes, das eigentlich als Nationalbank- und Börsengebäude errichtet wurde. Es ist ein Spätwerk des romantischen Historismus. Der Architekt war Heinrich von Ferstel (1828-1883).
Weiteres historisches Gebäude. -
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten: Fassade zur Herrengasse.
-
Herrengasse 9 die Musikabteilung der Österreichischen Nationalbibliothek, incl. Globenmuseum. Die Musiksammlung hat sich im Laufe der Jahrhunderte aus den Beständen der kaiserlichen Hofbibliothek entwickelt. Heute ist es nicht nur eine moderne Bibliothek, sondern auch ein Musikarchiv von Weltrang. Zu ihren Beständen gehören zahlreiche Autographe von berühmten Komponisten.
Wolfgang Amadeus Mozart: Flötenquartett KV 298
Ludwig van Beethoven: Sonate für Klavier und Violine op. 24
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7, Adagio
Joseph Haydn: Hymne „Gott erhalte Franz den Kaiser“. Auf die Melodie der früheren österreichischen Kaiserhymne wird 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben das „Lied der Deutschen“ gedichtet, dessen 3. Strophe die heitige deutsche Nationalhymne ist.
Richard Strauss: Der Rosenkavalier, 1. Akt. -
Im Jahr 2001 wurden 70 Sterne des „Wiener Walk of Fame“ mit Namen klassischer Komponisten und Musiker in den Boden eingelassen. Sie befinden sich auf einer Route zwischen Theater an der Wien und dem Stephansdom.
-
Musikvereinsgebäude = Konzerthaus der Wiener Philharmoniker. Im Hintergrund die Kuppel der Karlskirche.
Die 1812 gegründete Gesellschaft der Musikfreunde, kurz Musikverein, vergab 1867 einen Bauauftrag an Theophil Edvard von Hansen (1813-1891) für ein Konzerthaus im Stil der Neorenaissance. Er war später auch der Erbauer des Parlaments. Es sollten zwei Säle werden, ein großer für Orchesterkonzerte und ein kleiner für Kammermusikonzerte. Es ist das traditionsreichste Konzerthaus in Wien.
Das Gebäude ist im historisierenden Stil nach Vorbildern aus der griechischen Antike gebaut, gedacht als „Tempel“ der Musik.
Inneres:
Mehrere Kuppeln über einem Gang.
Detail einer Kuppel.
Eingangsbereich, Foyer mit goldfarbenen gemusterten Kuppeln.
Detail der Kuppeln und Kapitelle.
Goldener Saal: hier gastierten prominente Musiker und finden Konzerte mit dem 1842 gegründeten Wiener Philharmonikern statt. Hier lehrten Gustav Mahler und Hugo Wolf, nahezu alle weltberühmten Dirigenten gastierten hier. Bis zu 1744 Sitzplätze und 300 Stehplätze stehen zur Verfügung. Er gilt als Saal mit der weltweit besten Akustik. Die Deckengemälde zeigen die 9 Musen von August Eisenmenger (1830-1907).
1968 eingebaute Orgel mit 100 Registern und 7500 Pfeifen.
36 goldene Karyatiden schmücken den Saal.
Kleiner Saal oder Brahmssaal: Der kleine Saal wurde erst 1993 in seiner ursprünglichen Form mit roten Säulen und grünen Marmorwänden wiederhergestellt.
Konzert auf historischen Instrumenten.
Ausstellung mit Noten, zum Teil Autographe:
Baryton des Fürsten Nikolaus Esterházy mit 9 Resonanzsaiten. Haydn schrieb während seiner Zeit im Dienste des Fürsten Nikolaus Esterházy in seinem Autrage allein 175 Werke für Baryton.
Cembalo von Domenico da Pesaro (1533-1575) von 1546.
Klavier des Klavierbauers André Stein (1776-1842).
Orgel-Tabulaturbuch von 1623.
Joseph Haydn: Streichquartett op. 20
Wolfgang Amadeus Mozart: eine Arie aus „Le nozze die Figaro“
Wolfgang Amadeus Mozart: eine Arie aus „Bastien und Bastienne“
Ludwig van Beethofen: Sonate für Klavier op. 81 a
Johannes Brahms: Streichquartett Nr. 2 op. 111
Fassade des Musikvereinsgebäudes angestrahlt bei Nacht. -
Karlskirche: neben der Hofbibliothek ein zweites Spätwerk des Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723). Erbaut 1716-1739 ist sie mit Blickbezug hin zur Hofburg als Architekturprospekt konzipiert. Hinter der breiten Fassadenfront mit Portikus, Dreiecksgiebel und den zwei Triumphsäulen, erstreckt sich der Bau mit der überhöhten Kuppel. Angestrahlt bei Nacht.
Schwalbenschwanz, Schmetterling an der Bordsteinkante.
-
An der südlichen Stadteinfahrt von Wien die Christuskirche. Architekt war Theophil Edvard Hansen (1813-1891), der auch das Parlament entworfen hat. Byzantinische Formen mit Zierelementen aus Terrakotta.
-
Musiksammlung der Wienbibliothek: Gründungsbestand war eine Sammlung von Autographen von Franz Schubert, die der Kunstmäzen und Industrielle Nikolaus Dumba (1830-1900) der Stadt Wien schenkte. Vor allem Notenhandschriften und Notendrucke der letzten 200 Jahre bilden den Sammelschwerpunkt, hier vor allem auch Wiener Verlage und Komponisten. Die Schubert-Sammlung wurde inzwischen sogar in das „Memory ot the World-Register der UNESCO aufgenommen.
Treppenhaus der Bibliothek
Grundriss der Wohnung in der Bartensteingasse 9/5. Das Haus wurde von Ludwig Tischler entworfen. In der ersten Etage befindet sich die ehemalige Privatwohnung des jüdischen Industriellen Friedrich Boskovits. 1991 bezog die Musiksammlung der Wienbibliothek die restaurierten Räumlichkeiten.
Speisezimmer: seit 2013 ist ein musealer Rundgang durch die Wohnung möglich. Die Wohnung wurde 1907 vom bekannten Architekten und Designer Adolf Loos (1870-1933) gestaltet. Höhepunkt der für die Ringstraßenbauten typischen großzügigen Raumaufteilung bildet das Speisezimmer. Massive Wandvertäfelungen aus Mahagoni und ein Kamin, sowie ein dekorativer Fries aus Stuck geben einen Eindruck der Inneneinrichtungen der Wiener Moderne.
Notenhandschriften und Notendrucke:
Franz Schubert: Introduction Nr. 1. Autograph.
Auf Tapete notierte Noten von „Vier Tiroler Walzer“, die bei der Restaurierung der Räume aufgefunden wurden. Dazu auch der Notendruck.
Johann Strauß: Alexander Quadrille. Notendruck.
Richard Wagner: Autograph
Badezimmer
Ausstellungsvitrinen mit Autographen von Hugo Wolf, Johannes Brahms und Anton Bruckner.
Ausstellungsvitrinen mit Autographen von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn.
Vorbereitung einer Aufführung mit chinesischen Mädchen in Tracht.
Stiche mit Venedig als Motiv:
Kolorierte Stiche mit Kleidung des Herzogs und der Herzogin von Venedig.
Pietro Aaron: Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato. Venedig 1525.
Gesangbuch mit „Hufnagelnoten“ und Stichen.
Notendruck mit „Hufnagelnoten“ für Basso, Tenoro, Alto. Starke Fraßspuren von Bücherwürmern.
Stich mit Darstellung des Markusplatz in Venedig. Prozession des Dogen.
Kolorierter Stich: „Der Doge von Venedig fährt am Tag der Himmelfahrt auf dem Bucintoro zur Hochzeit des Meeres“
Stick mit Darstellung des Markusplatz in Venedig zur des Karnevals.
Kolorierter Stich mit dem Stadtplan von Venedig.
Antonio Salieri: Quintett, 1779. Titelblatt einer Musikhandschrift mit Darstellung von musizierenden Chinesen
Benedetto Marcello: Estro poetico-armonico parafrasi. Venedig 1724. Titelkupfer mit König Salomon, die Harfe spielend.
Gemälde mit Musikern, Männern in schwarzen Karnevalsumhängen in der Barockzeit.
Kolorierter Stich vom Dogenpalast, Markusplatz und Gondeln in Venedig.
Kolorierter Stich vom Markusplatz in Venedig.
Stich mit mehreren Gondeln. Napoleon, Würdenträger, Chor und Musikanten. Im Hintergrund der Markusplatz in Venedig.
Stich mit Marukusplatz und Dogenpalast. Feierlichkeiten am Rosendonnerstag zu Zeiten der Republik Venedig.
Stich mit Gondeln und riesiger Galeere. „Hochfest des Bucentaur, das am Tag der Himmelfahrt in Venedig gefeiert wird“. Das im italienischen „Bucinturo“ genannte Schiff, war das Staatsschiff des Dogen.
Kolorierter Stich mit venezianischen Bauwerken, Trachten und Gondeln.
Notenhandschriften, Autographe:
Giuseppe Verdi: verworfener Bogen aus der Partitur seiner Oper „Attila“. Autograph. Johann Sebastian Bach: Kantate „Es ist das Heil uns kommen her“, BWV 9. Autorgraph.
Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4, 1. Fassung. Autograph.
Johannes Brahms: Konzert für Violone, Violoncello und Orchester, op. 102. Autograph.
Richard Wagner: Vorspiel zu „Tristan und Isolde“. Autograph.
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4. Autograph.
Anton Webern: Streichquartett op. 28. Autograph.
Felix Mendelssohn Bartholdy: Liederalbum für Jenny Lind. Weihnachten 1845. Autograph mit 2 Aquarellen Mendelssohns.
Franz Schubert: Sinfonie C-Dur, D 944. Autograph.
Franz Schubert: Lied „An die Musik“, D 547. Autograph.
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Es-Dur, op. 55, „Eroica“. Manuskript der Partitur mit getilgter Widmung an Napoleon.
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert, d-Moll, KV 466. Autograph.
Gemälde mit Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart.
-
Schlosstheater von Schönbrunn:
Fassade von Schloss Schönbrunn und P. Wagenknecht.
Wiens einziges noch existierendes Barocktheater. Trotz der Begeisterung der Habsburger seit dem 17. Jahrhundert für theatralische Darbietungen, war es erst seit der Zeit Maria Theresias (1717-1780) üblich, eigene, in die Schlösser integrierte Theaterbauten zu errichten. 1747 von Maria Theresias Lieblingsarchitekten Nicolò Pacassi (1716-1790) in dem rechts an das Schloss angrenzenden Bau eingerichtet. 1767 vom nachfolgenden Hofarchitekten Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816) umgebaut. Hier spielte die Regentin selbst in einigen Stücken mit, was durchaus dem Zeitgeist entsprach. Seit 1929 nutzt das Max-Reinhardt-Seminar die 2010 restaurierte Bühne, zusammen mit der Opernabteilung der Universität für Musik und Darstellende Künste. Des Typus des italienischen Logentheaters entsprechend, zeigt der Grundriss einen eiförmigen Kern mit Galerien und Logen.
Die heute existierende zentrale Kaiserloge stammt aus dem Umbau 1767.
Die Bühne ist von einer mächtigen Ädikula eingefasst, mit ionischen Säulen und gemaltem Dreiecksgiebel, sowie einem riesigen kaiserlichen Wappen.
Die Flachdecke des Raumes ist durch Illusionsmalerei, als eine zum Himmel geöffnete Kassettendecke gestaltet. Den Himmel bevölkern Personifikationen von Künsten, Wissenschaften und Reichtum. -
Stephansdom: bekanntestes Wahrzeichen Wiens. Österreichs bedeutendstes gotisches Bauwerk. Der vor dem Dom liegende Stephansplatz liegt mitten im Zentrum der Wiener Innenstadt. Seit 1722 erzbischöfliche Kathedralkirche. Generationen von Baumeistern haben seit dem 12. Jahrhundert an dem Bau mitgewirkt. Der Umbau zur gotischen Kirche erfolgte im 14. Jahrhundert, unter Herzog Rudolf IV. von Habsburg, daher sein Beiname „der Stifter“.
Der Dom ist 107,2 m lang, 34,2 m breit, das Mittelschiff 28 m hoch. Das Dach ist mit glasierten Ziegeln in 10 Farben gedeckt. Auf der Südseite ist das Muster einem sarazenischen Teppich nachempfunden. Mit 136,4 m ist der Südturm der höchste, der Nordturm wurde nicht fertiggestellt und ist nur 68 m hoch. Im ehemaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn durfte keine Kirche höher als der Südturm des Stephansdoms erbaut werden. Als der Turm fertig war, blieb er noch 50 Jahre lang das höchste freistehende Bauwerk der Welt.
Südseite des Doms: Neben der Südseite der eingerüsteten Doppelkapelle, das eingerüstete kleine Singertor, welches als das bedeutendste gotische Kunstwerk des Doms gilt. Dies war früher der Eingang für die Sänger. Daneben der Anbau für die Sakristei. Darüber kann man gut die Giebel am Langhaus sehen. Der westlichste Giebel am Langhaus, ist der sogenannte Friedrichsgiebel. Er war als einziger Giebel im 15. Jahrhundert fertiggestellt worden. Erst 1853-1855 wurden die restlichen 3 Giebel unter Dombaumeister Leopold Ernst (1808-1862) mit Maßwerk ergänzt.
An der Außenseite des Doms befinden sich, genauso wie auch innen, zahlreiche Grabdenkmäler.
Wir umrunden den Dom im Gegenuhrzeigersinn. Unterhalb des hohen Südturmes, befindet sich das „Primglöckleintor“. Nur 4 Konsolfiguren haben sich von der Ausstattung des 14. Jahrhunderts erhalten. Hier der Evangelist Markus mit seinem Symbol, dem Löwen.
Gedenktafel für den Dombaumeister Friedrich von Schmidt (1825-1891) am Südturm
Weitere Reliefs an der Außenseite des Domes mit der Passion Jesu
Jesus im Garten Gethsemane
Höllenfahrt Christi, der Adam und Eva aus dem Höllenschlund errettet.
Malereien mit der Passion Jesu an der Ostseite.
Der Chor mit der dortigen Sakristei.
Nordseite des Domes mit dem Nordturm = Adlerturm. Er blieb unvollendet. Die Bauarbeiten währten von 1467-1511. Sie wurden jedoch wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, religiöser Wirren und der drohenden Türkengefahr nicht fortgesetzt. Außerdem war Wien um 1520 eine protestantische Stadt geworden. Seit 1951 hängt hier die neu gegossene „Pummerin“, die aus den Trümmern der 1945 zerstörten Vorgängerglocke von 1711 gefertigt wurde. Diese Glocke hat einen Durchmesser von mehr als 3 m und wiegt 21 t. Grundsteinlegung 1450 durch Kaiser Friedrich III. Vor dem Turm, gleich neben dem Eingang zu den Katakomben steht die Capistrankanzel (15. Jahrhundert). Hier predigte der Heilige Johannes de Capistrano (1386-1456). Über ihr ließen die Franziskaner 1738 eine barocke Apotheose ihres Ordensheiligen anbringen.
Fiaker, traditionsreicher Zweispänner. Mitte des 17. Jahrhundert bot der Pariser Kaufmann und Pferdehändler Nicolas Souvage Mietkutschen an, deren Standplatz sich in der Rue de Saint Fiacre befand. Aus dem Fiacre wurde in Wien der Fiaker. 1693 erteilte Kaiser Leopold I. (1640-1705) die Lizenz für die erste Wiener Lohnkutsche. Heute sind etwa 300 Pferde gemeldet, von denen allerdings täglich nur etwa die Hälfte im Einsatz ist.
Direkt neben der Kanzel ein Relief unter einem Bogen.
Maßwerk und Wasserspeier am Nordturm
Adlertor: es ist breit angelegt, aber sparsam dekoriert, mit einer Marienstatue aus dem 17. Jahrhundert. Seinen Namen verdenkt es dem darüber stehenden Nordtumr, der auch Adlerturm genannt wird, da sich früher auf seiner Kuppel der Habsburgische Doppeladler zu sehen war.
Weiter Richtung Westen zur Hauptfassade, sind am Langhaus wieder Giebel zu sehen.
Westfassade mit den heute noch vom spätromanischen Vorgängerbau existierenden „Heidentürmen“ und dem „Riesentor“. Der romanische Vorgängerbau wurde 1295 erstmals urkundlich erwähnt. Ihr Name geht auf ein heidnisches Heiligtum zurück, das an ihrem Platz gestanden haben dürfte.
Gotisches Maßwerkfenster zwischen den Heidentürmen.
Balustrade mit Wasserspeiern oberhalb des Maßwerkfensters zwischen den Heidentürmen. 3 Statuen auf Sockeln unterhalb der Balustrade.
Fensterrose und Statuen unter Baldachinen aus Maßwerk.
Riesentor: Haupteingang, 1230-1250 entstanden (Zeit Kaiser Friedrich II.). Früher nur bei festlichen Anlässen geöffnet, zur Zeit der Babenberger wurde hier Recht gesprochen. Die Figuren aus dem 12. Jahrhundert wurden am Riesentor des 13. Jahrhunderts wiederverwendet. Den Namen erhielt das Portal, weil man bei Ausschachtungsarbeiten beim Bau einen Mammutknochen fand. Damals glaubten die Arbeiter, den Knochen eines Riesen gefunden zu haben, der bei der Sintflut umgekommen ist.
Der Figurenschmuck des Riesentors stammt aus dem 13. Jahrhundert. Auf jeder Seite stehen 7 trichterförmige Säulen mit Pflanzenmustern. Die wie Palmwedel wirkenden Kapitelle enthalten Figuren von Aposteln und Heiligen. Darüber groteske Chimären und Apostel.
Linkes Gewände: die dämonische Welt. Rechts an der Ecke ein Affe, darüber Apostel Petrus mit dem Schlüssel. Neben dem Affen der Teufel, der einem Menschen eine Schlinge umlegt. 2 Gerichtsadler, der glattgefiederte Sinnbild der ewigen Herrlichkeit, der rauhgefiederte Symbol der Verdammnis. Danach Löwe und 2 geflügelte Sirenen, 2 ineinander verschlungene Drachen.
Rechtes Gewände: die menschliche Welt, die der dämonischen ausgeliefert ist. Zuerst 2 später angebrachte Hunde mit einem gemeinsamen Kopf. Ein Fuchs, der einen liegenden Menschen an den Haaren zieht. Zwischen einem Löwen und einem Affen fasst ein Mann einem anderen an dessen spitzen Hut und hebt seine Axt zum Schlag. Am Ende ein kleiner Teufel und ein Mann, der mit erhobenen Händen vor ineinander verschlungenen Drachen steht.
Inneres:
Mittelschiff, Blick zum Hauptaltar. Im 14. Jahrhundert begann der gotische Ausbau des Doms.
Kanzel aus Sandstein 1510-1515 von Nicolaus Gerhaert van Leyden (1420-1473). Am Kanzelkorb die 4 lateinischen Kirchenväter. 6 mit Heiligendarstellungen besetzte Säulen bilden den Kanzelfuß. Die größte, tragende Säule im Zentrum steht für den Sonntag. Die Bildnisse der vier Kirchenväter ähneln sich und sollen auch die vier Temperamente darstellen. Zusammen mit dem „Fenstergucker“ (selbstbewusste Darstellung wahrscheinlich des Baumeisters Anton Pilgram (1460-1515) zeigen sie auch die verschiedenen Altersphasen. Von links: Hl. Augustinus mit Mitra, Buch und Tintenfass als nachdenklich versunkener jugendlicher Melancholiker, Hl. Gregor mit Papstkrone, Buch und Lupe als zweifelnder älterer Phlegmatiker, Hl. Hieronymus mit Kardinalshut und Buch als greiser Choleriker, Hl. Ambrosius mit Mitra und Buch als Sanguiniker.
Treppengeländer bestehend aus Rädern, die drei- und vierpässigen Fischblasen gebildet sind. Die 3-pässigen stehen für die göttliche Dreifaltigkeit und rollen aufwärts. Die 4-pässigen stehen für alles Irdische und rollen hinunter. Auf dem Handlauf verschiedene Tiere.
Gegenüber der barocke Altar des Hl. Johannes des Täufers. Altarbild von Johann Michael Rottmayr (1654-1730) von 1708. Entwurf und Ausführung des Altars Matthias Steinl (1644-1727).Säulenheilige unter Baldachinen aus Maßwerk.
Chor: 1304-1340. Bauherr war Albrecht I. (1255-1308). Sein Sohn Albrecht II. (1298-1358) förderte die Vollendung. Daher wird dieser Teil auch „Albertinischer Chor“ genannt. Rudolf IV. (1339-1365) der Sohn Albrechts II. veranlasste dann den Bau des gotischen Langhauses und die Verbreiterung der Seitenschiffe.
Hochaltar aus schwarzem Marmor von den Brüdern Johann Jakob Pock (1604-1651) und Tobias Pock (1609-1683) aus Konstanz errichtet und 1647 geweiht. Im Aufbau gleicht er einem Hausportal („porta coeli-Typus“). Altarbild zeigt die Steinigung des Hl. Stephanus vor den Mauern Jerusalems. Darüber der geöffnete Himmel mit Jesus und Gottvater. Die Statuen neben dem Altarbild stellen die Landespatrone Leopold und Florian und die Pestheiligen Rochus und Sebastian dar. Es handelt sich um den ersten und bedeutendsten frühbarocken Altar Wiens. Links vorne der Nepomuk- und rechts der Borromäusaltar.
Barockes Chorgestühl: die dargestellten Bischöfe, Papst Paul II. und Kaiser Friedrich III. sind durch Namenszüge und Wappenkartuschen identifizierbar.
Blick durch das Hauptschiff Richtung Westen auf die Westempore und die Kauffmann-Orgel (2020). Die ehemals vorhandene wertvolle Walcker-Orgel von 1886 verbrannte im 2. Weltkrieg. Dahinter befindet sich das große gotische Fenster, welches erst für die Einwölbung des gotischen Langhauses ab 1446 nötig wurde.
Nördliches Seitenschiff mit Frauenchor. Gleich am Anfang der Orgelfuß von Anton Pilgram (1460-1515). Selbstbildnis mit Zirkel und Winkel. Die Inschrift unterhalb des Portraits mit der Zahl 1513 weist ihn als Magister der Universität aus. Hier stand ursprünglich die erste Orgel. Rechts daneben der Peter- und Pauls-Altar.
Blick in den Frauenchor. Hinten der Neustädter Altar.
Grabplatten im Frauenchor. Rechts der erste wirklich in Wien residierende Bischof Georg von Slatkonia (1456-1522).
Wiener Neustädter Altar: er wird auch Friedrichsaltar genannt. Es ist ein typisch gotischer Flügelaltar, 1447 hergestellt aus älteren Teilen für das Zisterzienserkloster St. Bernhard in der Wiener Neustadt. Mit der Datierung 1447 auf der Predella ist er der älteste Doppelflügelaltar, der in Österreich noch erhalten ist. Man geht heute davon aus, dass die Schreinarchitektur, die Statuen und Gemälde um 1447 in der in der Wiener Neustadt ansässigen Werkstatt des Friedrichsmeisters gefertigt wurden.
Stiftung von Kaiser Friedrich III. Der Altar kam erst 1883 in den Dom.
Es handelt sich um ein Pentaptychon, ein Wandelaltar mit Hauptschrein und zwei beweglichen Außen- und zwei beweglichen Innenflügeln. Die Schnitzarbeiten sind teils farbig gefasst, teils vergoldet. Der Altar ist ein Marien- und ein Allerheiligenaltar. Bei geöffneten Flügeln, der sogenannten Festtagsseite, sieht man Szenen des Marienlebens. Links oben Krönung Marias durch Gottvater, links unten Geburt Christi, rechts oben Tod Mariens, rechts unten Anbetung der heiligen Drei Könige. In der Mitte oben Krönung Mariens durch die Dreifaltigkeit, Mitte unten Barbara, Maria mit Kind, Hl. Katharina. Auch die Predella hat Flügel, die bemalt sind. Nach Öffnung der Flügel ist der figurlose Schrein der Predella sichtbar. Er weist acht gotische, goldumrahmte Maßwerkfenster auf rotem Hintergrund auf, hinter denen Reliquien aufbewahrt wurden.
Details
Linker Predellaflügel: Mariä Verkündigung und Mariä Heimsuchung
Blick vom südlichen Seitenschiff in das Mittelschiff.
Dienstbotenmadonna, ca. 1300, gilt als eine der schönsten Marienfiguren ihrer Zeit. Von der ursprünglich bunten Bemalung sind nur Reste erhalten Ursprünglich stand sie im Frauenchor, wo in früherer Zeit die Frühmesse gefeiert wurde, die vor allem von Dienstboten besucht wurde.
Katharinen- oder Taufkapelle in der unteren Turmhalle des „Steffl“ genannten Domes. Taufstein aus Salzburger Marmor 1475-1481. In Flachnischen die 12 Apostel und Christus. Ursprünglich stand er im Mittelschiff. Am Fuß findet man als Fundament die vier Evangelisten. Seit dem 2. Weltkrieg schmückt die 7-eckige Taufkrone, bis dahin als Schalldeckel über der Domkanzel angebracht, wieder den Taufstein. Die Taufkrone gleicht einer Turmfiliale und wird bekrönt von einer Darstellung der Taufe Christi. Ansonsten Darstellung der 7 Sakramente.
Sterngewölbe in der Katharinen- oder Taufkapelle.
Schlussstein des Gewölbes mit der Hl. Katharina.
Apostelchor (südliches Seitenschiff) mit Grabmal Kaiser Friedrichs III. (1415-1493). Wie die Kanzel ebenfalls von Nicolaus Gerhaert van Leyden (1420-1473), ab 1463 geschaffen. Adneter Marmor aus einem Steinbruch bei Hallein (Nähe Salzburg). Max Valmet schuf die Reliefplatten, Michael Tichter (Wirkungsdaten 1499-1513) aus Salzburg die Balustrade mit den 54 Figuren. Die Deckplatte des Sarkophags zeigt die liegende Gestalt des Kaisers im Krönungsornat (Friedrich III. war der letzte vom Papst gekrönte Kaiser). An den Postamenten der Balustrade befinden sich die 12 Apostel. Das Grab wird oben abgeschlossen von Wappenschildern der kaiserlichen Besitzungen.
Der Adneter Marmor ist wegen seiner Buntscheckigkeit besonders schwer zu bearbeiten. Allein die Deckplatte des Grabmals wiegt über 8 Tonnen.
Aufsicht auf das Grab mit der Darstellung des Kaisers im Krönungsornat.
Details des Grabmals.
Empore für Sänger, ebenfalls von Anton Pilgram (1460-1515), dem Orgelfuß im nördlichen Seitenschiff gegenüber. -
Stolpersteine
-
Österreichische Mediathek: Es handelt sich um das österreichische Archiv für Tonaufnahmen und Videos aus Kultur- und Zeitgeschichte. 1960 wurde sie als Österreichische Phonothek gegründet. Als wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes, ist sie verantwortlich für das audiovisuelle Kulturerbe Österreichs.
Historische Radios und Geräte zum Abspielen von Tonträgern unterschiedlichster Art.
Kompaktanlagen mit historischen Tonträgern, hier Tonbändern.
Vitrine mit historischen Radio- und Fernsehröhren.
Blick in einen historischen Arbeitsplatz des Archivs.
Plakat mit „Meilensteinen auf dem Entwicklungsweg des Hornyphon-Geräts“. Hornyphon war der Markenname eines Radiowerks in Österreich.
Historischer Innenraum in der Österreichischen Mediathek. -
Flakturm als Kletterparadies.
-
Volksgarten mit Blick auf die Hofburg, hinten ein Denkmal für Franz Grillparzer. Die Parkanlage entstand ab 1819 zusammen mit dem Burggarten, nachdem Napoleon die Burgbasteien sprengen ließ. Hier an der Parkseite an der Ringstraße, handelt es sich um einen französischen, im Barockstil angelegten Garten, also ein eher strenger Plangarten.
Brunnen, im Hintergrund Denkmal für Franz Grillparzer.
Stockente mit Küken.
Nebelkrähe am Teich.
In der Mitte steht der Theseustempel. Er entstand 1819-1823 nach einem Entwurf vom Hofbaumeister Peter von Nobile (1774-1854). Es handelt sich um eine Nachbildung des 449 v. Chr. gebauten Athener Tempels des Hephaistos. In ihm stand die vom italienischen Bildhauer Antonio Canova (1757-1822) geschaffene Theseusstatue, die heute im Treppenhaus des Kunsthistorischen Museums steht.
1907 entstand das Denkmal für Kaiserin Elisabeth, von Hans Bitterlich (1860-1949) und Friedrich Ohmann (1858-1927). In Hintergrund das Burgtheater.
Auf der Seite der Hofburg Richtung Heldenplatz ist der Volksgarten mit lockerem Baumbestand eher im Stil eines englischen Parks angelegt. -
Plan der Hofburg. Der aus 18 Gebäuden bestehende Komplex blickt auf eine 700-jährige Baugeschichte zurück.
Links der Volkgarten, rechts der Burggarten. Ganz unten der Maria-Theresia-Platz mit den Zwillingsbauten von Kunsthistorischem- und Naturhistorischem Museum. In der Mitte der Heldenplatz. Rechts spannt sich im großen Bogen die Neue Hofburg. Hier befinden sich verschiedene Museen und Teile der Österreichischen Nationalbibliothek. Nr. 5 bezeichnet den Festsaaltrakt. Der dreieckige Gebäudekomplex oben rechts ist die Albertina, Österreichs am meisten besuchtes Museum. Links daneben am Josefsplatz gelegen die Nationalbibliothek mit dem Prunksaal (Nr. 12). Wieder links daneben die beiden Höfe der Stallburg und der Sommerreitschule. Der kleine Hof darunter ist der Schweizerhof mit den Zugängen zu den Schatzkammern. Dieser Bereich wird auch die Alte Hofburg genannt (Nr. 3 + 4). Oben der Michaelerplatz mit dem Durchgang in den großen Burghof mit dem links liegenden Amalienhof und dem Leopoldinischen Trakt, der die Hofburg zum Volksgarten abgrenzt. -
Der Heldenplatz hieß ursprünglich Paradeplatz. Nach Errichtung der beiden flankierenden Denkmäler für den Türkensieger Prinz Eugen von Savoyen und dem hier zu sehenden Aspernsieger Erzherzog Karl, nannte man ihn Heldenplatz.
-
Neue Hofburg: Die Architekten Carl von Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879) lieferten die Entwürfe für ein gewaltiges Kaiserforum. Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916).genehmigte jedoch nur den Bau eines neuen Flügels, sodass der Gesamtplan nie zur Ausführung kam. 1881-1913 erbaut. Denkmal von Prinz Eugen, dem Türkensieger von Anton Dominik von Fernkorn (1813-1878).
Doppeladler des Kaiserreichs Österreich.Andenken, Porzellanfiguren mit Motiven von Gustav Klimt.
Andenken zum Thema Kaiserin Elisabeth = Sisi.
-
Innerer Burghof, ehemaliger Franzensplatz: die kaiserliche Burg war mehr als 6 Jahrhunderte Residenz der Herrscher Österreichs. Es ist eine Stadt in der Stadt. Hier der Durchgang durch den Reichskanzleitrakt zum Michaelertrakt mit seiner charakteristischen Kuppel. Rechts die Fassade der alten Burg. Die 2 Wappenlöwen vorne rechts, aus dem 18. Jahrhundert kennzeichnen den Bereich, wo sich einst die Zugbrücke befand.
-
Die alte Burg (auf dem Plan Nr. 3 +4) geht auf den böhmischen König Ottokar II. Przemysl (1233-1278) zurück. Die damals 4-türmige Burg, die gleichzeitig die Stadtbefestigung verstärkte, bildet den heute Schweizertrakt genannten historischen Kern der Wiener Hofburg. Der Name erinnert an die Schweizergarde, die hier einst Wache stand (zur Zeit Maria Theresias). Urkundlich belegt ist dieser Teil seit 1279. Als Ferdinand I. (1503-1564)(der Bruder von Kaiser Karl V.) die Anlage 1547-1552 in ein Renaissance-Schloss umbauen ließ, entstand auch das Schweizertor. Es zählt zu den bedeutendsten Renaissance-Denkmälern Wiens und wurde 1551 von Pietro Ferabosco (1512-1599) gestaltet. Das Wappen zeigt die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. Es zeigt den einköpfigen Adler, da Ferdinand zu dieser Zeit noch nicht Kaiser war. Die Tordurchfahrt hat Deckenfresken aus dem Jahre 1553. Sie zeigen die Wappen der zum damaligen Österreich gehörenden Gebiete.
Schweizertor vom Schweizerhof aus gesehen.
Im Hof der alten Burg, dem sogenannten Schweizerhof, liegt der Zugang zur Burgkapelle. Hier auch die sogenannte Botschafterstiege, über die seit Kaiser Karl VI. (1685-1740) Botschafter die Zeremonialräume für festliche Empfänge erreichten. -
Zurück im inneren Burghof bzw. ehemaligem Franzensplatz, mit dem Reichskanzleitrakt. Der Hof ist mit 7.700 qm der größte Hof in der Burg. Erst nach erfolgreicher Abwehr der Osmanen im Jahre 1683 entschloss man sich, die Hofburg von einer Festung in einen kaiserlichen Palast umzubauen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts stand hier ein schmuckloser Kanzleitrakt, der die Hofburg zur Stadt abgrenzte. Mit dem Neubau des Reichskanzleitrakts durch Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) nahm Kaiser Karl VI. den barocken Ausbau der Hofburg in Angriff. Die Fassade zum Hof wurde von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) gestaltet.
4 Skulpturengruppen erzählen die Geschichte von Herakles. Sie wurden vom italienischen Bildhauer Lorenzo Mattielli (1687-1748) geschaffen. Hier befand sich früher u.a. die Verwaltungsbehörde des Heiligen Römischen Reiches, bis 1902 das Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Nach Auflösung des Heiligen Römischen Reiches durch Kaiser Franz I. (1708-1765) wurde ein Teil der Räume in kaiserliche Appartements umgewandelt. Zuletzt bewohnte sie Kaiser Franz Joseph I.
In der Mitte des Reichskanzleitraktes, liegt das Kaisertor. Davor in der Mitte des Platzes ein Denkmal von Kaiser Franz I.
Tür des Kaisertors mit den Insignien des Reiches als Verzierung aus Metall oben an der Tür.
Oben am Dach das vergoldete Wappenschild Kaiser Karls IV. zu sehen. Es zeigt das Wappen Österreichs und Kastiliens, da Karl in Spanien aufwuchs. Erst nach dem spanischen Erbfolgekrieg fiel Spanien an die Bourbonen.Weiter links eine weiterer prächtiger Durchgang, flankiert von Statuen „Herakles und der kretische Stier“, sowie „Herakles und der nemeische Löwe“.
Darüber ein Balkon mit stützenden Halbfiguren, Männer mit Krone, die ein Flachrelief mit der Göttin Fortuna halten.
In der Mitte des Platzes ein Denkmal von Kaiser Franz I. 1842-1864 von Pompeo Marchesi (1789-1858) geschaffen. Die 4 Statuen, die das Denkmal umgeben, symbolisieren Glauben, Stärke, Frieden und Gerechtigkeit. Im Hintergrund die zum Hof liegende Fassade der Amalienburg. -
Dahinter die von 1575-1611 erbaute Amalienburg, die ursprünglich ohne architektonische Verbindung der mittelalterlichen Burg gegenüberstand. Er war für Erzherzog Ernst (1553-1595), den jüngeren Bruder Kaiser Rudolfs II. errichtet worden und erhielt erst im 18. Jahrhundert seinen heutigen Namen. Zwischen 1711 und 1742 residierte hier Kaiserin Wilhelmine Amalie (1673-1742), die Witwe Josephs I. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte hier im 1. Stock Kaiserin Elisabeth (Sisi) ihre Räume. Auf dem Dach ein Türmchen mit welscher Haubem, an der Fassade eine astronomische Uhr und eine Sonnenuhr.
Durchgang zum Michealertrakt. Bis 1888 stand hier das Hofburgtheater. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Hofburg nun eine neue offizielle Zufahrt zu den kaiserlichen Wohnappartements.
Die Figuren in den Nischen symbolisieren kaiserliche Wahlsprüche:
Für Karl VI. „Constantia et fortitudine“ = „Mit Beständigkeit und Kraft“.
Für Maria Theresia „Justitia et clementia“ = „Mit Gerechtigkeit und Güte“.
Für Joseph II. „Virtute et exemplo“ = „Mit Kraft und Beispiel“.
Für Franz Joseph I. „Viribus unitis“ = „Mit vereinten Kräften“.
Die Michaelerkuppel wölbt sich dort, wo einst der Kaiser aus der Kutsche ausstieg.
Blick in die 54 m hohe Kuppel.Im Vorraum römische Kaiser.
-
Durch das Michaelertor kommt man zum Michaelerplatz mit der Michaelerkirche. In der Mitte des Platzes bei Grabungen gefundene Fundamente der römischen Lagervorstadt. Der Platz war nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) als barockes Gesamtensemble gedacht, ist aber nie zur vollständigen Ausführung gekommen. Die Fassade wurde erst 1893 von Ferdinand von Kirschner (1821-1896) nach Plänen Fischer von Erlachs realisiert. Der Skulpturenschmuck sollte die Macht und den Ruhm des Hauses Habsburg darstellen. Die Kuppel ist 54 m hoch. Die beiden Seiten der Durchfahrt sind von Herkulesstatuen flankiert, die den Herkules-Zyklus im inneren Burghof fortsetzen. Den Giebel krönen Allegorien der Weisheit, Gerechtigkeit und Stärke.
An den Seiten jeweils ein großer Wandbrunnen. Links z.B. „Österreichs Herrschermacht zur See“. -
Michaelerkirche: Salvatorianerkirche St. Michael ist die ehemalige Hofpfarrkirche des Kaiserhauses, gleichzeitig Grabeskirche bedeutender Österreicher. Dreischiffige spätromanische Pfeilerbasilika. Durch die Jahrhunderte wurde sie immer wieder dem Zeitgeschmack angepasst. Zuletzt 1724-25 eine barocke Portalvorhalle angefügt. Spätbarocker Hochaltar (1781) von Jean Baptiste d’Avrange. Stuckplastik mit Engelssturz von Karl Georg Merville. Ein Werk stilistisch im Übergang zum Klassizismus. Reste spätromanischer Fresken in der Turmkapelle.
-
Belvedere: Sommerresidenz des Türkenbezwingers Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736). Vorbild war Versailles. Hauptwerk des bedeutenden Barockarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). 1716 war das Untere Belvedere, das eigentliche Wohnschloss des Prinzen, vollendet. 1724 wurde das Obere Belvedere, das Repräsentationsschloss auf der Anhöhe, feierlich eingeweiht. Heute ist es ein Museum mit der weltweit größten Sammlung von Klimt-Werken.
Plan des BelvederePortrait von Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736) von Jacob van Schuppen. Das Bild hängt als Dauerleihgabe des Amsterdamer Rijksmuseum im Wiener Belvedere.
Haupttor zum Oberen Belvedere mit Löwen, die das Wappen des Prinzen von Savoyen tragen.
Vor dem Oberen Belvedere liegt ein großes Wasserbecken.Im Oberen Belvedere ist 1896 Anton Bruckner verstorben. Der Kaiser hatte den pensionierten Hoforganisten und Komponisten eine Wohnung ehrenhalber zur Verfügung gestellt. 1894-1914 wohnte der später ermordete Thronfolger Franz Ferdinand im Belvedere.
Dem zentralen Mittelbau sind das Treppenhaus und ein Vestibül mit schwingenden Segmentgiebeln vorgesetzt. Die beiden Flügel enden jeweils in 2 achteckigen Pavillons.
Inneres des Oberen Belvedere: Sala terrena, der Zugang zum imposanten Treppenhaus. Atlanten tragen das Gewölbe.
Erdgeschoss: spätgotische Bildhauerkunst
Deckengemälde
Werke von Michael Pacher (1435-1498): Geißelung Christi und Vermählung Mariens.
Papst Sixtus II. nimmt Abschied vom Hl. Laurentius, der Hl. Laurentius vor Kaiser Decius.
Treppenhaus
Marmorsaal bzw. Prunksaal: Hier wurde am 15.5.1955 von den Außenministern der vier Alliierten und Österreichs der Staatsvertrag unterschrieben, der Österreich die volle Souveränität zurückgab. Der Marmor ist sowohl Kunstmarmor, als auch Adneter Marmor. Das Deckengemälde stammt von Carlo Innocenzo Carlone (1686-1775). Die gemalte Scheinarchitektur wird Marcantonio Chiarini (1652-1730) zugeschrieben.
Oberes und unteres Belvedere sind durch einen prächtigen Barockgarten verbunden. Er ist der älteste Teil der Anlage und entstand um 1700, gleich nach dem Kauf des Grundstücks. Angelegt wurde er zwischen 1700 – 1725 von Dominique Girard (ca. 1680-1738), einem Schüler von André Le Nôtre (1613-1700). Es ist ein Terrassengarten mit Kaskaden, symmetrischen Treppen und seitlich begrenzenden Hecken und Alleen.
Blick auf Wien und die Höhenzüge des Wienerwalds. Davor das untere Belvedere.
Deckengemälde.
Dekoration und Stuckaturen an den Decken.
Schlosskapelle
Gemälde von Rudolf von Alt: der Stephansdom
Max Oppenheimer: Die Philharmoniker. Es zeigt Gustav Mahler als Dirigenten der Wiener Philharmoniker. 5 – 3 m
Unten im Garten wieder der Blick auf die Kuppel vom Salesianerkloster, Statuen von Sphingen.
Sphinx, hier ohne Flügel.
Blick zurück auf die Gartenseite des oberen Belvedere.
Blick über den Kaskadenbrunnen zum Unteren Belvedere.
Kaskadenbrunnen
Blick zurück auf die Gartenseite des oberen Belvedere mit dem Kaskadenbrunnen im Vordergrund.
An einer der Treppen, die zum 23 m tiefer liegenden Unteren Belvedere führen. Im Hintergrund wieder die Kuppel der Salesianerkirche.
Blick über Blumenbeete im Barockparterre auf das hinten liegende Obere Belvedere.
Blick über den Muschelbrunnen zum Unteren Belvedere.
Sphinx.
Muschelbrunnen. In seiner Mitte halten Tritonen ein, wie eine Muschel geformtes Becken.Unteres Belvedere: 1694–1697 als „Lustgebäude“ errichtet, gelang es mit dem Kauf des Grundstücks in den Besitz von Prinz Eugen. Dieser beauftrage den Architekten Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745), der es 1714-1716 zum Unteren Belvedere umbaute. Prinz Eugen pflegte dann im Sommer hier zu wohnen. Prinz Eugen hatte die Genehmigung erhalten, die kaiserliche Hofwasserleitung mit zu benutzen und ließ zahlreiche Brunnen installieren.
Inneres des Unteren Belvedere:
Marmorgalerie von Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Wurde höchstwahrscheinlich eigens zur Aufstellung der drei Herculanerinnen geplant. Die antiken Statuen waren in der zweiten, vierten und sechsten Nische aufgestellt, während die übrigen, weitaus stärker bewegten Figuren Werke des Barockbildhauers Domenico Parodi (1672-1742) sind. An den Wänden aus Stuck Kriegstrophäen. Sie verweisen auf die militärischen Erfolge des Prinzen Eugen, dessen Apotheose in den Stuckreliefs an der Decke dargestellt wird. Er thront gerüstet im Mittelfeld und empfängt Auszeichnungen, während der Friede naht und Neid sowie Hass vertrieben werden.
Goldkabinett. Ursprünglich befand sich im Anschluss an die Marmorgalerie ein Konversationszimmer mit einer Wandbespannung aus mit Zweigen und Vögeln bemalter Seide. Unter Maria Theresia erfolgte im Zuge der Adaptierungen des Unteren Belvedere auch die Umgestaltung dieses Raumes zum Goldkabinett (bzw. Spiegel- und Porzellankabinett). Die Bestandteile hierfür stammen aus dem Stadtpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse und wurden für das Untere Belvedere entsprechend ergänzt. Es ist anzunehmen, dass sich das Goldkabinett bereits 1765 in seiner neuen Erscheinung präsentierte.
Chinesischer Schrank mit goldener Malerei auf schwarzem Lack.Kammergarten: der Privatgarten von Prinz Eugen liegt westliche des Unteren Belvedere.
Groteskensaal: hier befindet sich heute das Museumsshop. Der Augsburger Jonas Drentwett (1656-1736) hat an der Decke die vier Jahreszeiten und in den Ecken die vier Elemente dargestellt. Die fensterlosen Wände zeigen die „Schmiede des Vulkan“ sowie die drei Grazien, eine symbolische Gegenüberstellung des Männlichen und des Weiblichen. Die Malereien sind größtenteils original erhalten.
2-stöckiger Marmorsaal: Er diente dem Empfang von Gästen. Die Wandgliederung ist der Triumphbogenarchitektur entlehnt und verweist mit Kriegstrophäen und Gefangenen auf Prinz Eugens große Erfolge als kaiserlicher Oberbefehlshaber. Von den schöngeistigen Interessen des Prinzen, zeugen die Themen in den ovalen Gipsmedaillons. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Apolls. Das Deckenfresko von Martino Altomonte (1657-1745) zeigt Apoll im Sonnenwagen. Hier erhält Prinz Eugen, dargestellt als nackter Heros von Merkur die Kunde von der Verleihung der päpstlichen Ehrengaben überbracht.
Apotheose des Prinzen Eugen von Balthasar Permoser (1651-1732). Marmor 1718-21, 2,30 m hoch.
Gemälde von Hans Makart (1840-1884):Karl Meditz (1868-1945): Roter Engel, 1902
Luigi Bonazza (1877-1965): Orpheus und Euridice, Tryptichon, 1905
Max Klinger (1857-1920): Urteil des Paris. 4,80 x 2,46 m, 1885-87 -
Kirche Mariä Heimsuchung oder Salesianerinnenkirche: Kirche vom Kloster der Salesianerinnen. Am Ehrenportal Kartusche mit dem Wappen der Kaiserin Amalia Wilhelmine (1673-1742). Das Kloster wurde von Amalia Wilhelmine, der Witwe Kaiser Joseph I., gestiftet. Die Kaiserin wollte darin ihren Lebensabend verbringen und eine Bildungsstätte für junge Mädchen aus Adel und gehobenem Bürgertum bieten. 1717-19
-
Geburtshaus von Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) in der Salesianergasse.
-
Wiener Stadtpark: er ist in zwei Teile geteilt durch den Wienfluss. 65.000 qm, 1857 durch Franz Joseph I. angeregt. Landschaftsgärtner Rudolf Siebeck (1812-1878) setzte die Skizzen des Landschaftsmalers Joseph Selleny (1824-1875) in die Wirklichkeit um.
Brücke über den Wienfluss.
Kermesbeere.
Küken einer Stockente.
Im innenstadtnahen Teil des Parks stehen zahlreiche Denkmäler für Maler und Komponisten. Das berühmteste dürfte das Denkmal für Johann Strauss (Sohn) sein, in der damaligen Schreibweise Johann Strauß. Es stammt von Edmund Hellmer (1850-1935) und ist umrahmt von einem Bogen aus Marmor mit Reliefs. 1921 wurde es enthüllt, im Beisein der Wiener Philharmoniker. An vielen Orten der Welt gibt es Kopien dieses Denkmals. -
Ronacher: Erbaut ursprünglich 1871-1872 als Wiener Stadttheater von den Architekten Ferdinand Fellner der Ältere (1815-1871) und Ferdinand Fellner der Jüngere (1847-1916). Es war als bürgerliches Theater gedacht, welches unabhängig von der Zensur, den kaiserlichen Hof-Theatern Konkurrenz machen sollte. Nach einem verheerenden Brand wurde es von Anton Ronacher gekauft und wieder aufgebaut. Heute ist es ein Musicaltheater.
-
Restaurant „Der Kuckuck“ in der Himmelpfortgasse mit außen stehenden Tischen und Namenschild aus Metall mit goldenem Kuckuck.
-
Portrait von Kaiser Franz Joseph I. und Elisabeth auf einem Stich.
Kärntnerstraße, Wiens bedeutendste Einkaufsstraße. Sie führt von der Staatsoper am Ring bis zum Stock-im-Eisen-Platz direkt am Stephansdom. Dieser Platz ist seit 1533 urkundlich erwähnt.
Schaufenster mit bunt bemaltem, geflügelten Penis
Schaufensterauslage des K. u. K. Hochzuckerbäckers. -
Direkt beim Dom ein moderner Bau mit Glas-, Quarzit- und Marmorfassade von Hans Hollein (1934-2014), einem Wiener Stararchitekten.
Direkt gegenüber der Stephansdom. -
Palais Equiable: zwischen Graben und Kärntnerstraße gelegen. Die kleinen mittelalterlichen Häuser die hier standen, wurden im 19. Jahrhundert abgerissen, um die Kärntnerstraße zu verbreitern. 1887-1891 ließ hier die New Yorker Lebensversicherungsanstalt „The Equitable Life Assurance Society of the United States“ nieder, daher der Name des repräsentativen Gebäudes. Es ist eins der wenigen Gebäude in Wien, die Palais genannt werden, obwohl es nie ein Adelssitz war. An der Hausecke (nicht erkennbar) ist der Stock-im-Eisen angebracht. Der Sage nach musste jeder wandernde Schlossergeselle einen Nagel in den Stamm schlagen.
Detail vom Dach mit einem amerikanischen Adler. Ganz oben ein Segelschiff, nach einer Restaurierung allerdings ohne Takelage. Es symbolisiert die weltumspannende Tätigkeit der Versicherungsanstalt.
Eingang mit Bronzereliefs und Statuen. Über dem Türsturz eine Darstellung der Sage vom Stock im Eisen, geschaffen von Rudolf Weyr (1847-1914). Die restlichen Statuen stammen von Viktor Tilgner (1844-1896) und Johann Schindler (1822-1893).
Haus aus dem 19. Jahrhundert, Spiegelgasse Ecke Graben. -
Pestsäule: Sie steht auf dem Graben, halb Straße, halb Platz, einst Wehrgraben des römischen Lagers. In der Mitte die 21 m hohe barocke Pestsäule, auch Dreifaltigkeitkeitssäule genannt. Ihre Entstehung verdankt sie einem Gelübte Kaiser Leopolds I. Wenn die 1679 in Wien wütende Pest vorüber wäre, wolle er eine himmelstrebende Säule stiften. Sie entstand von 1686-1693, begonnen von Mathias Rauchmiller (1645-1686), fortgesetzt von Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), vollendet von Lodovico Ottavio Burnacini (1636.1707).
Detail eines berankten Fensters mit Blumen.
-
Schloss Schönbrunn:
Plan, wobei hier Norden unten auf dem Plan liegt und die Gärten im Süden des Schlosses. Unten in der Mitte der Ehrenhof. Auf der linken Seite des Schlosses, neben dem Ehrenhof der Kronprinzengarten. Der Meidlinger Alleestern (Nr. 19) mit römischer Ruine (Nr. 12) und Taubenhaus (Nr. 14). Obeliskbrunnen (Nr. 13). Neptunbrunnen (Nr. 11). Oben in der Mitte (Nr. 25) ist die Gloriette. Rechts unterhalb des Zoos das Palmenhaus (Nr. 20).
Kaiserin Elisabeth von Österreich, auch genannt Sisi (1837-1898). Elisabeth stammte aus der Familie der Herzöge von Bayern. Sie war eine Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern und seiner Frau Ludovika Wilhelmine. 1854 heiratete sie im Alter von 16 Jahren den österreichischen Kaiser Franz Joseph von Österreich. Aus der Ehe gingen 4 Kinder hervor, 3 Mädchen und 1 Junge, der tragischerweise Selbstmord beging. Die Kaiserin selber fiel einem Attentat zum Opfer.
Auf dem Ehrenhof der Sommerresidenz der Habsburger. 1559 erwarb Kaiser Maximilian II. (1527-1576) hier ein Lustschlösschen. Sein Name geht auf einen Kaiser Matthias (1557-1619) zugeschriebenen Ausspruch zurück, der hier im Jahr 1619 auf der Jagd einen artesischen Brunnen „entdeckt“ und ausgerufen haben soll: „Welch’ schöner Brunn“. Erbaut 1638-43 für Kaiserin Eleonore Gonzaga (1598-1655), die Frau von Kaiser Ferdinand II. (1578-1637). Durch die Türkenbelagerung wurde es schwer beschädigt. Nach dem Sieg über die Türken, beauftrage Kaiser Leopold I. (1640-1705) 1696 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) mit dem Entwurf eines kaiserlichen Lustschlosses.
Das Barockschloss entstand ab 1696, von 1743-1749 richtete Nicolò Pacassi (1716-1790) und Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816) die Anlage für Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) her, so wie sie sich in seiner heutigen Form erhalten hat. Der Park ist 16 Hektar groß. Von 1814-15 tagte hier der Wiener Kongress. 1918 verzichtete hier der letzte österreichische Kaiser Karl I. (1887-1922) auf die Regentschaft. Seit 1996 ist es Weltkulturerbe der UNESCO.
Östlicher Ehrenhofbrunnen mit zwei männlichen Figuren mit Muschelschale, darunter weibliche Figuren und Putten. Der Brunnen wurde, ebenso wie der westliche Ehrenhofbrunnen, 1776 von den Bildhauern Johann Baptist Hagenauer von Hagenau (1732-1810) und Franz Anton Zauner (1746-1822) geschaffen. Im Hintergrund die Fassade des Schlosses und Freitreppe.
Kronprinzengarten: Der Kronprinzengarten als Teil der Meidlinger Kammergärten liegt unmittelbar vor der Ostfassade des Schlosses und erhielt um 1870 seinen Namen, nachdem Appartements für den Kronprinzen Rudolf (1858-1889) im Erdgeschoss eingerichtet wurden.
Laubengang
Blick vom Laubengang auf den etwas tiefer liegende Gartenbereich „Am Keller“. Es ist einer der ältesten Gartenteile in Schönbrunn. Er wurde um 1700 direkt über dem Keller der Hofküche angelegt.
Der Kronprinzengarten ist von einem Laubengang eingefasst mit Pavillons, von denen einer als Aussichtspavillon begehbar ist. Im Hintergrund die östliche Fassade des Schlosses.
Gartenbereich östlich der Zentralachse:
Meidlinger Alleestern mit Rundbassin und Najadengruppe. Im Hintergrund künstliche römische Ruine. Bei anderer Blickrichtung das Taubenhaus.
Der fast 2 qkm große Park gehört zu den bedeutendsten Barockgärten im französischen Stil. Jean Trehet (1654-1740) legte ihn 1705 nach einem Entwurf Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) an. Zwischen 1765 und 1780 wurde er überarbeitet von Adrian van Steckhoven (ca. 1705-1782) und Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1732-1816). Seitdem gibt es einige naturbelassene Bereiche.
Obeliskbrunnen, am Fuße des Schönbrunner Berges gelegen, bildet den optischen Akzent am Ende der östlichen Diagonalallee und neben der Gloriette und der Menagerie einen der wichtigsten Blickpunkte der Gartenachsen. Wie auch andere Gartenobjekte wurde diese Brunnenanlage von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg entworfen und laut Inschrift am Sockel des Obelisken im Jahre 1777 errichtet. Die bildhauerischen Arbeiten führte Benedikt Henrici (ca. 1749-1799), teilweise nach Entwürfen von Wilhelm Beyer (1725-1796), aus. Der Obelisk steht für fürstliche Standhaftigkeit. Er steht auf 4 Schildkröten, dem Symbol der Stabilität. Ihn krönt ein Adler auf der Sonnenkugel. Er konnte sich als einziges Lebewesen ohne Schaden der Sonne nähern, er symbolisiert den Herrscher als Vermittler zwischen Himmel und Erde. In der Mitte der Rückwand ein Grottenberg. Das Brunnenbecken wird von Flussgöttern bevölkert.
Römische Ruine: von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg entworfen und 1778 als Neubau errichtet. Es war als romantische Gartenkulisse gedacht und nicht als Ruine, zu der es im Laufe der Jahre durch mangelnde Pflege wurde. Vorbild war der römische Vespasian- und Titus-Tempel, wie er auf Stichen von Giovanni Battista Piranesi 1756 überliefert wurde. Im Wasserbecken davor eine Figurengruppe die Flüsse Donau und Enns symbolisierend. Forschungen ergaben, das tatsächlich alle Bauteile neu hergestellt wurden. Bereits vor der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden bereits in England solche Ruinenbauwerke erschaffen. Erst Jahrzehnte später fanden sie in Europa weitere Verbreitung.
Grosses Parterre: Die Mittelachse einer Schlossanlage sollte das „Rückgrat“ des Gartens bilden, dessen Symmetrie von orthogonalen und diagonalen Achsen bestimmt war. Streng symmetrisch angelegte Beete, die mit Buchsbaum gegrenzt sind und mit bunten Steinen und Sand gestaltet wurden. Sie wurden meist inspiriert von Mustern für Stickereien. Daher auch der Name „Broderieparterres“. Seitlich schließen sich streng gestutzte Baum- und Heckenkulissen an, die mit versteckten Kammern versehen waren. Im Hintergrund die Gartenfassade des Schlosses.
Historische Abbildung der Gartenfassade mit großem Parterre.
Neptunbrunnen. Südliche Begrenzung des Parterres. Ebenfalls von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, von 1780. Figurengruppe aus Sterzinger Marmor von Wilhelm Beyer (1725-1796). Im Zentrum der Figurengruppe steht Neptun mit dem Dreizack in der Hand in einem Muschelwagen über einer Felsgrotte. Zu seiner Linken befindet sich eine Nymphe und zur Rechten kniet die Meeresgöttin Thetis. Sie bittet Neptun, die Seefahrt ihres Sohnes Achill zu begünstigen, der zur Eroberung Trojas aufgebrochen war.
Direkt hinter dem Neptunbrunnen steigt der Hügel zur Gloriette an. Grandioser Blick auf das Parterre und die Gartenfassade des Schlosses.
Gloriette: Klassizistische Säulenhalle, von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg 1775 als krönender Abschluss der Parkanlage konzipiert. Seitlich mächtige Trophäenstücke, Kompositionen aus antikisch-römischen Rüstungen mit Schilden, Feldzeichen und Löwen, die vom Bildhauer Johann Baptist Hagenauer (1732-1810) geschaffen wurden. Ehemaliges Sommerspeisezimmer des Kaisers mit Kuppeldecke.
Blick von der Gloriette auf das Schloss und Wien.
Graureiher in dem Wasserbecken vor der Gloriette.
Zurück Richtung Gartenfassade des Schlosses mit Blick auf die Gloriette und den Neptunbrunnen am Ende des Parterres.
Das Palmenhaus befindet sich auf dem Areal des ehemaligen Holländischen Gartens, ganz im Westen des Schlossgartens, unterhalb des in den Garten integrierten Tiergartens. Es wurde in den Jahren 1881/82 nach Plänen Franz Xaver Segenschmid (1839-1888) errichtet. Das 113 Meter lange Palmenhaus besteht aus einem 28 Meter hohen Mittelpavillon und zwei, um drei Meter niedrigeren Seitenpavillons. Die drei Pavillons sind durch tunnelartige Gänge miteinander verbunden und bilden drei verschiedene Klimazonen. Die jeweils erforderlichen Temperaturen werden mittels Dampfwasserheizung erzielt. Imposante, dem Späthistorismus verpflichtete Eisenkonstruktion.
Maria-Hietzing: eine Kirche, direkt neben der Gartenmauer im Westen, war die Lieblingskirche von Maria Theresia.
Inneres des Schlosses:
Stammbäume der Habsburger
Nußholzzimmer: Audienzzimmer von Kaiser Franz Joseph. Im Westtrakt des Schlosses gelegen. Bereits 1765 entstand es als Audienzzimmer im Stil des Rokoko, für Joseph II. als Mitregent seiner Mutter Maria Theresia. wurde bereits um 1765 mit der namengebenden Nussholzvertäfelung als Audienzzimmer für Joseph II. als Mitregent seiner Mutter Maria Theresia ausgestattet.
Arbeits- oder Schreibzimmer von Franz Joseph: im Gegensatz zum Audienzzimmer ist es eher schlicht gehalten. Portraits des Kaiserpaares von Franz Ruß dem Älteren (1817-1892) aus dem Jahr 1863.
Franz Joseph an seinem Schreibtisch, an dem er täglich die Korrespondenz erledigte und Akten bearbeitete. Er war ein sehr disziplinierter Mensch und der Tagesablauf war streng durchorganisiert.
Marie Antoinette-Zimmer: es wurde als zur Zeit Kaiser Franz Josephs als Speisezimmer für die Familie genutzt. Seinen Namen erhielt das Zimmer von einem Gobelin, der bis zum Ende der Monarchie in diesem Raum hing. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Porträt, das Franz Joseph als jungen Kaiser zeigt.
Große Galerie, 43 x fast 10 Meter groß. Zentraler Festsaal im Schloss und architektonischer Mittelpunkt im Schloss.
Deckenfresko von Gregorio Guglielmi (1714-1773). Im Zentrum Maria Theresia als Herrscherin über die Habsburgermonarchie und ihr Mann Franz Stephan als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Umringt von Personifikationen der Herrschertugenden.
Ovales und rundes chinesisches Lackkabinett. Chinesische Lacktafeln sind in die weiße Holzvertäfelung eingelassen. Auf kleinen Konsolen werden Objekte aus chinesischem Porzellan präsentiert. Fußboden mit reicher Dekoration aus Intarsien.
Blauer chinesischer Salon: 1806 mit chinesischen Reispapiertapeten ausgestattet. Blaue Medaillons in gelben Tapetenbahnen, zeigen chinesische Motive und sind eingerahmt von Blumen, Vögeln und Schmetterlingen. Hier begannen einst die Privatgemächer von Kaiser Franz I. (1708-1765), dem Ehemann von Maria Theresia. Hier unterzeichnete 1918 Karl I. (1887-1922) die Verzichtserklärung.Vieux-Laque-Zimmer: Luxuriöses Privatgemach der Kaiserin Maria Theresia (1717-1780). Nach dem Tode ihres geliebten Gatten Franz Stephan, legte Maria Theresia die Witwentracht nie mehr ab und gestaltete dieses Zimmer als Gedächtnisraum. Er gehört zu den kunsthistorisch bedeutendsten Räumen im Schloss. Der Name des Raumes bezieht sich auf die schwarz-goldenen chinesischen Lacktafeln. In der Mitte des Raumes ein Porträt von Kaiser Franz I., daneben ein Doppelporträt des ältesten Sohns Joseph und dessen jüngeren Bruder Leopold.
Porzellanzimmer: Im Appartement Maria Theresias im Osttrakt des Schlosses. Ausgestattet 1763/64 mit blau-weiß lackierten Holzgirlanden, die eine Raumverkleidung aus echtem Porzellan vortäuscht. Die 213 blauen Tuschezeichnungen stammen von Kaaiser Franz I. und einigen seiner künstlerisch begabten Kinder.
Millionenzimmer: Maria Theresias Privatsalon, erhielt seinen Namen aufgrund der exotischen Wandvertäfelung aus Rosenholzarten. In die Vertäfelung sind indo-persische Miniaturen eingelassen, die in Rokoko-Goldrahmen gefasst sind. Ursprünglich für das Belvedere angefertigt, wurde es 1766 nach Schönbrunn übertragen.
Gemälde von Martin van Meytens (1695-1770), 1754. Maria Theresia und Franz Stephan mit ihren Kindern. Bei der Kaiserin stehen ihre beiden ältesten Söhne, die späteren Kaiser Joseph II. (1741-1790) und Leopold II. (1747-1792).
-
Servitenkirche 16151-1677 unter der Bauführung von Carlo Canevale (1625-1690) erbaut. Sie wurde zum architektonischen Vorbild zahlreicher späterer Barockkirchen.
-
Schillerdenkmal auf dem ehemaligen Kalkmarkt, jetzt Schillerplatz, vor der Akademie der Bildenden Künste. Im Sockel befindet sich eine Haarlocke Schillers. An den Ecken des Granitsockels sitzende Figuren, die die vier Lebensalter aus Schillers Gedicht „Das Lied von der Glocke“ darstellen.
-
Akademie der Bildenden Künste: Im Kontext mit dem Bau der Ringstraße, wurde 1871 auch der Neubau der Akademie genehmigt. Architekt war Theophil Edvard von Hansen (1813-1891), der Leiter der Spezialschule für Architektur an der Akademie. Erbaut im Stil der italienischen Renaissance. Fast alle Baumeister der Ringstraße waren Professoren an der Akademie. Auch Friedensreich Hundertwasser, Egon Schiele, Moritz von Schwind etc. studierten hier.
Inneres:
Überwölbter Flur
Aula, 450 qm groß. Das Deckengemälde von 1875-80, zeigt den Titanensturz von Anselm Feuerbach (1829-1880). Der Raum kann heute für Veranstaltungen gemietet werden. -
Ausstellungsgebäude der Wiener Sezession: Das Secessionsgebäude hat eine Kuppel aus goldenen Lorbeerblättern, von den Wienern „Krauthappl“ genannt. 1897/98 von Josef Maria Olbrich (1867-1908) fertiggestellt. Es war das erste epochemachende Gebäude des Wiener Jugendstils, des „Secessionsstils“. Der Bau wurde notwendig, weil sich 1892 eine Vereinigung junger Künstler unter der Führung von Gustav Klimt (1862-1918) vom konservativen Verband des Kunsthauses abtrennte.
Detail der Kuppel.
An den Seitenfassaden je 3 Eulen, die von Koloman Moser (1868-1918) entworfen wurden.
Florale Motive an den Außenwänden.
Eingang. Unterhalb der Kuppel sieht man den Wahlspruch der Secession: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“ von Ludwig Hevesi (1843-1910). Neben der bronzenen Eingangstür von Georg Klimt (1867-1931), dem Bruder von Gustav Klimt, der Spruch „Ver Sacrum“, der Heiliger Frühling bedeutet und der Hoffnung auf eine neue Kunstblüte Ausdruck verleihen soll.
Eine Treppe führt zum Eingang, an den Seiten Mosaikschalen von Robert Oerley (1876-1945).
Die Gorgonen über der Tür stammen von Othmar Schimkowitz (1864-1947).
An der Ostseite eine bronzene Statue des Marc Anton oder Marcus Antonius, in einem von Löwen gezogenen Triumphwagen. Die Statue stammt von Arthur Strasser (1854-1927). Die Skulptur wurde 1900 bei der Pariser Weltausstellung gezeigt. -
Naschmarkt: ursprüngliche Bezeichnung „Aschenmarkt“. 2 Varianten als Erklärung: frühere Deponie für Asche, außerdem war „Asch“ die übliche Bezeichnung für den aus Eschenholz gefertigten „Milcheimer“. Die Bezeichnung Naschmarkt setzte sich nach und nach durch, vielleicht durch die Verballhornung der ursprünglichen Bezeichnung. 1780 Verlegung des „Kärntnertor-Marktes“ an diese Stelle. Ab 1820 erste Belege für die Bezeichnung „Naschmarkt“.
Verschiedene Stände mit Gewürzen, Obst, Gemüse, Blumen.
Bio-Schokolade „Labooko“ in künstlerisch gestalteten Verpackungen.
Tee und Teekannen.
Mediterrane Vorspeisen
Stand mit Kaffee von Gegenbauer.
Kleine Fässer mit verschiedenen Sorten Essig.
Automat mit Ohrstöpseln. -
Bibliothek der Technischen Universität: Erbaut 1984-87 nach Plänen der Architekten Justus Dahinden (1925-2020), Reinhard Gieselmann (1925-2013), Alexander Marchart (1927-) und Roland Moebius (1929-2020). An der Ecke des Gebäudes eine rund 18 m hohe Statue und an den Außenwänden 16 kleinere Eulenstatuen von Bruno Weber (1931-2011). Die Statuen wurden vor Ort in einem Gussverfahren hergestellt. Die Statue an der Ecke hat den Brustkorb eines Menschen, den Kopf eines Adlers und ausgebreitete Flügel. Mit den Klauen eines Adlers steht es auf einer Kugel.
- Stadtbahnstation am Karlsplatz von Otto Wagner (1841-1918), 1898, Jugendstil. Die beiden Pavillons in Sichtachse der Karlskirche sollten im Zuge des U-Bahnbaus abgerissen werden. Erst ein Sitzstreik der TU-Studenten konnte den Verlust dieser revolutionären Werke Wagners verhindern.
Stand auf Rädern mit Eis. - Karlskirche: Sie liegt an der Südseite vom Karlsplatz und ist einer der bedeutendsten barocken Kirchen nördlich der Alpen. Zwischen Kirche und Karlsplatz liegt der Resselpark und direkt vor der Kirche ein Teich. Im Teich vor der Kirche steht die Skulptur „Hill Arches“ von Henry Moore (1898-1986).
Bei der letzten großen Pestepidemien 1713, gelobte Kaiser Karl VI. (1685-1740) eine Kirche bauen zu lassen, die seinem Namenspatron und Pestheiligen Karl Borromäus geweiht werden sollte. Als 1714 die Epidemie erloschen war, wurde nach einem Architekturwettbewerb Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) ausgewählt. Nach dem Tod von Johann Bernhard Fischer 1723, führte sein Sohn Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) bis 1739 den Bau fort.
Architektonisch sollte sie eine Brücke zwischen Byzanz, der Hagia Sophia, und Rom mit der imitierten Trajanssäule herstellen.
Die Fassade mit dem davor gestalteten griechischen Tempelportikus ist von Andrea Palladio (1508-1580) beeinflusst. Über dem Kirchensaal eine Kuppel mit 25 m Durchmesser und 72 m Höhe. Ganz außen stehen die von Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) und Maderna inspirierten Glockentürme.
Zwei Triumphsäulen mit 33 m Höhe. Spiralförmig zeigen Reliefs Szenen aus dem Leben des Heiligen Karl Borromäus, sollen aber auch die kaiserliche Macht symbolisieren und eine Analogie zu den Säulen des Herakles herstellen. Die Reliefs stammen von den Bildhauern Johann Baptist Mader, Johann Baptist Straub (1704-1784) und Jakob Christoph Schletterer (1699-1774).
Inneres:
Der Grundriss hat die Form eines Längsoval mit einem hohen Tambour, Kuppel und Laterne.
Thema des Hochaltars ist die Aufnahme des Heiligen Karl Borromäus in den Himmel. Die plastische Wolkendekoration hinter dem emporschwebenden Kirchenfürsten geht auf einen Entwurf Johann Bernhad Fischers von Erlach (1656-1723) zurück, ausgeführt von Camesina. Rechts und links vom Hochaltar die Logen für den kaiserlichen Hof.
Über dem Eingang die Barock-Orgel, deren Erbauer unbekannt ist. Darüber ein Deckenfresko von Johann Michael Rottmayr (1654-1730). Hl. Cäcilie mit Engeln.
Die Kuppelfresken stammen ebenfalls von Johann Michal Rottmayr und sind von 1725 – 1730 entstanden. Sie zeigen die Glorie des Heiligen Karl Borromäus und die Fürbitte um Abwendung der Pest.
Ein Engel steckt die zu Boden gefallene Bibel Luthers mit einer Fackel an.
Göttliche Tugend Hoffnung mit dem Anker.
Tugend Liebe
Göttliche Tugend Glaube
Heiliger Karl Borromäus mit Maria unterhalb von Jesus und Gottvater
Heiliger Geist ganz oben
Historischer Laden für Kronleuchter und Kristallgläser in der Kärntnerstraße. - Fassade der Malteserkirche an der Kärntnerstrasse gelegen. Wahrscheinlich im 14. Jahrhundert erbaut und 1806-1808 klassizistisch umgestaltet.
- Kapuzinergruft oder Kaisergruft: sie befindet sich unter der Kapuzinerkirche des Kapuzinerklosters am Neuen Markt (früher Mehlmarkt). Kaiserin Anna (1585-1618), die Frau von Kaiser Matthias (1557-1619), verfügte den Bau der Gruft. Baubeginn war dann 1622 unter seinem Nachfolger Ferdinand II. (1578-1637). Die Gruft wurde 8 mal erweitert. 49 Mitglieder des habsburgischen Herrscherhauses, davon 12 Kaiser, 19 Kaiserinnen und Königinnen, haben seit 1633 hier ihre letzte Ruhe gefunden. Allerdings liegen hier nur die einbalsamierten Körper, die Herzen befinden sich in der Augustinerkirche, die Eingeweide in den Katakomben vom Stephansdom. Kaiser Matthias und seine Frau Kaiserin Anna, waren die ersten Habsburger, die in diese Kaisergruft überführt wurden.
Särge in der Leopoldsgruft:
Kaiserin Margarita Teresa von Spanien (1651-1673). 1. Frau von Kaiser Leopold I., Tochter von König Philipp IV und Maria Anna von Österreich. Berühmt wurde sie durch ihre Jugendbildnisse von Velasquez. Schwester von dem durch Inzucht so kranken Kaiser Karl II.
Kaiserin Eleonora Magdalena von der Pfalz-Neuburg (1655-1720), 3. Frau von Kaiser Leopold I. Mutter von Kaiser Joseph I. und Karl VI. Der Bleisarkophag, in welchem sie ruht, wurde erst von ihrer Enkelin Kaiserin Maria Theresia in Auftrag gegeben. Die Wappen Ungarns, Böhmens, Österreichs und Ungarns, sowie der Erzherzogshut und die Kaiserkrone zieren den Sarkophag, der auf Adlern mit ausgebreiteten Flügeln ruht.
Kaiser Leopold I. (1640-1705), der „Türkenpoldl“, da unter seiner Regierung die Türken endgültig besiegt wurden (Prinz Eugen). Er war von fast grotesker Hässlichkeit, Habsburger-Lippe und das vorspringende Kinn, waren bei ihm besonders stark ausgeprägt. Der Sarkophag ist ein Entwurf des Barockbaumeisters Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745). Er ist dekoriert mit Bandelwerk, Orgelpfeifen, einem Schwert und lorbeerumkränzten Totenköpfen. Auf dem Deckel liegt die Kaiserkrone, ein Kruzifix und ein auf einem Felsen stehender Adler.
Särge in der Karlsgruft:
Kaiserin Elisabeth Christine (1691-1750), Ehefrau von Karl VI. (ehemals Karl III von Spanien), Mutter von Kaiserin Maria Theresia. Die vier Seiten des Sarges schmücken Genienköpfe mit verhülltem Antlitz. Auf der Vorderseite ein Relief mit der Brautfahrt im Segelschiff nach Barcelona, da hier die Hochzeit mit dem ehemaligen spanischen König Karl III. stattfand. Erst als Karls Bruder Joseph I. starb, musste das Paar seine Herrschaft in Wien antreten. Auf dem Deckel hält ein Genius mit einem Putto das Bildnis der Kaiserin. Auf zwei Polstern ruhen die Rudolfskrone, die Krone von Kastilien, die ungarische und die böhmisch Königskrone.
Kaiser Karl VI. (1685-1740), Vater von Maria Theresia, der letzte Habsburger im Mannesstamm. Nach dem Tode des letzten spanischen Habsburgers Karls II., wurde er auf Grund des von Margarita Teresa (1. Gattin seines Vaters Leopold I.) ererbten Anrechts König Karl III. von Spanien. Nur 2 Töchter überlebten die Kinderjahre und so nahm er dieses zum Anlass, die „Pragmatische Sanktion“ 1713 in Kraft zu setzen. Dieses Hausgesetz sah die Unteilbarkeit und Untrennbarkeit aller habsburgischer Erbkönigreiche und Länder vor. Es war also jetzt möglich, dass auch Töchter den Thron erben konnten. Der Sarkophag ist prächtig geschmückt. Die trauernde Austria hält ein Portrait des Kaisers, das von einem Stern und einer Schlange gekrönt wird. Außerdem liegen auf Polstern die Zeichen der römischen Kaiserwürde und an den Ecken tragen Totenköpfe die jeweiligen Reichskronen. Auf der Vorderseite ein Relief mit der Schlacht von Saragossa. Darunter auf den ausgebreiteten Schwingen eines Adlers die Rudolfskrone.
Detail eines Totenkopfs mit Krone.
Zugang zur Maria-Theresia-Gruft. Dieser Raum wurde vom Kaiserpaar selber entworfen.
Vor dem Doppelsarkophag des Kaiserpaares der schlichte Sarg ihres ältesten Sohnes, Kaiser Joseph II. Die Schlichtheit seines Sarkophags weist deutlich auf seine asketische Gesinnung hin.
Seitenansicht des Doppelsarkophags mit Blick in die Kuppel mit Gemälde.
Auf dem Deckel des Doppelsarkophags ruht das Kaiserpaar Maria Theresia und Kaiser Franz Stephan I. An den Ecken sitzen trauernde Genien mit Kronen und Wappenschildern. Vorne ein Totenkopf mit der österreichischen Kaiserkrone. Maria Theresia schaffte die Folter ab und führte die Schulpflicht ein. Maria Theresia selbst war nicht gekrönte Kaiserin, sondern trug nur den Titel ihres 1745 gekrönten Gatten. Die Regierungsgeschäfte aber leitete sie allein. Durch ihre rücksichtslose Heiratspolitik wurde sie zur Schwiegermutter Europas.
Kaiserin Maria Josepha (1739-1767), 2. Frau von Kaiser Joseph II, dem ältesten Sohn von Maria Theresia. Der Kaiser wollte nach dem Verlust seiner ersten Frau nicht noch einmal heiraten, wurde aber von seiner Mutter dazu gezwungen, diese bayerische Prinzessin zu heiraten. Die Ehe wurde daher denkbar unglücklich. Ihre warmherzige Art brachte ihr die Sympathien des ganzes Hofes ein. Sie kümmerte sich auch liebevoll um die kleine Tochter aus 1. Ehe. Sie starb an den Pocken und wurde wegen des grauenvollen Zustandes ihrer Leiche in einen Sack eingenäht und in den Sarg gelegt. Sarkophag im Stil des späten Rokoko. Auf dem Deckel die deutsche Kaiserkrone, die Königskrone Böhmens und Ungarns, sowie der Sternkreuzorden. Ein Engel und ein trauernder Genius halten ein Medaillon mit dem Bildnis der Kaiserin.
Rechts daneben der Sarkophag ihrer Vorgängerin, der 1. Ehefrau von Kaiser Joseph II, Isabella von Parma (1741-1763). Darunter erkennt man den winzigen Baby-Sarg der tot geborenen Tochter. Die knabenhafte Isabella war eine Schönheit, hochintelligent und von großem Charme. Die Ehe war glücklich, wenngleich sie ihren Gatten eher duldete als liebte. 1763 erkrankte sie an den Pocken, gebar ein totes Mädchen und starb selbst 5 Tage nach der Geburt. Auf dem Deckel des Sarkophags halten zwei weinende Putti das Bildnis Isabellas, sowie Erzherzogshut, Königskrone und Sternkreuzorden.
Maria Theresia (1762-1770), das einzig überlebende Kind Kaiser Josephs II. aus seiner Ehe mit Isabella von Parma. Der Kaiser hing sehr an seiner Tochter und als sie mit noch nicht 8 Jahren starb, verlor Josephs privates Leben jeden Sinn. Auf dem Sargdeckel ruht der Körper des Mädchens in einem langen, mit Blumen verzierten Kleid.
Sarg in der Franzens-Gruft:
Hier stehen die Särge Kaiser Franz II. (I.) und seiner 4 Gattinnen. Er ist der älteste Sohn von Kaiser Leopold II, dem jüngeren Bruder von Kaiser Joseph II. Der Biedermeier-Kaiser Franz II, war ein Familienmensch und gab die Regierungsgeschäfte gerne an Fürst Metternich ab. Spitzelwesen, Zensur und vollkommenes Ablehnen jeder Neuerung kennzeichnen diese Epoche. Die Napoleonischen Kriege brachten auch für Österreich schwere Verluste und kaum zumutbare Friedensbedingungen. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen wurde zerschlagen, Kaiser Franz II. gründete dann das erbliche Kaisertum Österreich und nannte sich fortan Kaiser Franz I. von Österreich. Der Sarkophag im Empire-Stil steht auf einem hohen schwarzen Marmorsockel.
Sarg in der Neuen Gruft:
Kaiser Maximilian von Mexiko (1832-1867), der jüngere Bruder von Kaiser Franz Joseph I. Er heiratete die belgische Königstochter Charlotte, eine bildschöne und ehrgeizige Frau. 1867 wurde Maximilian von mexikanischen Revolutionären standrechtlich erschossen. Seine Frau sank in geistige Umnachtung. Auf dem schlichten Sarg ist das Kreuz und das Wappen Mexikos angebracht.
Särge in der Franz-Josephs-Gruft:
In der Mitte auf einem weißen Marmorsockel der Sarg von Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916). Als er den Thron 1848 von seinem regierungsunfähigen Onkel Ferdinand I. übernahm, hatte er schwer um Anerkennung zu kämpfen. Die Ungarn gingen in offene Rebellion. Auch die Italiener mussten von Feldmarschall Radetzky zur Raison gebracht werden. 1858 ließ er die Basteien, die alten Stadtmauern schleifen und eine breite Prachtstraße um die Altstadt anlegen – die Ringstraße.
Links Grab von Kaiserin Elisabeth „Sisi“ (1837-1898) und rechts von Kronprinz Rudolph (1858-1889). Die Hochzeit zwischen dem Kaiser und seiner Cousine Elisabeth war eine ausgesprochene Liebesheirat. Auf Grund der Zwistigkeiten zwischen Sisi und ihrer Schwiegermutter Erzherzogin Sophie und wegen des ungeliebten Hofzeremoniells, war die Kaiserin häufig auf Reisen. Ihre Liebe und ihrem Engagement für die ungarische Nation ist es zu verdanken, dass sich diese wieder zum österreichischen Kaiserhaus bekannte und das Kaiserpaar auch zum Königspaar von Ungarn gekrönt wurde. Sie wurde am Genfer See vom Anarchisten Luigi Lucheni erstochen. Kronprinz Rudolf war ein hochintelligenter, sensibler und fortschrittlich denkender Mann. Der Gegensatz zur politisch sehr konservativen Einstellung seines Vater, führte zur Entfremdung zwischen Vater und Sohn. Die Ehe mit der kühlen, konservativen und distanzierten Königstochter Stephanie von Belgien war unglücklich. Rudolfs tragischer Selbstmord in Mayerling machte aus seiner Mutter eine tiefunglückliche Frau. Die wahren Hintergründe für seinen Selbstmord zusammen mit Mary Vetsera sind bis heute ungeklärt. Nur dem Umstand, dass die Ärzte Rudolf posthum für geistig verwirrt erklärten, ist es zu verdanken, dass er ein kirchliches Begräbnis erhielt.
Erzherzog Otto (1912-2011), ältestes Kind des letzten österreichischen Kaiserpaares Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita. Er war der Urgroßneffe von Kaiser Franz Joseph I. Aufgrund der kompletten Enteignung durch die Habsburger-Gesetze war die Familie seit 1918 auf Hilfe von Verwandten und Freunden angewiesen. Die Familie lebte im Baskenland, später in Belgien. Er studierte Jura. Von Anfang an Gegner des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich, wurde er ab 1938 steckbrieflich verfolgt und in Abwesenheit von den Nazis zum Tode verurteilt. - Schaufensterauslage mit Orden.
Musikhaus Doblinger in der Dorotheergasse.
Blick in eine typisches Wiener Kaffeehaus mit runden Tischen und Zeitungen zum Lesen.
Laden vom „Wiener Schokoladenkönig“, in der Schaufensterauslage ein Buch zum als Torte, das Innere des Ladens. - Peterskirche: Kollegiats- und Stadtpfarrkirche St. Peter ist eine Nachahmung von St. Peter in Rom. Der Überlieferung nach stand hier zuerst eine spätrömische, dann eine karolingische Kirche. Das jetzige Gotteshaus wurde etwa 1701 im Auftrag von von Kaiser Leopold I. (1640-1705) begonnen. Die alte, schon sehr verfallene Peterskriche wurde samt Friedhof abgerissen. Planung Baubeginn erfolgte unter Gabriele Montani. Ab 1703 setzte Johann Lucas von Hildebrand (1668-1745) den Bau nach verändertem Plan fort. Der Rohbau war dann 1708 fertig. Über dem ovalen Zentralbau erhebt sich eine mächtige Kuppel.
Inneres:
Blick auf den Hochaltar mit einem Bildnis des Kirchenpatrons Petrus. Links vom Chor eine sehr reich dekorierte Barockkanzel. Rechts vom Chor der Johann-von-Nepomuk-Altar.
Hochaltar von Santino Bussi (1664-1736), mit einem Altarblatt von Bartolomeo Altomonte (1694-1783) und einer „Immaculata“ (Darstellung der unbefleckten Empfängnis) über dem Altartisch von Leopold Kupelwieser (1796-1862).
Johann-von-Nepomuk-Altar mit einer „Madonna in der Glorie“ Matthias Steinl (1664-1727) zugeschrieben.
Orgel 1903 von Franz Josef Swoboda (1870-1934) erbaut. Orgelgehäuse von Gottfried Sonnholz (1695-1781) und aus dem Jahre 1751.
Kuppel mit einem Fresko von Johann Michael Rottmayr (1654-1730).
Seitenaltar des Heiligen Franz von Sales. - Einkaufszentrum Tuchlauben 7 A mit einem Laden von Armani.
Gösser Bierklinik oder Zum Steindl, 1406 erstmals urkundlich erwähnt und damit die älteste Wiener Gaststätte.
Inneres mit 2 römischen Steinen an der Wand. - Am-Hof-Kirche oder Kirche zu den neun Engelschören: gotische Hallenkirche, 1386-1403, ca. 1607 barock umgestaltet. Ehemalige Jesuitenkirche, ab 1773 Garnisonskirche. 1789 wurde der Altarraum durch den Architekten Johann Nepomuk Amann (1765-1834) im klassizistischen Stil umgebaut. Es erfolgte der Bau einer Apsiskuppel und der Einbau eines kassettierten Tonnengewölbes in der Apsis. Heute ist es die Kirche der kroatischen Gemeinschaft.
Kanzel und ein Seitenaltar.
Apsis mit dem Hochaltar. Das Gemälde „Maria umgeben von den neun Chören der Engel“ von Johann Georg Däringer (1759-1809) entstand in der Zeit des Umbaus der Apsis 1789.
Blick auf die Orgel über dem Eingang, mit dem reich gegliederten Gehäuse von 1763. Sie wird Johann Friedrich Ferstl (ca. 1720-1785) zugeschrieben. - Am Hof: es ist der größte Platz Wiens. Schon die Römer hatten hier ihr Heerlager „Vindobona“ aufgeschlagen. Im 12. Jahrhundert errichteten die Babenberger hier ihre Pfalz. Der Minnesänger Walther von der Vogelweide hielt die glänzenden Feste hier in Versen fest. Die Säule mit der bronzenen Maria Immaculate wurde ca. 20 Jahre nach Ende des 30jährigen Krieges aufgestellt. Auf dem Platz ein Festzelt.
Historisierende Fassade eines Hauses am Platz „Am Hof“, Ecke Iris Gasse. - Palais Ferstel: 1856-1860 von Heinrich von Ferstel (1828-1883) für die Nationalbank entworfen. Er ist auch der Architekt der Votivkirche und der Universität. Es ist ein bedeutendes Gebäude des romantischen Historismus. Bis 1877 war hier die Börse untergebracht, jetzt ist es eine elegante Einkaufspassage.
Detail des Gewölbes.
Blick auf den mit Glas gedeckten Durchgang von 1861.
Details der Seitenwände mit Bögen, hinter denen sich Läden befinden. Über den Bögen Flachreliefs, Konsolen mit Karyatiden tragen das Glasdach.
Laden mit von der Decke hängenden Schinken.
Donaunixenbrunnen nach einem Entwurf von Heinrich von Ferstel. Die Statuen stammen von Anton Dominik von Fernkorn (1813-1878). Über dem marmornen Brunnenbecken eine Säule mit einer Statue aus Bronze. Es handelt sich um das Donauweibchen mit langem Haar, welches einen Fisch in der Hand hält. Darunter an der Säule 3 weitere Figuren die Berufe darstellen, die mit Wasser zu tun haben: Kaufmann, Fischer und Schiffbauer.
Details des Brunnen. - Eingang vom Palais Batthyany. Um 1695 erbaut. Fassade in der Art des Johann Bernhardt Fischer von Erlach (1656-1723).
- Minoritenkirche: Die Minoriten oder Minderbrüder waren Franziskaner. Gotische Hallenkirche unter Albrecht dem Weisen im 14. Jahrhundert erbaut. Seit 1786 heißt sie „Italienische Nationalkirche Maria Schnee“, seit 1957 ist sie Franziskanerkirche. Insgesamt repräsentiert die Kirche eher einen höfisch beeinflussten Stil als die typische Architektur der Bettelorden. Dies zeigt sich auch daran, dass sie einen Turm besitzt. Sie war eine der ersten gotischen Kirchen im Osten von Österreich. Die Kirche kopiert das Schema des französischen Kathedralbaus. Der Architekt ist unbekannt. Man geht heute davon aus, dass Jacobus von Paris, der Beichtvater von Herzog Albrecht II. (1298-1358) stark beteiligt war.
Blick von Südosten. Links der neugotische Bau der Sakristei.
Fassade im Westen mit dem gotisches Hauptportal von Herzog Albrechts Beichtvater Jacobus von 1340-1345 gestaltet. Es folgt einem französischen Schema, wie es in Österreich eher selten ist. Das Tympanon ist durch Zirkelschläge in drei Felder unterteilt, wobei im mittleren Feld Christus auf einem Astkreuz dargestellt ist. Links sieht man die trauernde Maria mit Maria Magdalena und anderen weiblichen Figuren, rechts Johannes den Evangelisten, den Hauptmann Longinus und andere männliche Figuren. Die jeweils äußerste männliche und weibliche Figur könnten Herzog Albrecht II. und seine Gemahlin Johanna von Pfirt sein. Die Figuren sind sehr elegant und feingliedrig dargestellt – wohl ein französischer Einfluss und zugleich wichtiges Stilmerkmal der Minoritenwerkstatt, die bis etwa 1360 nachweisbar ist. In der Mitte die Statue der Muttergottes.
Im Gewände links der Apostel Philippus, dann Johannes der Täufer mit dem Lamm und mit dem Kelch der Evangelist Johannes. Rechts die Heilige Ursula mit Pfeil, die heilige Margarethe mit ihrem Attribut dem Schwert und die Heilige Helena mit dem Kreuz.
Inneres:
Blick zum Hochaltar. Die 3-schiffige Hallenkirche ist 40 x 32 m groß. Die Pfeiler sind 25 m hoch und trennen die 3 gleich hohen Schiffe.
Hochaltarbild von Christoph Unterberger (1732-1798) ist eine Kopie, das Original „Maria Schnee“ wird auf dem Esquilin in Rom verehrt.
Mosaikkopie des berühmten Abendmahls von Leonardo da Vinci von Giacomo Raffaelli (1753-1836). Kaiser Napoleon I. (1769-1821) hatte diese Kopie einst bestellt, da er das Mailänder Original nach Paris entführen wollte. Nach Napoleons Sturz kaufte der österreichische Hof das Werk an, da ja Kaiser Franz I. der Schwiegervater von Napoleon war. Seit 1845 befindet es sich wieder in der Minoritenkirche.
Die Orgel hinter einem neogotischen Prospekt gehört zu den bedeutenden historischen Orgeln Wiens. Sie wurde nach Plänen von Johann Milani und Ferdinand Hetzendorf unter Verwendung der Pfeifen, des Spieltischgehäuses und anderer Teile, von einer 1673 erbauten Vorgängerorgel von Franz Xaver Christoph (1728-1793) 1786 gebaut. Sie ist weitgehend im Original erhalten.
Blick in das Kirchenschiff.
Das Gewölbe. - Bundeskanzleramt, die ehemalige „Geheime Hofkanzlei“ 1717-19 nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) erbaut und mehrfach erweitert. Hier bestimmten mächtige Kanzler wie Kaunitz unter Maria Theresia und Fürst Metternich unter Franz I. und Ferdinand I. die Geschicke des Landes. Nach dem Fall Napoleons war das Gebäude 1814/15 Schauplatz des Wiener Kongresses, auf dem Europa seine Neuordnung erhielt. Im Marmorecksalon des Hauses wurde der konservativ-autoritäre Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (1892-1934) während eines national-sozialistischen Putschversuches ermordet.
Davor ein Fiaker. - Ehemalige Hofsilber- und Tafelkammer: sie befindet sich im ehemaligen Reichskanzleitrakt der Wiener Hofburg. Schon im 15. Jahrhundert sind Silberkämmerer nachweisbar, damals allerdings mit anderen Aufgaben. Im 18. Jahrhundert wurde die Silberkammer zur Hofsilberkammer. Hier wurde das Tafelsilber verwaltet und gepflegt. Jeden Tag wurden nach einer genauen Auflistung die Tafelgeräte aus Silber bereitgestellt. Zum Tragen des Tafelsilbers war fremdes Personal nicht zugelassen und die Wege des Personals wurden bewacht. Im 19. Jahrhundert wurde die Silberkammer mit der Tafelkammer vereinigt. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie gingen die Bestände in den Besitz der Republik Österreich über.
Kanne aus üppig dekoriertem Porzellan mit Neptun, Segelschiffen und Fischen.
Grand Vermeil: seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wurden große, einheitliche Gold-, Vermeil- oder Silberservice für die fürstliche Tafel üblich. Mit dem Grand Vermeil besitzt die ehemalige Hofsilber- und Tafelkammer eines der bedeutendsten Service aus feuervergoldetem Silber. Es umfasst 4.500 Stück mit einem Gesamtgewicht von ca. 1.100 kg. Das ursprünglich für 40 Gedecke ausreichende Service wurde vermutlich um 1808 von Eugène de Beauharnais von Leuchtenberg (1781-1824), dem Stiefsohn Kaiser Napoleons I., beim Goldschmied Martin-Guillaume Biennais (1764-1843) in Auftrag gegeben. Es war für den Mailänder Hof bestimmt. Nach dem Sieg über Napoleon, wurde das lombardo-venezianische Königreich dem österreichischen Kaiserreiche angegliedert.
Altfranzösischer Tafelaufsatz aus vergoldeter Bronze.
Desserteller von 1803 mit der Darstellung von Antiochus und Stradonice.
Blumenteller 1819-1823 entstanden, mit braunem Grund. Ende der 1820ger Jahre wurden sie um Blumenteller mit weißem Grund ergänzt.
Gedeck aus goldfarben umrandeten weißen Porzellan, gefalteter Serviette, Besteck und Gläsern.
Mailänder Tafelaufsatz von Luigi Manfredini (1771-1840), 1838 aus vergoldeter Bronze. Hergestellt wurde es anlässlich der Krönung von Kaiser Ferdinand zum König des lombardo-venetianischen Königreichs. Im Mittelteil des Tafelaufsatzes die allegorische Figur der Lombardia mit Mauerkrone und Füllhorn.
Habsburgerservice: 1821-1824 angefertigt von der Wiener Porzellanmanufaktur im Auftrag von Kaiser Franz II. (1768-1835) Es ist ein Dessertservice in romantisch-gotisierender Form, dekoriert mit dem Portraits habsburgischer Herrscher und ihrer Frauen.
Weiß-goldenes Speiseservice 1851 vom Wiener Hof bei der Manufaktur Thun, Klösterle in Böhmen, bestellt. Suppenterrine. Im Hintergrund Statuen aus Porzellan vom Kaiserpaar Franz Joseph I. und Elisabeth.
Barocker Tafelaufsatz aus vergoldeter Bronze. Der Brauch, Tafeln für die Mahlzeit zu verzieren, ist sehr alt. Neben Eßbarem wurden auch nicht eßbare Materialien verwendet. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts begann man, die seit jeher vergänglichen Tafeldekore, durch andere Materialien zu ersetzen.
Service mit den grünen Bänders aus Sèvres, 1756/57. Ein Geschenk von König Ludwig XV. von Frankreich an Kaiserin Maria Theresia.
Kunstvoll gefaltetes Tischtuch in der Form eines Pfaus.
Service für den Wiener Kongress 1814. Damals war kein entsprechendes Edelmetallservice mehr am Habsburgerhof vorhanden, da aus Anlass der napoleonischen Kriege alle aus Edelmetall hergestellten Service vermünzt wurden. Aus Dekorationsgründen und um den Schein zu wahren, bestellte man bei der Wiener Porzellanmanufaktur ein Service und vergoldete es.
Durchbrochene Schale aus Porzellan mit Widderköpfen, mit Blumen bemaltes Geschirr.
Details eines altfranzösischen Tafelaufsatzes aus vergoldeter Bronze 1838.
Tafelaufsatz mit Crèmetöpfchen aus dem Minton Dessertservice. Dieses Service von Herbert Minton (1793-1858) gehörte bei der Weltausstellung im Londoner Crystal Palace 1851 zu den besonderen Prunkstücken. Es wurde von Königin Victoria (1819-1901) gekauft und zahlreiche Teile gingen als Geschenk an Kaiser Franz Joseph I. Der Rest befindet sich noch heute im Buckingham Palace in London. - Sisi-Museum in der Wiener Hofburg: Replik des sogenannten Polterabendkleides der zukünftigen Kaiserin Elisabeth (1837-1898). Arabische Schriftzeichen verzieren den Rock und die Stola. Übersetzt bedeuten sie „Oh mein Herr, welch schöner Traum“. In der Realität empfand Elisabeth diese Leben an der Spitze der höfischen Hierarchie wohl eher als Alptraum. Zeitlebens lehnte sie dieses Leben ab und anerkannte die Berechtigung einer derart strengen Etikette nie.
Replik des ungarischen Krönungskleides. Es dürfte der Höhepunkt in Sisis Leben gewesen sein, als sie 1867 zur ungarischen Königin gekrönt wurde. In den Jahren zuvor war sie sehr an Politik interessiert und setzte sich vehement für den ungarischen Ausgleich ein, indem sie Franz Joseph I. massiv beeinflusste. Das Kleid aus Silberbrokat und Spitzen ist an die ungarische Tracht angelehnt. - Kaiserappartments in der Wiener Hofburg:
Appartment von Kaiser Franz Joseph (1830-1916)
Audienzzimmer: hier empfing der Kaiser im Laufe seines Lebens ca. 260.000 Personen. Während der Audienz bleiben sowohl der Kaiser, als auch der Besucher stehen. Mit einem kurzen Kopfnicken beendete Franz Joseph I. die Audienz. Auf einer Staffelei befindet sich das letzte Portrait des Kaisers von Heinrich Lorenz Wassmuth (1870-1949). Es entstand 1915, ein Jahr vor dem Tod des Kaisers.
Arbeitszimmer: 4 Uhr früh begann Franz Joseph I. täglich seine Arbeit. Die ersten bearbeiteten Akten wurden 6 Uhr abgeholt und ein erstes Frühstück folgte. Gegen 11 Uhr ein zweites Frühstück. Die Hauptmahlzeit wurde in der Regel erst nachmittags gegen 17 Uhr eingenommen. Da das Arbeitszimmer für den Kaiser das eigentliche Wohnzimmer war, befanden sich hier zahlreiche Familienportraits. Berühmt ist das Gemälde von Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) mit einem Portrait der Kaiserin Elisabeth mit offenem, vor der Brust verschlungenem Haar, das Lieblingsbild des Kaisers.
Appartment von Kaiserin Elisabeth (1837-1898)
Wohn- und Schlafzimmer: Bis1870 war dieser Raum das gemeinsame Schlafzimmer des Kaiserpaares, dann übersiedelte Franz Joseph in einen eigenen Schlafraum. Das Bett Elisabeths, ein „gesundes“ Eisenbett, steht mitten im Zimmer hinter einem Paravan.
Zur originalen Ausstattung aus dem Besitz von Elisabeth gehört auch ein kleiner Schreibtisch mit dazugehörigem Sessel.
Toiletten- und Turnzimer Elisabeths: Auch hier liegen Perserteppiche aus dem Privatbesitz der Kaiserin. Dies war der Raum, in dem sie sich am meisten aufgehalten hat. Im Winter begann der Tag um 6 Uhr mit dem täglichen Frisierritual. Elisabeths Haarpracht war legendär und ihre Friseuse Fanny Feifalik zauberte täglich die kunstvollsten Frisuren. Während der stundenlangen Prozedur sprach sie mit ihrem griechischen Vorleser, um die Sprache zu studieren. Sie erlernte während ihres Lebens 7 Fremdsprachen. Im gleichen Raum verrichtete sie ihre täglichen Turnübungen. Für intensivere Übungen hatte sie einen großen Turnsaal, der heute nicht mehr existiert.
Badezimmer: 1876 neu ausgestattet. Die Badewanne aus verzinktem Kupferblech steht auf originalem Linoleumboden, der Feuchtigkeitsschäden vom Parkett verhindern sollte.
Berglzimmer: Johann Baptist Wenzel Bergl (1718-1789) schuf die illusionistischen Landschaftsmalereien 1766 im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia. Hier befand sich die ehemalige Garderobe der Kaiserin.
Großer Salon: Er diente als Empfangs-Salon. Die Gemälde zeugen von ihrer Liebe zu Griechenland. Hinten in der Ecke eine Statue aus Marmor mit der Muse Polyhymnia von Antonio Canova (1757-1822). Gelegentlich frühstücke das Kaiserpaar in diesem Raum. - Spanische Hofreitschule: Sie liegt im Michaelerstrakt der Hofburg. Die seit Jahrhunderten gezüchteten Lipizzanerhengste sind Erbe und letztes lebendes Relikt der Prunk- und Festkultur der Donaumonarchie. Als Institution geht die 1572 erstmals urkundlich erwähnte Reitschule auf Kaiser Maximilian II. (1527-1576) zurück, der mit der Zucht spanischer Pferde in Österreich begann. Die „Rosseballette“ und gerittene Karussellchoreografien gehörten seit dem 16. Jahrhundert zu den Höhepunkten des Hofes. Lipizzaner entstammen einer Kreuzung von „Berbern“ und „Arabern“ mit spanischen und italienischen Pferden.
Liste der Oberbereiter
Statuen aus Porzellan mit Lipizzanern.
Innenhof der Stallungen.
Ein Reiter in der, seit fast 200 Jahren, unveränderten Empire-Uniform. Dazu gehört unter anderem ein brauner hochgeschlossener Reitfrack, eine weiße Hose und ein Zweispitz.
Lippizaner im Stall. - Augustinerkirche: 1327 stiftete der Habsburger Herzog Friedrich der Schöne (1289-1330) dem Augustiner-‚Eremiten-Orden eine Kirche mit Kloster. Das Langhaus entstand 1330-1339, erbaut von Dietrich Landtner von Pirn, wurde allerdings erst 1349 geweiht. Einschiffige gotische Hallenkirche, der Chor wurde 1400 hinzugefügt. Eine später eingebrachte Barockausstattung wurde im 18. Jahrhundert wieder entfernt. Die Kirche liegt direkt am Josefsplatz, dicht an der Albertina. Sie war die kaiserliche Hofpfarrkirche und daher wiederholt Schauplatz großer Hochzeiten, z.B. wurde hier 1810 Erzherzogin Marie-Louise mit Napoleon I. getraut. Auch Kaiser Franz Joseph I. heiratete hier seine Elisabeth von Bayern, ferner Erzherzog Rudolph, ihr einziger Sohn die Königstochter Stephanie von Belgien, eine eher unglückliche Verbindung.
Blick in den dreischiffigen, 43 m langen Innenraum. Höhe 20 m.
Hochchor, 10 m breit, 24 m hoch.
Hochaltar aus Sandstein im neogotischen Stil von Bildhauer Andreas Halbig (1807-1869). 1857-1870 für die Votivkirche entworfen. Der Architekt Heinrich von Ferstel hatte diesen Altar für die Votivkirche abgelehnt. Daher wurde er 1873/74 hierher transportiert. In der Mitte Christus als Weltenherrscher, umgeben von Engeln und den Namenspatronen von Kaiser Franz Joseph I.
Blick zur Orgel, 1976 von der Orgelbaumanufaktur Rieger neu erbaut. Erhalten blieb das historische Prospekt aus der Zeit um 1785.
Christinendenkmal, der Höhepunkt klassizistischer Grabmalskunst von Antonio Canova (1757-1822). Herzogin Marie Christine von Sachsen-Teschen (1742-1798), war die Lieblingstocher von Maria Theresia und durfte als einziges Kind der Kaiserin aus Liebe heiraten. Das Grabmal entstand 1798-1805. Unter der Spitze der Wandpyramide trägt der Genius der Glückseligkeit das Medaillon der Erzherzogin.
Herzgruft der Habsburger:
König Ferdinand IV. (1633-1654), der früh verstarb, legte testamentarisch fest, dass sein Herz seiner Großmutter zu Füßen gelegt werden sollte. Damit entstand der Brauch, die Herzen der verstorbenen Habsburger, in kleinen silbernen Urnen, in der Herzgruft der Loretokapelle beizusetzen. Insgesamt ruhen heute 54 Herzen in der schlichten Gruft. Das Herz von Kaiserin Anna (1585-1618), der Frau von Kaiser Matthias (1557-1619) war das erste, welches hier beigesetzt wurde. Insgesamt sind hier die Herzen von 9 Kaiser, 8 Gemahlinnen von Kaisern und Kaiserinnen, einem König, einer Königin, 14 Erzherzöge, 14 Erzherzoginnen + 2 Herzöge beigesetzt. Das letzte Herz wurde 1878 hier beigesetzt. Es ist das Herz vom Vater von Kaiser Franz Joseph I., dem Erzherzog Franz Karl (1802-1878). Die Gebeine liegen in der Kapuzinergruft und die Eingeweide in den Katakomben des Stephansdoms. - Schmetterlinge im tropischen Schmetterlingshaus an der Hofburg:
Athyma perius oder Asiatischer Eisvogel.
Blauer Morphofalter
Ein Handteller großer toter Schmetterling.
Bananenfalter an einer rosafarbenen Kunstblume.
Siproeta stelenes oder Malachitfalter.
Königspage auf einer roten Blüte.
Verschiedene Puppen von Schmetterlingen.
Idea leuconiae oder Weiße Baumnymphe.
Kleiner Mormon.
Dryas iulia oder Juliafalter am Wandelröschen. - Prater:
Das Riesenrad als kleines Modell.
Der Prater ist ein großer Park zwischen Donau und rechtem Donaukanal. Erstmals 1403 erwähnt. Maximilian II. (1527-1576) zäunte das Gebiet im 16. Jahrhundert ein, um es als persönliches Jagdrevier zu nutzen. Erst 1766 wurde es für die Öffentlichkeit geöffnet. 1767 entstanden die ersten Wurstelpraterbuden. Seit 2010 steht hier der 117 m hohe Praterturm, das weltgrößte Kettenkarussel.
Ein historisches Karussel mit echten Pferden.
Verschiedene Buden.
Bunter, phantasievoll gestalteter Eingang der Grottenbahn.
Wildalpenbahn
Im vorderen Teil des 1287 Hektar großen Geländes liegt der berühmte Vergnügungspark mit dem Riesenrad. Das Riesenrad ist eines der Wahrzeichen Wiens. Das Rad hat einen Durchmesser von über 60 m.
Denkmal für Basilio Calafati (1800-1878) dem Älteren, der als der Gründer des Prater gilt. Im Hintergrund der Eingang zu Madame Tussaud.
Eingangsbereich mit Informationsschalter. - Kaiserliche Schatzkammer in der Hofburg: eine der bedeutendsten Schatzkammern der Welt. Die Wurzeln liegen in der „Kunstkammer“ Ferdinands I. (1503-1564). Seit dem 16. Jahrhundert trugen die Kaiser Schätze zusammen. Es ein Teil der einstigen Sammlungen der Häuser Habsburg und Habsburg-Lothringen. In 23 Räumen werden Objekte von dynastischer und religiöser Bedeutung gezeigt. Maria Theresia (1717-1780) trennte den Kronschatz von der restlichen Sammlung und stellte sie in der Hofburg auf. Ein Teil der damaligen kaiserlichen Kunstkammer wurde verkauft, um die damals geführten Kriege gegen Preußen zu finanzieren. 1800 wurden die Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reichs in der Wiener Schatzkammer hinterlegt, wo sie sich bis heute befinden. Man hatte sie zum Schutz vor dem Zugriff durch Napoleon, aus ihren ursprünglichen Aufbewahrungsorten Nürnberg und Aachen 1796 nach Regensburg gebracht.
Nach dem Ende der Monarchie 1918, befindet sich die Sammlung heute im ältesten Teil der Hofburg, dem Schweizertrakt.
Karte des Kaisertums Österreich von 1804 – 1918, also nach den Napoleonischen Kriegen.
Krone von Kaiser Rudolf II. (1552-1612), seit 1804 Krone des Kaisertums Österreich. Entstanden 1602 in Prag. Kaiser Sigismund (1368-1437) ließ 1424 die alte Reichskrone in Nürnberg verwahren, von wo man sie jeweils zu den Krönungen brachte. Die Kaiser besaßen daneben eine Privatkrone, für die sich der Typus der Mitrenkrone ausgebildet hatte. Sie besteht aus dem Kronreif mit Lilienkranz, aus dem kaiserlichen Hochbügel von der Stirn zum Nacken und aus der Mitra, die das hohepriesterliche Gottesgnadentum symbolisiert. Die Diamanten den Kronreifs symbolisieren Christus, auf den sich die Herrschaft der Könige beruft. Die Rubine der Lilien verweisen mit ihrem Rot auf die Weisheit des Königs. Der blaue Saphir, der über dem Kreuz steht, bedeutet den Himmel. Die Mitra, die früher aus Stoff war, blieb ohne Steine. Die 4 goldenen Felder der Mitra stellen im Flachrelief die 4 Haupttitel Rudolfs II. dar. Rechts z.B. die Krönung zum König von Ungarn in Preßburg und der Ritt über den Krönungshügel.
Ornat für einen Ritter I. Klasse des österreichischen Ordens der Eisernen Krone. Napoleon Bonapaarte begründete diesen zivilen Verdienstorden für das Königreich Italien. Über einem orangefarbenen Samtrock trug der Ritter einen Radmantel aus violettem Samt mit aufwändiger Stickerei.
Blauer Krönungsmantel des lombardo-venetianischen Königsreichs von 1838. Dieses Königreich fasste jene oberitalienischen Provinzen zusammen, die auf dem Wiener Kongress 1815 Österreich zugesprochen worden waren. Schon 1859 musste sich Österreich wieder aus der Lombardei zurückziehen. Der helle Rand des Mantels zeigt die Eiserne Krone.
Mantel des österreichischen Kaisers von 1830. Das Streumuster des auf dem roten Samt besteht aus Doppeladlern mit dem österreichischen Wappen im Brustschild, die Bordüre aus Eichenlaub und Lorbeerblättern. Beide Mäntel sind ein Entwurf des Hoftheaterkostümdirektors in Wien Philipp von Stubenrauch (1784-1848).
Bildnis von Kaiser Napoleon I. als König von Italien von Andrea Appiani (1754-1817).
Taufkanne und Taufschüssel: von einem spanischen Meister wurde 1571 etwa 10,5 kg Gold verarbeitet. Es war ein Hochzeitsgeschenk der Kärntner Stände an Erzherzog Karl von Innerösterreich (1540-1590) und Maria von Bayern. Seit dem 17. Jahrhundert benutzt man es für Taufen.
Altar aus Bernstein, 1640/45, Höhe 1,90 m
Schale aus Achat: aus Konstantinopel, 4. Jahrhundert. Diese mit Henkel 76 cm breite Schale aus einem einzigen Stück Achat geschnitten, galt lange Zeit als das beste Hauptstück der ganzen Schatzkammer. Die hohe Wertschätzung bezog sich weniger auf das Meisterwerk antiker Steinschneidekunst, als vielmehr auf den Umstand, dass im Boden der Schale bei bestimmten Lichteinfall in der Maserung des Steins der Name Christi erscheint. Vermutlich deshalb entstand die Vorstellung, die Schale sei der Heilige Gral gewesen.
Reliquar mit einem Partikel des Kreuzes Christi, sogenannte Sternkreuzordensmonstranz. Kaiserin Eleonore (1628-1686) stiftete 1668 den Sternkreuzorden, den höchsten Damenorden in Österreich. Die Monstranz von 1668, wird dem Goldschmied Hans Jakob Mair (1641-1719) zugeschrieben.
Ungarischer Opalgürtel, Budapest 1881. Es war ein Geschenk der Stadt Budapest an Kronprinzessin Stephanie (1864-1945) anlässlich ihrer Vermählung mit Kronprinz Rudolph, dem einzigen Sohn von Franz Joseph I und Elisabeth.
Aquamarin mit Fassung um 1800. 5,8 cm hoch, 7,4 cm lang, 4,55 cm breit.
Goldene Rose, Rom 1818/19. Der Papst segnete jeweils am 4. Fastensonntag eine goldene Rose. Diese Rose widmete Papst Pius VII. (1742-1823) 1819 Kaiserin Carolina Augusta (1792-1873) der 4. Gemahlin von Kaiser Franz I. Die 12 Rosen symbolisieren die 12 Apostel, die 13. an der Spitze, die Moschus und Balsam enthielt, verweist auf Christus.
Krone vom siebenbürgischen Fürsten Stephan: türkisch um 1605. Der calvinistische Adelige Stephan Bocskai (1557- 1606) hatte sich aus Religionsgründen gegen Rudolf II. (1552-1612) erhoben und nach militärischen Erfolgen zum Fürsten von Siebenbürgen und Ungarn wählen lassen. Der türkische Sultan erkannte ihn an und krönte in durch den Großwesir Lala Mehmed Pascha.
Königlich ungarische Sankt-Stephans-Orden: von Maria-Theresia gestiftet anlässlich der Wahl ihres Sohnes Joseph II. (1741-1790) zum römischen König und als Pendant zum Militär-Maria-Theresien-Orden. Der nach dem heiligen ungarischen König Stephan benannte Orden, war bis 1918 der höchste zivile Verdienstorden der Monarchie.
Kleinod des Ordens vom goldenen Vlies: um 1780/1790, aus Gold, Diamanten und 3 großen Peridoten.
Militär-Maria-Theresien-Orden, militärischer Orden 1757 von Maria-Theresia gestiftet, nach dem Sieg der Österreicher über Preußen bei Kolin 1757. Es war der höchste militärische Orden der Habsburgermonarchie. Hier der Bruststern des Großkreuzes.
Hyazinth „La Bella“, ein Granat von 416 Karat in einer Wiener Fassung 1687. Kaiser Leopold I. (1640-1705) erwarb das Kleinod 1687 von einer ungarischen Adelsfamilie. Innen Fassung mit weißem Astwerk aus dem frühen 15. Jahrhundert. Heute gefasst in den kaiserlichen Doppeladler, der mit Schwert und Zepter die Wappen Ungarns und Böhmens in den Fängen hält.
Krönungsmantel, Palermo 1133/34 Stoff aus Byzanz oder Theben. Wie die kufische Inschrift im Halbkreissaum berichtet, entstand der Mantel am Hof König Rogers II. (1095-1154) in Palermo. Der islamische Künstler schmückte den Mantel mit alten Symbolen der Macht. In der Mitte der Lebensbaum, rechts und links ein Löwe, der ein Kamel besiegt. Der Mantel gelangte als Teil des Schatzes der normannischen Könige auf dem Erbweg an die Hohenstaufen.
Gemälde mit Karl dem Großen (747-814): entstanden Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Eine Kopie nach Albrecht Dürer. Dargestellt ist er mit den Reichskleinodien, der Reichskrone, Schwert und Reichsapfel.
Reichskrone: 2. Hälfte 10. Jahrhundert, Kronenkreuz frühes 11. Jahrhundert, Bügel aus der Zeit Konrads II. (990-1039). Das Oktogon der Grundform enthält die Zahl der kaiserlichen Repräsentation, die in vielen imperialen Werken aufscheint (z. B. Der Pfalzkapelle in Aachen). Die 12 großen Steine der Stirnplatte symbolisieren die 12 Apostel (neuer Bund), die 12 Steine der Nackenplatte die 12 Stämme Israels, den alten Bund. Als Anlaß für die Herstellung der Krone wird u.a. die Krönung Ottos des Großen (912-973) 962 oder seines Sohnes Otto II. (955-983) genannt.
Reichskreuz: ca. 1030. Ursprünglich ein Reliquiar für die Reichsreliquien. In Aussparungen des Holzkernes lagerte die Heilige Lanze und Kreuzpartikel.
Heilige Lanze: karolingisch, 8. Jahrhundert. Die karolingische Flügellanze ist in der Mitte ausgestemmt, um einen Eisenstift mit 3 knotenartigen Verdickungen. Im 11. Jahrhundert hielt man den Stift für einen Kreuznagel und die Lanze für jene des heiligen Mauritius. Im 13. Jahrhundert wurde daraus die Heilige Lanze, mit der Longinus die Seite Christi geöffnet hatte. Als vornehmste Reichsinsignie stand sie im Rang über der Krone. Ihrer Kraft schrieb man die Siege Ottos I. 955 über die Ungarn auf dem Lechfeld zu.
Reliquiar mit Kreuzpartikel: Der sehr große Span mit dem Nagelloch soll vom Blut Christi getränkt worden sein.
Stephansbursa: karolingisch 1. Drittel 9. Jahrhundert. Bekrönung 15. Jahrhundert. Reliqiuar in Form einer Pilgertasche (Bursa), soll blutgetränkte Erde vom Martyrium des heiligen Stephan enthalten haben.
Reichsevangeliar oder Krönungsevangeliar: ca. 800 am Hofe Karls des Großen entstanden. Bei der Krönung legte der neue König auf dieses Evangeliar den Eid ab. Auf dem Einband thront Gottvater. In den Eckmedailons die Symbole der Evangelisten.
Wappenkette für den Herold des Ordens vom Goldenen Vlies, niederländisch ca. 1517. - Rückflug nach Berlin.
Rathaus Spandau und Altstadt Spandau mit der Nicolaikirche links.
Zitadelle und die Brücke nach Eiswerder
Alle Fotos unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Bitte beachten Sie meine AGB, sowie die Vereinbarungen zum Nutzungsrecht.